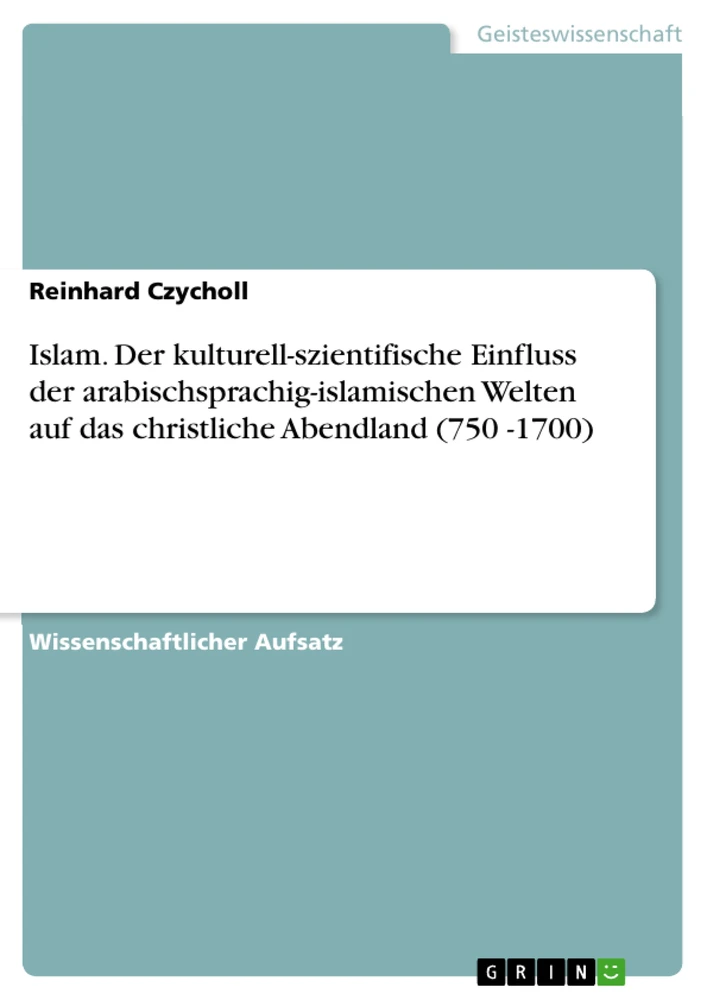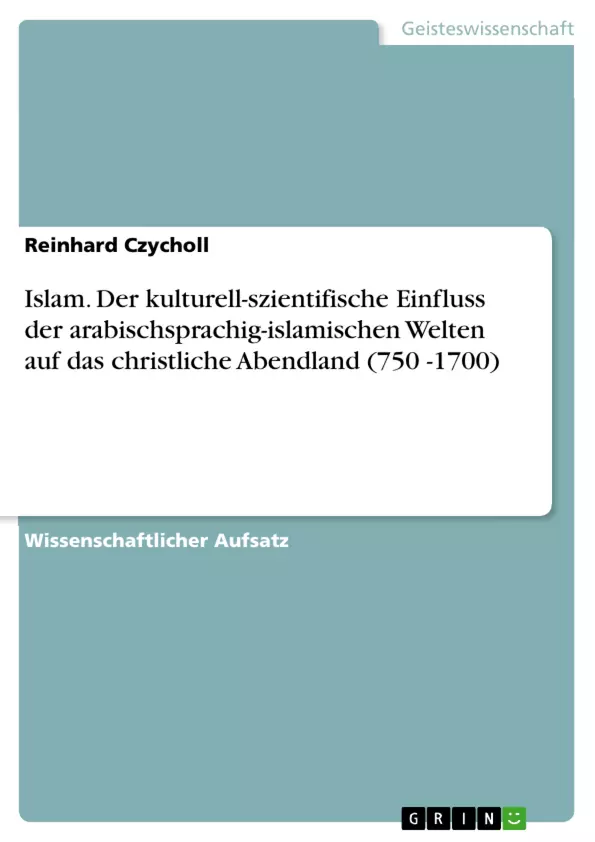In der europäischen Wissenschaftsgeschichte ist immer noch ein eurozentrischer Blick verbreitet, der den Mythos einer Renaissance pflegt, die sich als unmittelbare Fortsetzung des antik-griechischen Erbes versteht. Damit zusammen hängt das traditionelle wissenschaftshistorische Narrativ, welches das universalhistorische Kontinuitätsaxiom negiert. Die Ausführungen belegen und veranschaulichen mit vielen Beispielen, dass der arabisch-islamische Bereich in der Periode zwischen der Spätantike und der europäischen Neuzeit der entwicklungsfähigste und in seiner Ausstrahlung stärkste Kulturraum war und das eigentliche Bindeglied zwischen der alten Welt und dem werdenden Abendland.
Reinhard Czycholl
Der kulturell-szientifische Einfluss der arabischsprachig-islamischen Welten auf das christliche Abendland (750 -1700)
Vorwort
Der Titel meiner im GRIN-Verlag erschienenen Publikation „Islam - Historischpolitische, religiös-rechtliche, konfessionelle, zivilisatorisch-kulturelle, aktuelle und historisch-kritische Aspekte“ verdeckt für interessierte LeserInnen die dort in einem Kapitel behandelte Frage nach dem Einfluss der arabisch-sprachigen islamischen Welt auf die zivilisatorisch-kulturelle Entwicklung des lateinischen Europa, mit besonderem Bezug auf die Entwicklung der Wissenschaften.
Diese Frage ist bis heute hoch aktuell. Ein Grund ist der in der europäischen Wissenschaftsgeschichte immer noch verbreitete eurozentrische Blick, der den Mythos einer Renaissance pflegt, die sich als unmittelbare Fortsetzung des antikgriechischen Erbes versteht1. Nach Strohmeier2 sei es an der Zeit, Abschied zu nehmen „von einem letztlich rassistisch motivierten Europamythos, der uns in einer exklusiven Kontinuität mit den alten Griechen“ sieht.
Damit zusammen hängt das traditionelle wissenschaftshistorische Narrativ, welches das universalhistorische Kontinuitätsaxiom negiert. Weder Kopernikus noch Galilei haben die Naturwissenschaft ex nihilo revolutioniert. Stattdessen ist mit Jürgen Renn3 von einer permanenten Evolution des Wissens auszugehen. Im Rahmen unserer Thematik heißt dies, „dass der arabisch-islamische Bereich in der Periode zwischen der Spätantike und der europäischen Neuzeit der entwicklungsfähigste und in seiner Ausstrahlung stärkste Kulturraum und das eigentliche Bindeglied zwischen der alten Welt und dem werdenden Abendland war“4.
Wegen der Aktualität dieser Fragen habe ich mich entschieden, das entsprechende Kapitel aus der oben genannten Publikation als selbständige Broschüre herauszugeben. Dem GRIN-Verlag danke ich dafür.
Im Februar 2025 Reinhard Czycholl
Der kulturell-szientifische Einfluss der arabischsprachig-islamischen Welten auf das christliche Abendland (750 -1700)
Die in obigem Titel steckende These, dass das christliche Abendland in zivilisatorischer und kultureller Hinsicht dem Islam etwas oder möglicherweise sogar viel zu verdanken habe, wird heute von vielen entweder mit Ablehnung, mit Zweifel oder zumindest mit überraschtem Erstaunen zur Kenntnis genommen.
1. Polarisierende Ansichten zum arabisch-islamischen Einfluss
auf die kulturelle Entwicklung des christlichen Abendlandes
Generell wurden und werden die zivilisatorischen und kulturellen Leistungen der arabischsprachigen Welten generell und ihre Einflüsse auf Europa speziell eher spärlich erkundet und beschrieben. Wie ein roter Faden dagegen zieht sich im europäischen Diskurs die Auseinandersetzung um den Islam als Religion und seinen Propheten durch die Jahrhunderte.
Aus christlicher Sicht wird der Islam von Anfang an als ein verfälschender Abklatsch der christlichen Lehre interpretiert und bekämpft. Die dämonisierende Beschreibung der Muslime zu Beginn der mittelalterlichen Kreuzzüge verstärkt die christlichen Vorurteile, die sich spätestens mit den türkischen Belagerungen Wiens zur Türkenfurcht verstärken und in den sog. Türkenschriften von Martin Luther ihren polemischen Ausdruck finden.
Für Luther [vgl. Soltani 2016, 126 f.] ist die spirituelle Bedrohung der Christenheit viel größer als die militärische. Die „religio turcica“ sei ein „schendlicher Glaube“, Mohammed ein „diener des teufels“ und der Koran ein „verflucht, schendlich, verzweifelt buch ...voller lugen, fabeln und aller grewel“.
Mit Beginn der Aufklärung erfahren Mohammed, Islam und Koran eine Aufwertung, an der u.a. Henry Stubbe (1632-1676) und Georg Sale (1697-1736) maßgeblichen Anteil haben [vgl. Tolan 2019, 421 ff.].
Im Jahre 1671 verfasst Henry Stubbe sein Werk An Account of the Rise and Progress of Mahometanism, and a Vindication of him and his Religion from the Calumnies of the Christians. “He was unable to publish this book, considered the first work in English sympathetic to Islamic theology; it circulated privately. He tried to demonstrate the similarity between the beliefs of Islam and Unitarian Christianity. Stubbe can also be seen as part of a growing tradition at this time which expressed a dissatisfaction with intellectual inconsistencies of trinitarianism and sought to discover the original unitarian roots of the Christian tradition in the Middle East”5.
Auf Stubbe bezieht sich später Georg Sale mit einer im Jahre 1734 in London veröffentlichten englischen Übersetzung des Korans. Nach einer 187 Seiten langen Einleitung ohne jegliche Verunglimpfung werden Mohammeds Leben, die Struktur des Korans und seine inhaltlichen Lehren sachlich dargestellt sowie ein historischer Überblick über das Entstehen und die Ausbreitung des Islam gegeben. An diesem Werk orientieren sich unter anderen Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778), Jefferson (1743-1826), Lessing (1729-1781), Goethe (1749-1832) und Napoleon (1769-1821), wobei sie den Islam nicht als Ganzes, aber einzelne Aspekte von ihm wertschätzen [Tolan 2019, 427 ff.].
Rousseau zum Beispiel urteilt, die Doppelherrschaft von Kirche und Staat kritisierend: „Mohammed hatte sehr vernünftige Absichten, er gab seinen politischen Ideen durch die Verknüpfung mit der Religion einen festen Halt. Solange die Regierung in der von ihm geschaffenen Form unter den nachfolgenden Kalifen beibehalten wurde, war sie vollkommen einheitlich, und deshalb gut“6.
Der späte Voltaire bewundert an Mohammed die Größe des Staatsmanns, Napoleon den vorbildlichen General und Eroberer [Tolan 2019, 423]. Nach Jefferson sollten Muslime in den Vereinigten Staaten unter dem Dach der Religionsfreiheit leben7. Lessing ruft in seiner Ringparabel zum religiösen Dialog auf, und Goethes Verse im West-Östlichen Divan vereinen Okzident und Orient als „romantisches Gedankenspiel zum Islam als einer spirituellen Alternative zum Katholizismus“8.
Letztlich bleibt aber die Polarisierung in Verehrer und Verächter des Islam und seines Propheten bestehen. Croitoru [2018] zeigt in seinem Werk Die Deutschen und der Orient. Faszination, Verachtung und die Widersprüche der Aufklärung, wie sich neben der Faszination am Fremden die negativen Facetten der Vorurteile am Leben erhalten [vgl. dazu auch Soltani 2016].
Der spätere westliche Kolonialismus und Imperialismus zementiert den überheblichen eurozentrischen Blick auf die heutige islamische Welt. Die westliche Welt fühlt sich gegenüber den heutigen islamischen Staaten technisch und kulturell weit überlegen. Islamische Zivilisation und Kultur gelten als rückschrittlich und infolge einer im Mittelalter steckengebliebenen Religion als nicht modernisierungsfähig (was im Detail für die einzelnen islamischen Staaten zu überprüfen wäre).
Die gegenwärtigen islamistischen Terroranschläge führen geradezu zu einer Islamophobie, die den Islam mit dem ideologischen Islamismus gleichsetzt und sich zu verfestigen scheint. Für Croitoru wirkt die heutige Verteufelung des Islam „wie eine Reminiszenz an die antiislamische Hetze vor zweieinhalb Jahrhunderten“ [Croitoru 2018, 319].
Die weit verbreiteten Vorstellungen von einer sog. deutschen Leitkultur (bayerisch, preußisch, sächsisch ...?) und einer europäischen Kultur auf (allein) römischgriechischer sowie christlich-jüdischer Grundlage verstärken diese Vorurteile. Bis heute wird in Teilen der europäischen Wissenschaftsgeschichte der Mythos einer Renaissance gepflegt, die sich als unmittelbare Fortsetzung des antikgriechischen Erbes versteht.
Verursacht wird diese Auffassung auch dadurch, dass in der Vergangenheit der arabisch-islamische Einfluss auf das lateinische Europa aus besagten wechselseitigen Animositäten vielfach ignoriert oder sogar verschleiert wurde. Viele arabische Schriften zum Beispiel zur Astronomie seien das ganze Mittelalter hindurch unter falschem Namen erschienen, oder es wurden gar antike griechische Autoren fälschlicherweise als Urheber ausgegeben. Zum Beispiel habe man bezüglich der hoch entwickelten arabischen Nautik den bedeutenden Beitrag seiner arabischen Vorgänger teils nicht wahrhaben wollen und teils absichtlich unterschlagen [Billig 2017, 22 f.].
Nach Billig [2017, 286] taucht der im 13. Jahrhundert verbreitete Antiarabismus ausgerechnet im 16. Jahrhundert wieder auf, als das Abendland seine eigene wissenschaftliche Kreativität entwickelt. „Man wollte die Vergangenheit, auf der man wissenschaftlich aufbaute, mit Macht ignorieren und kultivierte eine maßlose Polemik gegen die Araber und sogar gegen die antiken Griechen. So schrieb der Arzt und Philosoph Paracelsus (1493-141): ,Die Gedanken und Sitten der Araber oder der Griechen nachzuahmen liegt für das Vaterland keine Notwendigkeit vor, sondern es ist ein Irrtum und eine fremde Anmaßung‘“.
Dies alles mache uns blind „für die kulturelle Schuld, in der wir beim Islam stehen. Wir unterschätzen oder ignorieren Umfang und Bedeutung des islamischen Einflusses auf unser kulturelles Erbe“ [Watt 2002, 14].
Meine Intention ist es zu veranschaulichen, dass und in welchen Hinsichten der mittelalterliche arabisch sprechende islamische Kulturraum in zivilisatorischer und kultureller Hinsicht dem christlichen Abendland überlegen war und insbesondere für die wissenschaftliche Entwicklung des lateinischen Europa entscheidende Impulse gab. Doch vorab werden einige Gründe und Beispiele für die seinerzeitige kulturelle Stagnation des christlichen Abendlandes skizziert.
2. Wesentliche Ursachen für die damalige Unterentwicklung des christlichen Abendlandes
Unter dem christlichen Abendland versteht man heute im weiten Sinne die sog. westliche Welt, im engeren Sinne das westliche Europa. Den Kern des christlichen Abendlandes bilden die lateinisch sprachigen Westprovinzen des Römischen Reiches, die sich im Jahre 395 durch die Herrschaftsteilung des Kaisertums in ein oströmisches und ein weströmisches Reich zu Westrom9 konstituieren.
Während Ostrom ab der Regierungszeit des Kaisers Konstantins des Großen (306 bis 337) mit der aus dem alten Byzanz heraus neuerrichteten Hauptstadt Konstantinopel sich vom Oströmischen zum Byzantinischen Reich wandelt, zur beherrschenden Macht des östlichen Mittelmeerraumes wird und erst mit der Eroberung durch die Türken im Jahre 1453 zusammenbricht, zeigt sich die Geschichte Westroms als eine Abfolge fortdauernder Auflösungserscheinungen.
Machtkampfbedingte häufige Herrscherwechsel, Bürgerkriege, regionale Rebellionen, Einfälle germanischer Stämme, Plünderung Roms durch die Westgoten (410), Ausfall der Steuereinnahmen aus der abgefallenen reichen afrikanischen Provinz, verlustreiche Schlachten gegen die Hunnen, Ausbreitung lokaler Warlords, Verlust Hispaniens an die Westgoten - den Zerfall Westroms im Detail zu beschreiben, würde den thematischen Rahmen sprengen.
Er spiegelt sich wider im zunehmenden Bevölkerungsschwund der Stadt Rom. Ist diese um das Jahr 250 noch eine Weltmetropole mit gut einer Million Einwohnern, so reduziert sich die Einwohnerschaft um das Jahr 400 auf rund 650.000 und um 534 auf etwa 100.000. In der Folgezeit versinkt Rom zur Provinzstadt mit einer Bevölkerung von etwa 20.000.
Eine Hauptursache des kulturellen Niedergangs liegt darin, dass die gebildete, wohlhabende weströmische Elite, der wichtigste Träger der antiken Kultur, insbesondere durch die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen zugrunde gerichtet ist, während eine erhebliche Dezimierung der christlichen Elite ab dem Konzil von Nicäa (325) dadurch eintritt, dass die Gegner des Trinitätsdogmas als Ketzer verfolgt werden und sich nach Ostrom und dann in den Nahen Osten absetzen.
Die lateinische Sprachkultur steht auf schwachen Füßen; denn die schiere Primitivität, in die Europa zurückgefallen sei, habe die Elite der Eroberer davon abgehalten, Latein zu ihrer Sprache zu machen, sie sei bei ihren Umgangssprachen geblieben; sie habe großen Respekt vor dem Latein gehabt, es aber nicht beherrscht [Crone 2017, 183]. Das durchschnittliche kulturelle Niveau schildert Crone [189], unter Absehung von der kurzen Phase der ,karolingischen Renaissance’, in sicherlich etwas überzeichneter Weise sehr drastisch wie folgt:
„Außerhalb Europas schuf der Staat höchst kultivierte Eliten, die sich in allem und jedem von der Masse unterschieden; doch die ungewaschenen, wurmverseuchten, in Lumpen gekleideten, primitiv hausenden, analphabetischen oder allenfalls halbgebildeten Adligen und Kleriker, die das mittelalterliche Europa bevölkerten, waren von den Leibeigenen, über die sie herrschten, kaum zu unterscheiden. Die vornehmen moslemischen Herren fanden im 13. Jahrhundert selbst Kreuzfahrer aus den feinsten Kreisen widerwärtig ungehobelt;...“.
Der Bildungsstand der Bevölkerung ist niedrig. Die Landbevölkerung (ca. 90 Prozent) besteht aus Analphabeten. Von der städtischen Bevölkerung kann etwa ein Zehntel lesen und schreiben. Selbst viele Klosterinsassen des Mittelalters sind Analphabeten. So bemüht sich zum Beispiel Karl der Große um eine „Neuordnung der weitgehend analphabetischen fränkischen Priesterschaft.“ [Maurer 2019, 36].
Parallel zum Niedergang des weströmischen Kaisertums erstarkt die christliche Kirche. Ihre dogmatischen Streitereien beendet Kaiser Konstantin I (306-337) auf dem ersten Konzil von Nicäa (325). Unter Kaiser Theodosius I. wird im Jahre 381 das Christentum im Römischen Reich zur Staatsreligion erhoben. Der Umgang mit nichtchristlicher Philosophie und Wissenschaft wird in der Folge unterdrückt.
Die Große Bibliothek von Alexandria, „die das gesamte Wissen der Antike enthielt, wurde von den Christen verwüstet und niedergebrannt, und nicht etwa von Kalif Omar, einige Jahrhunderte später, wie es eine populäre Legende in christlichen Ländern behauptet. ...Die Wahrheit war wohlmöglich noch schlimmer als das, was die christlichen (und einzigen) Quellen darüber berichten; in den darauffolgenden Jahrzehnten wurden praktisch alle heidnischen Texte systematisch verbrannt“ [Rovelli 2019, 180].
Kaiser Justinian10 lässt im Jahre 529 die Akademie von Athen schließen und ordnet um 545 die Verfolgung nichtchristlicher Grammatiker, Rhetoren, Ärzte und Juristen an. Schriftrollen und Bücher aus der altgriechischen und hellenistischen Zeit gelten jetzt als heidnisch. Im Jahr 562 befiehlt Justinian die öffentliche Verbrennung heidnischer Bücher. Nach Daniel Sarefield (2006)11 wird die Bücherverbrennung zu einer hervorstechenden Erscheinungsform religiöser Gewalt im spätantiken römischen Reich.
Auch vom oströmischen Kaiser Valens12 (328-378) wird berichtet, dass er Besitzer von Büchern verbotenen Inhalts habe verfolgen und hinrichten lassen und dass er öffentliche Bücherverbrennungen angeordnet haben soll, insbesondere von Werken der artes liberales der klassischen antiken Wissenschaften. In den östlichen Provinzen sollen viele Buchbesitzer aus Furcht vor ähnlichem Schicksal ihre ganzen Bibliotheken vernichtet haben.
Die Bücherverluste zwischen dem späten 3. Jahrhundert und dem späten 6. Jahrhundert führen zu einem Überlieferungsverlust eines Großteils der antiken griechischen und lateinischen Literatur. Den erheblichen Bruch in der Überlieferungsgeschichte zeigt in der Übersicht eine Statistik der Bibliotheksbestände, soweit bekannt oder hochgerechnet von der Antike bis zur Neuzeit. Die europäischen Bibliotheken erreichen erst im 19. Jahrhundert wieder vergleichbar große Bestandszahlen wie die Bibliotheken der Antike.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Bibliotheksbestände von der Antike bis zur Neuzeit[13]
Der Kirchenvater Augustinus (354-430) lässt nur die Benutzung kirchlicher Schriften zu, nichtchristliches Schrifttum solle weder gelehrt noch verbreitet werden. Vie-13 le Vertreter des christlichen Klerus teilen diese negative Einstellung zum antiken Gedankengut14.
In der Folgezeit übernimmt die katholische Kirche die Kontrolle über Wissenschaft und Bildung. „Viele Jahrhunderte hindurch widersetzte sich die Kirche jedem Versuch, die griechische Naturwissenschaft neu zu beleben. Das Christentum erlaubte nur die Bibel und deren Interpretation durch die Gelehrten sowie die Schriften der Kirchenväter als Quellen der Erkenntnis. Das Studium weltlicher Dinge wurde zu einer Sache des Teufels erklärt“15.
Das rationale Denken vor allem in der Naturwissenschaft kann sich erst im Zeitalter der europäischen Aufklärung ab etwa 1700 von der kirchlichen Vormundschaft langsam befreien. Zum Beispiel wird das die heliozentrische Wende einleitende Werk von Kopernikus erst im Jahre 1835 aus der Liste der verbotenen Bücher gestrichen.
Die bisher geschilderten Begebenheiten beeinflussen die kulturelle Entwicklung des Abendlandes negativ, können aber das Feld der wissenschaftlichen Tätigkeiten nicht zerstören. Exemplarisch dafür steht die enzyklopädische Arbeit der römischen Gelehrten Martianus Capella (360-428), Boethius (480-524), Cassiodor (485-580) sowie des hispanischen Bischofs Isidor von Sevilla (560-636) und des angelsächsischen Benediktiners Beda Venerabilis (672-735). Es sprengte den thematischen Rahmen, diese und weitere Gelehrte16 im Einzelnen zu würdigen, in Kürze aber folgendes:
Martianus Capella kanonisiert im später so genannten „Lehrplan des Abendlandes“ die Sieben Freien Künste (artes liberales) mit dem Trivium (Dialektik, Grammatik, Rhetorik) und Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik). Cas- siodors Verdienst besteht in der Rettung antiken Bildungsgutes in die Kloster- und Domschulen. Boethius kommt in der Überlieferung antiker Kenntnisse eine Schlüsselrolle zu, so verfasst er u.a. Lehrbücher zu allen vier Fächern des Quadri- viums. Die „Etymologiae“ des Isidor von Sevilla repräsentieren das „bedeutsamste enzyklopädische Werk für ein ganzes Jahrtausend“ [II-15] und Beda Venerabilis als einer der größten Gelehrten des Mittelalters verfasst Abhandlungen über Grammatik, Naturwissenschaft, Geografie, Chronologie, Historiografie, Hagiografie und Theologie [ebenda, 15 f.].
Der Kanon der artes liberales überliefert dem Abendland ein geordnetes System antiken Wissens, das aber der Theologie untergeordnet bleibt. Die karolingische Schrift- und Bildungsreform fördert die Entwicklung der artes maßgeblich weiter. Die Desintegration des karolingischen Reiches und der Prozess der Feudalisierung bringen erneut einen Abstieg von Wissenschaft und Bildung. Das kulturelle und wissenschaftliche Niveau der islamischen Welt, die ab dem 8. Jahrhundert ihre Hochblüte erlebt, erreicht das lateinische Europa in Schritten erst ab dem 13. Jahrhundert. Mit Mazal [I-16] lässt sich konstatieren:
„Als im 12. Jahrhundert die schicksalhafte Begegnung des Abendlandes mit der griechischen und islamischen Wissenschaft stattfand, erfüllten der Osten, Sizilien und Spanien eine historische Mission, als ihre geistigen Schätze durch eine Flut von Übersetzungen zugänglich gemacht wurden; die Übernahme der technischen, hygienischen, wissenschaftlichen und kulturellen Errungenschaften der arabischen Welt brachten neues Leben in das erstarrte Europa.“
Dieser Prozess soll im Folgenden in großen Zügen veranschaulicht werden.
3. Grundmerkmale der zivilisatorisch-kulturellen Hochentwicklung des arabisch-islamischen Kulturraumes
Der islamische Kulturraum entwickelt ab 700 ein hohes zivilisatorisch-kulturelles Niveau. Neben den Arabern sind Kulturträger der islamischen Welten Perser, Syrer, Ägypter, Inder, Türken, Berber und Westgoten. Sie eint die arabische Sprache und die islamische Religion. Das Arabische als Sakral-, Verwaltungs- und Wissenschaftssprache sowie Sunniten- und Schiitentum als Hauptrichtungen der Religion formen eine islamische Kultur in je unterschiedlichen ethnischen Ausprägungen.
Kulturelle Zentren sind anfangs das Umayyaden-Kalifat mit der Hauptstadt Damaskus (661-750), daran anschließend das Kalifat der Abbasiden (750-1248) mit der Hauptstadt Bagdad, das Fatimiden-Kalifat mit der Hauptstadt Kairo (953-1171) sowie das Ummayaden-Kalifat auf der Iberischen Halbinsel mit der Hauptstadt Córdoba (929-1031).
Zur Zeit seiner größten Ausdehnung erstreckt sich der islamische Kulturraum von Spanien über Nordafrika und Vorderasien bis zur indischen Grenze. Sein Kern17 umfasst die Gebiete des antiken Orients, auf denen sich die ersten komplexen urbanen Strukturen der Menschheitsgeschichte vor und seit dem 4. Jahrtausend vor Christus mit ihren jeweiligen Hochkulturen entwickelt haben. Persische, hellenische, römische und weitere städtische Strukturen formen sich unter islamischer Herrschaft weiter.
Um das 9. und 10. Jahrhundert gelten die islamischen Hauptstädte als die größten der Welt. Bagdad, die Hauptstadt des Abbasiden-Kalifats, zählt rund 800.000 Einwohner; um die 500.000 Einwohner hat das andalusische Córdoba der Uma- yyaden-Kalifen, und Kairo, die Residenz der ägyptischen Fatimiden-Kalifen beherbergt rund 400.000 Menschen. Im Vergleich dazu dümpeln die Städte des lateinisch-christlichen Westens mit ein paar Zehntausenden dahin: In Rom, Mailand oder Köln wohnen etwa 30.000 bis 40.000 Menschen, in Paris und London jeweils etwa 20.000.
Die hochzivilisierte Stadtstruktur sei am Beispiel von Córdoba im damaligen al- Andalus veranschaulicht: Es heißt18, dass die Stadt im 10. Jahrhundert über 50 Hospitäler, 300 Bäder, 600 Moscheen, 80 Medresen und 70 öffentliche Bibliotheken verfügt habe. Dazu die eindrucksvolle Zentralbibliothek mit rund 500.000 Büchern. Im Zentrum lag das Stadtschloss des Kalifen (Alcázar), umgeben von Palastgärten mit Wasserspielen. Die noch heute zu besichtigende Hauptmoschee La Mezquita mit ihren 860 Marmorsäulen19, die in paralleler Aufreihung zwei übereinanderliegende Bögen tragen, hat eine Grundfläche20 von mehr als 23.000 m[2] und ist damit einer der größten Sakralbauten der Erde. Bossong21 schreibt: „Abgesandte des Kaisers erstarrten in Ehrfurcht angesichts der Pracht der Residenz. Die Bibliothek umfasste mehr Bücher, als es im übrigen Westeuropa zusammen gab. Für Deutschlands erste Dichterin, Roswitha von Gandersheim, war die Stadt »die berühmte Zierde des Erdkreises«“.
Von Spanien im Westen bis nach Indien und China im Osten, von den Wikingern im Norden bis zu afrikanischen Regionen im Süden betreiben muslimische Kaufleute ihren Warenaustausch, tragen so zum Reichtum der Kalifate bei, kommunizieren islamische Kulturelemente und verbreiten nebenbei ihre Religion recht erfolgreich. Im Rahmen des sich seit dem 7. Jahrhundert vollziehenden regen Handelsverkehrs mit China benutzt die arabisch-islamische Handelsschifffahrt den Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung. Dieser Weg wurde nicht erst von Vasco da Gama (1469-1524) entdeckt [Billig 2017, 120].
Eine besondere kulturelle Blütezeit des Islam entsteht in der ersten Phase der Abassidenherrschaft zwischen 750 und 850, die als das Goldene Zeitalter bezeichnet wird. Die Kalifen erkennen die Überlegenheit der persischen Kultur, berufen Mitglieder der persischen Familie der Barmakiden in staatliche Ämter bis zum Wesir, um die staatlichen Verwaltungsstrukturen zu stabilisieren, erbauen ihre neue Hauptstadt Bagdad nach persischem Vorbild als kreisrunde Palaststadt und gestalten ihre Hofhaltung im Stile der persischen Großkönige.
Die Eliten des alten persischen Kulturvolks gewinnen mehr und mehr Einfluss in Führungspositionen, die bislang den Arabern vorbehalten waren, und die arabischen Eliten werden sich ihrer kulturellen Unterlegenheit bewusst. Sie haben das Reich der Sassaniden unter ihrer Herrschaft in religiöser Hinsicht islamisiert und in sprachlicher Hinsicht arabisiert, aber in kultureller Hinsicht assimilieren sie sich mehr und mehr an die persische Lebensweise und Kultur.
Auch jüdische und vor allem christliche Eliten als Monophysiten, Nestorianer und Jakobiner aus dem syrischen Großraum haben aufgrund ihrer Bildung hohe Positionen in Wirtschaft und Verwaltung inne. Vor allem nestorianische Christen fungieren als Leibärzte am Kalifenhof. Der um 765 von dem Kalifen al-Mansur von der medizinischen Akademie in Gundischapur nach Bagdad gerufene Nestorianer Bohtiso22 begründet eine regelrechte Ärztedynastie über sechs Generationen23.
Unter anderem über ihre vielseitig gebildeten christlichen Hofärzte erfahren die islamischen Herrscher die Bedeutung der medizinischen Wissenschaft generell und der Wirksamkeit der Medizin Galens speziell. Über ihre diplomatischen Beziehungen mit Byzanz und dem chinesischen Kaiserhof werden sie sowohl über die Relevanz der antik-griechischen Wissenschaft und Philosophie als auch über die chinesische Kultur aufgeklärt und über ihre Handelsbeziehungen sind sie informiert über den Stand von Zivilisation und Technik in der ganzen damals bekannten Welt.
4. Die Entfaltung der arabischsprachigen Wissenschaften
Durch all diese Einflüsse entsteht bei den Mitgliedern der höheren arabischen Schichten ein Bildungshunger und der Wunsch, sich das antik-römische- griechische, persische, indische und chinesische Wissen anzueignen. Die antikgriechischen Schriften sind im zerfallenden Westrom größtenteils verloren gegangen, in Ostrom bzw. im Byzantinischen Reich, auch in den syrischen Klöstern, werden sie weiter tradiert und gepflegt. Große finanzielle Mittel werden aufgewendet, um sich alle auffindbaren wissenschaftlichen Werke im Original oder in Kopie zu beschaffen.
Die nichtarabischen Verwaltungseliten sind mit vielen dieser alten Wissenschaften schon seit längerem vertraut. Während und nach der Eroberung der persischen, syrisch-irakischen, byzantinischen und ägyptischen Räume haben die muslimischen Heere die jeweiligen Verwaltungsstrukturen mit ihren örtlichen Verwaltungsbeamten fortbestehen lassen. Altgriechisches, indisches oder chinesisches Wissen, das für die Lösung von Problemen der Verwaltungsarbeit relevant war, lag dort in Übersetzung der entsprechenden Verwaltungssprachen vor.
Für die Mitglieder dieser nichtarabischen Verwaltungselite entsteht schon früh eine neue Arbeitssituation durch die Verwaltungsreform des ummayadischen Kalifen Abd al-Malik (685-705). Anstelle des Koptischen in Ägypten, des Griechischen im Westen und des Mittelpersischen (Pahlavi) im Osten wird auf dem Wege zur sprachlichen Vereinheitlichung des Reiches und zur besseren Kontrolle der Beamtenschaft das Arabische als Verwaltungssprache durchgesetzt. Man ist gezwungen, Arabisch zu lernen und sieht sich herausgefordert, das bislang angewendete arbeitsrelevante Wissen aus Astronomie, Medizin, Mathematik usw. ins Arabische zu übersetzen.
Die arabische Funktionselite hat sich aus dem Stand der Religions- und Rechtsgelehrten (ulama) entwickelt, welche vornehmlich die religiösen Wissenschaften vorantreiben, zu denen Theologie mit Koran- und Hadithwissenschaften, Rechtswissenschaft, Historiografie und Philologie gezählt werden. Die profanen Wissenschaften dagegen (die Naturwissenschaften, Mathematik, Medizin, Geografie,
Nautik, aber auch Philosophie) werden primär von der nichtarabischen Verwaltungselite betrieben.
Die Konkurrenzsituation mit der arabischen Funktionselite motiviert die Angehörigen der nichtarabischen Schicht über die Folgegenerationen hinweg das Wissen in allen praxisrelevanten Wissenschaften in vertiefender Weise weiterzuentwickeln. Man könne nicht hoch genug einschätzen „the role played by the government bureaucrats (the kuttab and the viziers) in promoting the acquisition of the ancient sciences, by patronizing this acquisition for their own purposes of competition and advancement in their jobs” (Saliba 2011, 71). Dies sei die Hauptursache dafür, “that most of the translations, which were produced during the ninth century, were themselves patronized by bureaucrats, who were close to the center of power. Those translations were rarely patronized by the caliph himself, if they ever were. The caliph only got the best competent class of employees, but the employees sorted themselves out by their own sifting and competition” (ebenda, 64).
Im ganzen islamischen Raum beschäftigen sich Gelehrte mit der Übersetzung der erworbenen Schriften vom Griechischen oder Syrisch-Aramäischen oder Persischen, teils mit Zwischenstufen, und dies für einzelne Werke oft mehrmals, ins Arabische. Unter dem Schirm der religiösen Toleranz und auf der Grundlage der gemeinsamen Wissenschaftssprache tauschen sich christliche, jüdische und muslimische Gelehrte aus den verschiedenen multiethnischen islamischen Gebieten untereinander aus, tragen das Wissen ihrer Kulturräume zusammen und entwickeln es durch eigene Forschung weiter.
Die Errichtung von Übersetzungszentren gewinnt eine besondere Bedeutung. In Bagdad errichtet der Kalif al-Ma’mün im Jahr 825 das berühmte Haus der Weisheit (bait al-hikma). Im andalusischen Córdoba fördert Kalif Al-Hakam II. (961-976) in großem Stil Kultur und Wissenschaft und gründet eine große Bibliothek mit über 500.000 Büchern[24]. Der Fatimidenkalif Hakim gründet in Kairo im Jahr 1005 ein sog. Haus der Wissenschaft[25] (dar al-ilm), eine Art Akademie mit ebenfalls einer großen Bibliothek.
In der Regierungszeit des abassidischen Kalifen al-Ma’mün, Sohn des Kalifen Harün ar-RaschTds und einer Perserin, kulminiert die Förderung von Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Philosophie. Al-Ma’mün ist ein glühender Anhänger der Mu'tazila, einer durch die Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie sich entwickelnde rationalistische Theologie des Islam, welche Vernunft und Religion zu vereinbaren sucht, von der Erschaffenheit des Korans ausgeht, seine wortwörtliche Auslegung ablehnt und die Willensfreiheit des Menschen betont. Im Jahre 827 wird die Mu'tazila zur Staatsreligion erklärt.
„Unter al-Ma’müns Schirmherrschaft und in der von ihm geförderten Atmosphäre der Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber anderen Religionen und Kulturen zog es viele Gelehrte aus dem ganzen Reich nach Bagdad. Sie ließen sich von einem Gefühl des sprühenden Optimismus und der freien Entfaltung anlocken, in der sich beispielhaft die Stimmung dieses Goldenen Zeitalters widerspiegelte. Die Verschmelzung des griechischen Rationalismus mit der islamischen Mu'tazila führte zu einer humanistischen Bewegung, wie man sie in ähnlicher Form erst im 15. Jahrhundert in Italien wieder erleben sollte“ [Al-Khalili 2016, 54].
Dabei sind Wissenschaft und Religion eng miteinander verbunden. Zum Beispiel werden Astronomie und Mathematik gefördert, um Probleme der islamischen Glaubenspraxis zu lösen. Die islamische Zeitrechnung und der islamische Kalen- der[26] als reiner Mondkalender erfordern strikte astronomische Beobachtungen. Ramadan und die übrigen Monate beginnen von Neumond zu Neumond. Wegen der Abhängigkeit von der geografischen Länge kann das an verschiedenen Orten ein verschiedenes Datum sein. Dafür sind ergänzende standortspezifische Vorausberechnungen erforderlich. Dafür entwickeln die Wissenschaftler das astronomische Berechnungsinstrument der Griechen, den Astrolab, weiter und übersetzen die im Almagest von Ptolemäus festgelegten Sternennamen ins Arabische.
Um die islamische Gebetsrichtung (qibla) nach Mekka für den Gläubigen und für die Qibla -Wand in den Moscheen zu bestimmen, werden genaue Kenntnisse der geographischen Gegebenheiten, der Entfernungen zwischen den einzelnen Orten und ihrer Lage benötigt. Dies führt zu neuen Methoden der Landvermessung und zur Kartographie.
Bei der Einrichtung seines Wissenschaftszentrums orientiert sich al-Ma’mün an der im Jahre 271 gegründeten persischen Akademie von Gondischapur24. Diese Akademie fungiert ab dem 3. Jahrhundert als geistiger Mittelpunkt des Sassa- nidenreiches. Sie beherbergt das älteste bekannte Lehrkrankenhaus und eine Bibliothek. An ihr wird sowohl persisches als auch griechisches und indisches Wissen gepflegt. Der Herrscher Chosrau I (531-579) gibt zahlreichen griechischen Philosophen, aramäischen und nestorianischen Christen, welche vor der religiösen Verfolgung im Byzantinischen Reich fliehen, Asyl und nimmt sie in die Akademie auf.
Das Haus der Weisheit in Bagdad umfasst eine Akademie, ein Observatorium, ein Krankenhaus und eine Bibliothek, die in der Mitte des 9. Jahrhunderts zur größten Büchersammlung der Welt wird [al-Khalili, 129]. Die Leitung wird dem christlicharabischen Gelehrten, Übersetzer und Arzt Hunain ibn Ishaq übertragen25, der unter dem latinisierten Namen Johannitius bekannt wird.
Johannitius und seine Mitarbeiter sind mehrsprachig. Johannitius selbst beherrscht zum Beispiel neben dem Arabischen noch Syrisch, Persisch und Griechisch [Weiss- Adamson 2006, 358]. Die Übersetzungen verlaufen häufig zweistufig, zuerst ins Syrische und in einem zweiten Schritt ins Arabische. In diesem Zusammenhang wird auch das ins Aramäisch-Syrische übertragene antike griechische Erbe der christlichen Klöster aus Syrien ins Arabische übersetzt [Billig 2016, 188].
Übersetzt werden unter anderem Werke von Galen, Hippokrates, Platon, Aristoteles, Sokrates, Ptolemäus, Archimedes, Demokrit, von Pythagoras von Samos, Akron von Agrigent, Polybos, Diogenes von Apollonia, Mnesitheos von Athen, Xe- nokrates, Pedanios Dioskurides, Soranos von Ephesos, Archigenes, Antyllos und Rufus von Ephesos; auch indische Werke vor allem aus der Medizin und Pharma- kologie26 werden übertragen.
Die islamischen Gelehrten entwickeln diese Werke weiter und viele von ihnen benutzen dazu in methodischer Hinsicht Beobachtung und Experiment. Auf diese Weise entstehen bedeutende Beiträge zur Medizin, Astronomie, Mathematik, Philosophie, Geschichte, Botanik, Optik, Geografie, Kartografie oder Nautik.
Nach Kettermann [2001, 40] kann man drei Phasen und regionale Schwerpunkte in der Entwicklung von Literatur und Wissenschaft unterscheiden: In der ersten Phase (7.-10. Jhd.) liegt das Hauptgewicht im unteren Zweistromland mit dem Haus der Weisheit in Bagdad.
In der zweiten Phase (10.-13. Jhd.) gibt es ein westliches und ein östliches Zentrum. Das westliche Zentrum befindet sich in al-Andalus. Die umayyadischen Kalifen konkurrieren mit den Abbasiden in kultureller Hinsicht. Auch sie wenden riesige Geldsummen für die Förderung von Gelehrten und für wissenschaftliche Bücher auf, aber nicht mehr für Übersetzungszwecke, sondern für Originale und Abschriften der bereits von Bagdad aus ins Arabische übersetzten Werke. Die berühmte Bibliothek in Córdoba soll rund eine halbe Million Bücher enthalten haben, der Bibliothekskatalog soll 45 Bände zu jeweils 50 Folioseiten umfasst haben [Al Khalili 2016, 301 f.]. Das östliche Zentrum der zweiten Phase liegt in Persien, wobei insbesondere die ostpersische Provinz Chorasan den späteren Nukleus der iranischen Renaissance bildet27. In der dritten Phase (13.-15. Jhd.) erweitert sich das Wirkungsfeld auf die gesamte islamische Welt.
In diesem Zusammenhang28 listet Kettermann [32, 38, 40 ff.] 12 Dichter mit ihren Hauptwerken auf sowie 53 Wissenschaftler mit ihren Forschungsschwerpunkten auf den Gebieten der Philologie (7), Geschichtsschreibung (9), Geografie (10), Medizin/Biologie/Alchemie (8), Mathematik (5), Astronomie und Optik (7) und Philosophie (7). Al-Khalili [2016, 409 ff.] beschreibt die wissenschaftliche Arbeit von 73 christlichen, jüdischen und muslimischen Gelehrten aus dem Irak, aus Syrien, Persien, Vorderasien, Ägypten, al-Andalus und Nordafrika.
Die damaligen Wissenschaftler sind häufig Universalgelehrte, die sich mit Fragestellungen aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen befassen. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Grenzen zwischen den Disziplinen noch fließend sind, wie zum Beispiel zwischen Astronomie und Astrologie oder Mathematik, Astronomie und Geografie. Von ihnen möchte ich im Folgenden schlagwortartig und keineswegs mit dem Anspruch auf Vollständigkeit veranschaulichen, was sie zu Bereichen der Medizin, Mathematik, Astronomie, Optik, Philosophie, Geografie, Kartografie, Nautik und Geschichte beigetragen haben29.
4.1. Medizin
Die griechische Medizin übernimmt in ihrem Streben nach Verwissenschaftlichung von der ausdifferenzierten Heilkunst der Völker des Vorderen Orients primär die empirischen Teile. Die Schriften des Hippokrates (ca. 460-370 v. Chr.) umfassen naturwissenschaftliche Erklärungen der Krankheitsursachen und betonen die Bedeutung der ärztlichen Beobachtung. Darauf basierend erreicht die römische Medizin ihren Höhepunkt, aber zugleich auch Abschluss im medizinischen Werk Galens von Pergamon (ca. 129-199 n. Chr.), dessen insbesondere anatomische Untersuchungen das Bild vom Körper für die folgenden Jahrhunderte bestimmen30. Diese griechisch-römischen Quellen und weitere syrische, persische und indische medizinische Werke werden von den Gelehrten des islamischen Kulturkreises ins Arabische übersetzt. Die islamischen Gelehrten ordnen und systematisieren dieses medizinische Wissen und vertiefen es durch eigene Beobachtungen und experimentelle Untersuchungen.
Hunain ibn Ishaq (808-873)
Lat. Johannitius31. Arabisch-syrischer Gelehrter, Übersetzer und Arzt. Nestoriani- scher Christ.
Wie oben erwähnt, wird Ibn Ishaq zum ersten Leiter des Hauses der Weisheit berufen. Er übersetzt die meist syrischen, zum Teil auch alt-aramäischen Versionen der antik-griechischen Texte ins Arabische, insbesondere die Werke Galens. Es heißt, dass durch die von ihm geprägten Fachtermini die arabische Sprache erst zur Wissenschaftssprache geworden sei.
Muhammad ibn Zakariyä ar-RäzT (854-925)
Lat. Rhazes32. Persischer Arzt, Naturwissenschaftler und Philosoph.
Er übersetzt und ordnet das riesige medizinische Werk Galens. Dabei widerlegt er durch empirische Experimente einige Theorien Galens. Er entwickelt einen Lehrplan für das Studium der Medizin, der später in Europa über Jahrhunderte Gültigkeit hat. Er beschreibt eine Methode zur Leichenkonservierung, die sich mit nachträglichen Verbesserungen in Europa bis Ende des 18. Jahrhunderts halten kann. Ein Mediziner solle seiner Meinung nach auch ein guter Seelenarzt sein.
AH al-Mausili (~ 1000)
Lat. Canamusali. Syrisch-arabischer Augenarzt.
In seinem Werk Augenheilkunde (Muntahab) liefert er Operationsberichte zum Grauen Star, darunter eine Radikal-OP des weichen Stars durch Aussaugen der Linse mit einer selbst erfundenen Hohlnadel. Er wird daher als Erfinder der Injektionsnadel angesehen.
Abu l-Qasim Chalaf ibn Abbas az-Zahrawi (936-1013)
Lat. Abulcasis. Arabischer Mediziner und Chirurg aus dem andalusischen Córdoba[36].
Sein Hauptwerk At-Tasrif (Buch der [medizinischen] Methode) ist eine medizinische Enzyklopädie in 30 Bänden mit Kapiteln über Chirurgie, Medizin, Augenheilkunde, Orthopädie, Pharmakologie, Geburtshilfe, Ernährung etc. Er dokumentiert verschiedene zahnärztliche Apparate und erfindet chirurgische Instrumente zur Behandlung der Harnröhre, der Speiseröhre und des Ohrs. Er betont die Wichtigkeit einer positiven Arzt-Patienten-Beziehung und plädiert dafür, alle Patienten ohne Ansicht ihrer sozialen Herkunft zu behandeln. Gerhard von Cremona übersetzt sein Hauptwerk ins Lateinische. Gut fünf Jahrhunderte ist es die Hauptquelle mittelalterlichen medizinischen Wissens in Europa. Im Jahr 1519 wird es auch in Augsburg als Liber theoricae necnon practicae Alsaharavii gedruckt.
Ibn Sina (980-1037)
Lat. Avicenna. Der größte persisch-islamische Universalgelehrte. Vor allem seine philosophischen und medizinischen Werke verbreiten sich in Europa.
Sein berühmtestes, um 1020 verfasstes Werk[37] ist die fünfbändige medizinische Enzyklopädie Qänun at-Tibb (Kanon der Medizin), die das auf Galen beruhende medizinische Wissen seiner Zeit zusammenfasst und in fünf Hauptabschnitten behandelt: (1) Theorie der Medizin, (2) Arzneimittel und ihre Wirkungsweise, (3) Pathologie und Therapie, (4) Chirurgie und Allgemeinkrankheiten und (5) Herstellung von Heilmitteln. Unter vielem anderen werden thematisiert die Tuberkulose als ansteckende Krankheit, die chirurgische Anwendung von Anästhetika, die notwendige Frühentfernung von Krebsgewebe, die Anatomie des Auges und Augenkrankheiten, die Beziehung zwischen Körper und Gefühlen. Ibn Sina vertritt eine systematische empirische Forschung mittels Experimenten und genauer Messung.
„Avicennas Folgerung, allen medizinischen Phänomenen natürliche Ursachen zuzuschreiben, war damit der Aufklärung in Europa um 700 Jahre voraus“33. Der Kanon der Medizin wird im 12. Jahrhundert von Gerhard von Cremona ins Lateinische übersetzt und gilt als wichtiges universitäres Lehrbuch der Medizin, das im 15. und 16. Jahrhundert in 36 Auflagen erscheint [Weiss-Adamson 2006, 359]. An den Universitäten von Montpellier und Louvain findet es als Textbuch bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts Verwendung [ebenda, 357].
Ein kurzer mineralogischer Abschnitt aus Avicennas’ Buch der Heilung (kitäb as- Sifä:). auch in Toledo ins Lateinische übersetzt, findet in 130 Handschriften Verbreitung, weil er an vielen Universitäten zum Lehrstoff gehört [Hasse 2017, 388].
Ibn al-Wafid ( 997-1074)
Lat. Abenguefit. Arabischer Arzt und Apotheker aus Toledo34.
Er erstellt eine Arzneimittelsammlung35 mit der Einzeldarstellung von 454 pflanzlichen, mineralischen und animalischen Heilmitteln, einschließlich der Beschreibung ihrer Wirkungen. Sie basiert auf den Erkenntnissen von Galen und Dioskurides, ergänzt um eigene Erfahrungen. Unter dem Titel Liber aggregatus medicinis simplicibus wird es im Jahr 1290 von Simon von Genua36 ins Lateinische übersetzt und erfährt bis gegen Ende des Mittelalters mehrere Auflagen. Seine Inhalte gehen mit ein in Arzneibücher aus dem 15. Jahrhundert, wie z. B. die „Leipziger Drogenkunde“ oder der „Herbarius“.
Ibn Abi Usaibia (1203-1270)
Syrisch-arabischer Arzt37.
Er verfasst eine Art Universalgeschichte der Medizin unter Einschluss von 380 Biographien bedeutsamer Ärzte und Wissenschaftler, darunter Griechen, Araber, Perser und Inder.
Ibn an-Nafs (1213-1288)
Syrisch-arabischer Universalgelehrter und Arzt38.
Er arbeitet an einem Gesamtwerk der Medizin (As-Shamil fi at-Tibb). Dreißig Bände sind bis zu seinem Tod fertiggestellt, von denen nur ein kleiner Teil erhalten geblieben ist. In der islamischen Medizin ersetzt das Werk den Canon des Avi- cenna39. Er liefert als erster eine theoretische Erklärung für den kleinen Blutkreislauf bzw. Lungenkreislauf und nimmt damit zum Teil die Entdeckung des Blutkreislaufs durch den englischen Arzt William Harvey im 17. Jahrhundert vorweg. Er erkennt die Bedeutung der Koronargefäße für die Versorgung des Herzens.
Krankenhäuser40
Letztendlich sind die hervorragend ausgestatteten Krankenhäuser des damaligen islamischen Kulturraumes zu nennen, die zumeist von religiösen Stiftungen (waqf) gegründet und unterhalten werden. Nach Geschlechtern getrennt haben sie Fachabteilungen für Geistes-, Infektions-, und Augenkrankheiten sowie für chirurgische und nicht-chirurgische Fälle. Die Stiftungsstatuten legen oft fest, dass niemand abzuweisen sei und bis zu seiner völligen Genesung zu bleiben habe.
Die Krankenhäuser dienen ebenfalls als Ausbildungsstätte für Ärzte. Die systematische Verwendung von Krankenakten spielt dabei eine große Rolle. Seit der Ab- basidenzeit ist eine Prüfung und förmliche Zulassung Voraussetzung für die Ausübung des Arztberufs.
4.2. Mathematik, Astronomie, Optik
Yaqüb ibn Tariq (*?-796)
Persischer Astronom und Mathematiker.
Er übersetzt im Auftrag des Kalifen al-Mansur um 770 zusammen mit Muhammad al-Fazari die indische astronomische Textsammlung Brähmasphufasiddhänta aus dem Sanskrit ins Arabische. Dies gilt als Anfang der mathematischwissenschaftlichen Astronomie im arabisch-islamischen Kulturraum [Billig 2017, 47 f.]. Er benutzt persische Begriffe und Methoden zur Berechnung von Planetenpositionen oder Sonnenstand und indische Verfahren zur Berechnung der Mondsichel. Den Erdradius berechnet er mit 6.360 km (heute: 6.371 km) [ebenda, 48].
Abu Dscha ‘far Muhammad ibn Musa al-Chwärizmä (~780-850) Kurzform: al-Chwarizmi. Lat. Algorismi. Persischer Mathematiker.
Im Haus der Weisheit arbeitet er zwischen 813 und 833. Er gilt bis heute als einer der bedeutendsten Mathematiker. Er dokumentiert das indische Wissen über astronomische Kalenderberechnungen. Seine trigonometrischen Berechnungstabellen beeinflussen die abendländische Mathematik. Die Begriffe Algebra und Algorithmus gehen auf ihn zurück.
Mit seinem im Jahre 820 erschienenen Werk Über das Rechnen mit indischen Ziffern führt er die Arbeit mit Dezimalzahlen und mit der Ziffer 0 in den arabischen Kulturkreis41 ein. Durch die im 12. Jahrhundert von Robert von Chester durchgeführte lateinische Übersetzung werden die sog. arabischen Ziffern in Europa bekannt. Aber noch bis ins 16. Jahrhundert rechnet man in Europa mit römischen Ziffern, weil die meisten Gelehrtentexte in lateinischer Sprache verfasst sind42.
Al-Chwarizmi entwickelt in seinem Werk Ein kurzgefasstes Buch über die Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen in Anlehnung an babylonische, chinesische und indische Vorarbeiten Lösungsverfahren für quadratische Gleichungen und schafft damit auf Wunsch des Kalifen al-Ma’mum eines der ersten arabischen Lehrbücher, in dem die Grundzüge der Algebra einfach und mit praktischen Anwendungen dargestellt werden. Da die Algebra der Araber damals noch keine symbolische Mathematik kennt, werden die Rechenoperationen in Worten ausgedrückt und geometrisch begründet und veranschaulicht43.
Ein Auszug aus dem Vorwort des Autors zeigt, dass man von der Mathematik die Lösung praktischer Alltagsprobleme erwartet, was generell für die bevorzugten profanen Wissenschaften gilt44:
„Im Namen Allahs dem Gnädigen und Barmherzigen: (...) Die Vorliebe für die Wissenschaft, für welche Allah den Imam al-Ma’mum berühmt gemacht hat (...), die Freundlichkeit, welche er gegenüber den Gelehrten zeigt, die Bereitschaft, mit welcher er sie bei der Aufklärung von Unbekanntem und dem Beseitigen von Schwierigkeiten beschützt und unterstützt - hat mich ermutigt ein kurzes Werk über das Rechnen mit den Regeln des Ergänzens und Ausgleichens zu verfassen, beschränkt auf das Einfachste und Nützlichste in der Mathematik, was die Menschen fortwährend benötigen bei ihren Erbschaften, Vermächtnissen, Teilungen, Gerichtsprozessen und im Handel, und in ihrem Umgang miteinander, oder bei der Landvermessung, beim Graben von Kanälen, geometrischen Rechnungen, und anderen Dingen verschiedener Art - vertrauend auf die Güte meiner Absicht, und hoffend, dass die Gelehrten es belohnen werden, so dass ich durch ihre Gebete die Vortrefflichkeit des göttlichen Dankes erlange: als Belohnung dafür mögen die auserlesenen Segnungen und der reichliche Großmut Allahs ihnen zugute kommen!“
Al-Haddschädsch ibn Yusuf ibn Matar (~786 und 833)
Arabischer Mathematiker45.
Von ihm stammt die früheste Übersetzung der Elemente des Euklid vom Griechischen ins Arabische, die Adelard von Bath im 12. Jahrhundert als Grundlage nimmt für seine Übersetzung ins Lateinische. Von ihm stammt auch die erste erhaltene arabische Übersetzung46 eines der Hauptwerke der antiken Astronomie, nämlich des Almagest von dem hellenistisch-griechischen Gelehrten Claudius Ptolemäus (um 100-160). Gerhard von Cremona übersetzt den Almagest im 12. Jahrhundert vom Arabischen ins Lateinische.
Täbit ibn Qurra (826-901)
Lat.: Thebit; ein syrisch-arabischer Universalgelehrter.
Er verallgemeinert den Satz des Pythagoras für jedes beliebige Dreieck; das entsprechende Theorem [Sezgin 2003, 16] dagegen trägt im eurozentrischen Abendland den Namen von John Wallis (1616-1703). Thebit ist maßgeblich an der Entwicklung der islamischen Astronomie beteiligt, insbesondere an der Mathematisie- rung von Theorie und Auswertung der Beobachtungen. Kopernikus übernimmt den Wert des siderischen Jahres von 365 Tagen 6 Stunden 9 Minuten und 12 Sekunden (Abweichung 2 Sek.) aus ibn Qurras Werk Über das Sonnenjahr47 .
Mohammed ibn Dschäbir al-Battäni (~858-929)
Lat. Albatanius48. Arabischer Astronom und Mathematiker.
Er vermittelt die Grundlagen der indischen Mathematik, der Geometrie und Algebra, die, von den Arabern weiterentwickelt, später nach Europa gelangen. Im Rahmen der Trigonometrie findet und beweist er als erster den Sinussatz und dass das Verhältnis von Sinus durch Cosinus dem Tangens entspricht. Die Länge des Sonnenjahrs berechnet er bis auf rund zwei Minuten genau mit 365 Tagen, 5 Stunden, 46 Minuten und 24 Sekunden. Die Bewegung der Planeten berechnet er ebenfalls genau. Seine astronomischen Tafeln werden unter dem Titel Scien- tia Stellarum erstmals im Jahr 1537 in Nürnberg gedruckt.
“Copernicus49 quoted him in the book that initiated the Copernican Revolution, the De Revolutionibus Orbium Coelestium, where his name is mentioned no fewer than 23 times, and also mentioned in the Commentariolus. Al-BattänT was frequently quoted by Tycho Brahe, Riccioli, among others. Kepler and Galileo showed interest in some of his observations, and his data continues to be used in geo physics.”
Abu Ali al-Hasan ibn al-Haitham (~965-1039)
Lat. Alhazen. Arabischer Mathematiker, Optiker und Astronom50.
Al Haitham könne mit seinen optischen Versuchen - 600 Jahre vor Galilei und Kepler - als der erste wirkliche Experimentalphysiker in der Geschichte angesehen werden. Er wendet als erster die induktiv-experimentelle Methode systematisch an. Dabei sind von größter Bedeutung seine optischen Experimente. Durch Analyse des Augenaufbaus erkennt er die Bedeutung der Augenlinse und widerlegt experimentell die Sehstrahlentheorie von Euklid und Ptolemäus. Er erweitert Ptolemäus' Theorien zur Lichtbrechung sowie Lichtreflexion, erkennt die Eignung gewölbter Glasoberflächen zur optischen Vergrößerung und kann als Erfinder der Lupe gelten. Noch heute ist sein Name mit einem Problem in der Optik verbunden, dem sog. Alhazenschen Problem, wobei es um die Berechnung eines bestimmten Punktes auf einem sphärischen Spiegel geht. Er erkennt den scheinbar größeren Durchmesser des Mondes in Horizontnähe als eine Wahrnehmungstäuschung (Mondtäuschung). Auch berechnet er die Höhe der Atmosphäre aus der Beobachtung von Sonnenuntergängen. Er gehört auch zu den Wegbereitern der Infinitesimalrechnung [Sezgin 2003, 27].
Al-Birüni (973-1048)
Persischer Mathematiker51, Astronom, Kartograf, Pharmakologe.
Im Magazin Spektrum Spezial vom 01.05.2001 veröffentlicht Gotthard Strohmaier über ihn einen wissenschaftsgeschichtlichen Beitrag unter dem Titel „Al-Biruni - Ein Gelehrter, den das Abendland übersah. In der Blütezeit der Wissenschaft im mittelalterlichen Orient gelangte der Universalgelehrte al-Biruni zu Erkenntnissen, die vergleichbaren Entwicklungen im Abendland um Jahrhunderte vorangingen52 “.
Sein astronomisches Handbuch al-Qanun al-Mas‘üdT ist der erste Versuch einer Kodifizierung des astronomischen Wissens der Zeit nach Ptolemäus. Bedeutsam darin sind seine Lehren zur Trigonometrie. Er erkennt erstmals die Irrationalität der Zahl Pi (n). Mit einem von ihm erfundenen neuen Messverfahren ermittelt er den Radius der Erdkugel mit 6339,6 km, was dem realen heutigen Wert am Äquator von 6378,1 Kilometer recht nahe kommt. Er konstruiert das erste Pyknometer, mit dem er die Dichte (das spezifische Gewicht) von unterschiedlichen Materialien berechnen kann. Von ihm stammt auch das bedeutendste Werk der arabischen Gesteinskunde. Weiterhin verfasst er ein Grundwerk der mathematischen Geografie und eine umfassende Monographie über Indien. Ein Fünftel seiner etwa 146 Bücher zu den verschiedensten Gebieten sind erhalten.
az-Zarqäli (1029-1087)
Lat. Arzachel. Arabisch-andalusischer Mathematiker und Astronom.
Er konstruierte unter anderem ein flaches Astrolabium, das an jedem Breitengrad genutzt werden konnte, und eine Wasseruhr, die Tages- und Nachtstunden und den Tag des Mondmonats anzeigen konnte53. Auf die von ihm bei der Aufstellung seiner Sonnentheorie verwendeten Tafeln habe vier Jahrhunderte später noch Kopernikus in seinem Werk De revolutionibus orbium coelestium zurückgegriffen [ebenda und Sezgin 2003, 34].
Nasir ad-DTn al-TüsT (1201-1274)
Persischer Universalgelehrter und schiitischer Theologe. Aufgrund seiner herausragenden wissenschaftlichen Werke wird er auch als „der dritte Meister“ nach Aristoteles und al-FäräbT tituliert54.
Als der mongolische Khan Hülägü, Enkel des Dschingis Khan, im Jahre 1258 mit der Eroberung Bagdads das Abassidenreich vernichtet, habe er im Rahmen der Stadtverwüstung „die Bibliothek des Hauses der Weisheit in den Tigris gewor- fen“55. Dies sei nach Saliba [2011, 243] eine Legende; denn des Khans Wesir „at the same time was NasTr ad-DTn al-TüsT, the astronomer he had captured in the conquest of the ismai'lis fortress of Alamut. It was this the same TüsT who had enough wisdom to save about 400.000 manuskripts before the sack of Baghdad.” Unter anderem auf der Basis dieser Manuskripte habe TüsT den Sohn des Khan Hülägü überreden können, „to grant him enough support in order to establish one of the most elaborate observatories the Islamic world had ever known” [ebenda]. Diese Sternwarte wird zwischen 1259 und 1263 auf einem Hügel von Maragha, der Hauptstadt des westlichen Mongolenreiches, errichtet.
Noch während seiner Forschungstätigkeit in Alamut entwickelt und begründet TüsT im Jahre 1247, und vertiefter wiederholend um 1260, ein mathematisches Theorem, das in die astronomische Fachliteratur als TüsT Couple Eingang gefunden hat. Es löst die zwei Hauptprobleme des Ptolemäus zugleich: „first it allowed for the oscillating motion as a result of complete circular motions, and second it avoided the necessary wobbing that was required by the Ptolemaic suggestion (Saliba 2011, 181]. Mit seinem Buch asch-Schakl al-Qattä‘ begründet al TüsT die Trigonometrie als mathematische Disziplin [Sezgin 2003, 42].
Mu’ayyad al-DTn al-Urdi(1200-1266)
Syrisch-arabischer Astronom.
UrdT’s bedeutendste Leistungen sind eine Abhandlung über astronomische Beobachtungsinstrumente (Risälat al-Rasd) sowie ein Werk über theoretische Astronomie (Kitäb al-Hay’a). Im Jahre 1259 folgt er einem Ruf von al-TüsT und konstruiert für das Maragha-Observatorium eine Reihe von Beobachtungsinstrumenten.
Ibn al-Shatir (1304-1375)
Syrisch-arabischer Mathematiker und Astronom56.
In der Tradition der Maragha-Schule stehend verbessert er das System von Pto- lemäus, indem er die Notwendigkeit eines Äquanten auflöst und einen zusätzlichen Epizykel einführt. 1371/1372 konstruiert er eine große Sonnenuhr für die Umayyaden-Moschee in Damaskus. Auch führt er die Einteilung des Tages in über das ganze Jahr gleiche Stunden ein.
Khafri (~1470-~1525)
Persisch-schiitischer Astronom und Religionsgelehrter57.
Im Gefolge von al-Urdï und al-TûsT präsentiert er verbesserte mathematische Modelle für die Bewegungen von Mond, den äußeren Planeten und Merkur. „Khafrï employed all of the techniques and theoretical mechanisms devised in the Islamic tradition of mathematical astronomy (the Tûsï Couple, epicyclets, etc.) and, in each case, the result was a physically consistent model”58.
Al-Käsi (~1380-1429)
Auch al-Kaschi. Persisch-arabischer Mathematiker, Astronom und Arzt.
Bei der Kreisberechnung kommt er für die Zahl Pi auf siebzehn Stellen. Er entwickelt Berechnungsmethoden für die Volumina krummlinig begrenzter Körper, schiefer Zylinder und Kegel, Spitzbögen, Gewölbe und Kuppeln [Sezgin 2003, 67]. In Frankreich wird der Kosinussatz als Théorème d’Al-Kashi bezeichnet59.
Sternwarten
Hervorzuheben bleibt noch die mit enormem finanziellem Aufwand betriebene Großforschung an Sternwarten mit Hilfe der erarbeiteten astronomischen und mathematischen Erkenntnisse sowie präziser Beobachtungsinstrumente. Die ersten beiden Sternwarten lässt Kalif al-Ma’mun in Bagdad und nördlich von Damaskus errichten. Danach entstehen Sternwarten in Ray, Maragha, Kairo, Isfahan, Yazd, Täbris, Nischapur, Samarkand sowie im indischen Mogulreich in Jaipur, Delhi, Mathura, Varanasi und Ujjain [Billig 2017, 64 ff.]. Viele dieser originalen oder nachgebauten astronomischen Instrumente sind im Museum des Instituts für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften in Frankfurt/M. zu besichtigen.
4.3. Philosophie, Geschichte
Die griechische Philosophie wird von den muslimischen Gelehrten zum einen im Rahmen der religiösen Wissenschaften in der Gestalt des rational-dialektischen Streitgesprächs (kaläm) verarbeitet, zum anderen im Rahmen der profanen Wissenschaften aufgenommen, weiterentwickelt und mit der aus dem Griechischen abgeleiteteten Bezeichnung falsafa belegt60.
Al-Kindi (~800-873)
Lat. Alkindus. Arabischer Universalgelehrter61 aus Kufa.
Seine zumeist persischen Kollegen nennen ihn Philosoph der Araber. Aufgrund seiner Wohlhabenheit beschäftigt er in Bagdad viele Übersetzer. Er lässt zahlreiche antik-griechische Schriften ins Arabische übersetzen, u.a. von Aristoteles, Platon, Alexander von Aphrodisias oder Johannes Philoponos. Vor allem Aristoteles' naturphilosophische Schriften werden von ihm rezipiert. Ein Hauptanliegen von ihm ist, die verschiedenen profanen Wissenschaften durch eine philosophische Gesamtkonzeption zu vertiefen [Perkams 2017, 34]. Seine eigenen zwei Hauptwerke heißen Über die Erste Philosophie und Über den Intellekt. Letzteres Werk wird über Jahrhunderte von arabischen und lateinischen Intellektuellen breit rezipiert.
Al-Farabi (872-950)
Lat.: Alpharabius; aus dem heutigen Kasachstan stammender islamischer Gelehrter62.
In der Wissenschaftsgeschichte des Islam bezeichnet man ihn als Zweiten Lehrer nach Aristoteles und als Mitbegründer einer sich von der Theologie emanzipierten islamischen Philosophie. Er entwirft eine Theorie menschlichen Nachdenkens, in der dem rationalen Denken der höchste Rang zukommt und plädiert für eine allegorische Interpretation des Korans. Weiterhin gilt er als größter Theoretiker der arabisch-persischen Musikgeschichte.
Ṣāʿid Ibn-Aḥmad al-Andalusī (1029-1070)
Andalusischer Historiker63, Mathematiker und späterer Richter in Toledo.
Eines seiner Hauptwerke ist eine im Jahre 1068 in Toledo zum Abschluss gebrachte Geschichte der Wissenschaften bei einzelnen Völkern (Kitab tabakat al- umam). Er beschreibt die wissenschaftlichen Leistungen der Inder, Perser, Chaldäer, Griechen, Römer, Ägypter, Juden und schließlich der Araber einerseits im arabischen Orient, andererseits im arabischen al-Andalus [Ricklin 2006, 47]. „He includes the names of many individual scientists and scholars and describes their various contributions to knowledge, making his book a significant work of reference as well as history“64.
Ibn Ruschd (1126-1198)
Lat. Averroes65. Arabischer Universalgelehrter und Philosoph aus dem andalusischen Córdoba.
Er fungiert als Hofarzt der Almohaden-Kalifen in Marokko und als Richter in Córdoba. Er verfasst Bücher66 über Philosopie (28), Medizin (20), Mathematik, Physik (3), Astronomie, islamische Theologie und Jurisprudenz (13). Als Rationalist begründet er die Vereinbarkeit von Vernunft und Religion. Vernunftbegabte sollten daher den Koran nicht wörtlich, sondern allegorisch auslegen67. Für ihn ist Aristoteles die größte menschliche Autorität. Daher verfasst er zu jeder der aristotelischen Schriften scharfsinnige Kommentare, und zwar in dreifacher, jeweils unterschiedlicher Ausfertigung, je nach Ausbildungsstand des adressierten Personenkreises [Markowski 2006, 655].
„Averroes‘ Kommentare zu aristotelischen Werken, besonders die Großen Kommentare zu De anima, Physik, De caelo und Metaphysik, hatten einen enormen Einfluss auf die mittelalterliche Universitätskultur des 13. bis 16. Jahrhunderts. Als das aristotelische Corpus im Jahr 1255 verpflichtende Lektüre für die Pariser Studenten der Artistenfakultät wird - das Startsignal für den Aristotelismus an den europäischen Universitäten - avancieren auch Averroes’ Kommentare zur universitären Sekundärliteratur schlechthin“ [Hasse 2017, 392]. Darüber hinaus wird er auch als eigenständiger Philosoph gelesen und zitiert.
Er verteidigt die aristotelische Philosophie gegenüber den islamischen Theologen Ash'ari und al-Ghazali. Er beeinflusst massiv die christliche Scholastik (Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Johannes Duns Scotus). Sein Denken wirkt in der lateinischen Gelehrtenwelt über die Renaissance bis in die Neuzeit fort.
Moses Maimonides (~1135-1204)
Arab.: Musa bin Maimun. Jüdischer Universalgelehrter68 aus dem andalusischen Córdoba.
Vor dem intoleranten Islam der Almohaden flieht die Familie zuletzt nach Ägypten. Dort wird Maimonides im Jahr 1185 Leibarzt am Hofe Saladins in Kairo. Er gilt als einer der bedeutendsten jüdischen Theologen und Religionsphilosophen aller Zeiten. Er versucht eine Verbindung zwischen jüdischer Religion und aristotelischer sowie auch neuplatonischer Philosophie herzustellen und beeinflusst europäische Denker bis ins 19. und 20. Jahrhundert. Er verfasst zehn medizinische Abhandlungen in arabischer Sprache. Dabei bekämpft er den Gebrauch von Beschwörungen und Amuletten und betont den rationalen Charakter der Medizin.
Ibn Haldün (1332-1406)
Auch Ibn Chaldün. Arabischer Universalgelehrter und Staatsmann aus Tunis.
Er gilt als Vorläufer einer soziologischen Denkweise. Sein mehrbändiges Hauptwerk, der Kitäb al-'ibar (Buch der Beispiele), ist eine Universalgeschichte. Es „enthält eine geniale ,Einführung‘ (Muqaddima), die bis heute seinen Rang als Denker begründet. Darin versucht Ibn Khaldun die Ursachen und Bedingungen für den Aufstieg und Niedergang von Zivilisationen ausfindig zu machen, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen“69. Darüber hinaus gilt diese Muqaddima als erste „auf Tatsachen basierende Analyse der islamischen Geschichte“70
4.4. Geografie, Kartografie, Nautik
Schon im frühen 9. Jahrhundert beauftragt Kalif al-Mamum eine Gelehrtengruppe mit der Entwicklung einer neuen Geografie und Weltkarte.
Eine deskriptive Geografie [Billig 2017, 158 ff.] hat ihre Wurzeln im regen Handel und Verkehr der islamischen Welt mit Indien und China seit dem 7. Jahrhundert. Lange vor Marco Polo im 13. Jahrhundert beschreibt TamTm ibn Bahr al- Mutawwi’T eine Reise auf dem Landweg nach China zwischen 821 und 824. Die älteste erhaltene arabische Ländergeografie stammt aus dem 9. Jahrhundert von Ibn Churdädhbih .
Unter anderem von den persisch-islamischen Universalgelehrten Abu Zaid al- BalchT (~ 850-934) und al-Istahri (? - 957) sowie den arabischen Gelehrten al- MuqaddasT (945-nach 1000) und Ibn Hauqal (?-977) entstehen geografische Werke zu einer „Anthropogeographie, wie sie in Europa erst im neunzehnten Jahrhundert anzutreffen ist“ [Sezgin 2003, 23].
Schon Jahrhunderte vor den Europäern können arabischsprachige Gelehrte Längen- und Breitengrade verlässlich ermitteln und exakte Karten zeichnen.
In ihrem Buch Die Karte des Piri Re’is. Das vergessene Wissen der Araber und die Entdeckung Amerikas aus dem Jahre 2017 beschreibt Susanne Billig unter anderem die im Mittelalter hochentwickelte arabischsprachige mathematische Geografie, Kartografie und Nautik aufgrund der Forschungsergebnisse von Fuat Sezgin, dem Gründer des Instituts für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften in Frankfurt/M.
Sezgins Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es vor Kolumbus mindestens eine erfolgreiche Amerika-Expedition der Araber gegeben haben müsse; denn Kolumbus sei mit einer Atlantikkarte aufgebrochen, auf der bereits etliche amerikanische Küstenverläufe und mittelamerikanische Inseln eingezeichnet gewesen seien, und diese Karte müsse mit einem Gradnetz versehen gewesen sein, wie es damals nur arabische Gelehrte hätten erstellen können. Kolumbus habe auch Kompasse verwendet, wie sie die arabischen Nautiker im Indischen Ozean entwickelt hätten.
5. Die Verbreitung und Vermittlung der arabischsprachigen Wissenschaften im lateinischen Europa
In den im Gefolge der Völkerwanderung noch labilen neuen Staaten des Abendlandes ist die Kirche die überstaatliche und überregionale kulturbewahrende Macht. Über ihre Klöster und Domschulen tradiert sie die gehobene Bildung auf der Grundlage der lateinischen Sprache. Um ihre Botschaft den gebildeten Kreisen in der philosophischen Begriffssprache ihrer Zeit nahezubringen und im geistigen Kampf gegen Heidentum und Häresien gewappnet zu sein, öffnet sie sich bald für die Schriften der Antike.
Im Islam, der Trinität und Christologie ablehnt und in Europa bis nach Spanien vorgedrungen ist, sieht sie die größte häretische Bedrohung. Um dem zu begegnen, öffnet sie sich schließlich über Theologie und Philosophie hinaus für die Anwendung des Rationalitätsprinzips im Sinne der antik-griechischen Philosophie und Wissenschaft für alle Disziplinen im überlieferten Kanon der sieben freien Künste.
Aus Reiseberichten und Studien von Gelehrten, die aus den Kalifaten zurückkommen, aus Erfahrungsberichten von Teilnehmern an den ab 1095 einsetzenden Kreuzzügen in die Levante und aus der Art des Warenaustausches zwischen Orient und Okzident erfahren die Abendländer ihre kulturelle Unterlegenheit und es erwacht ein großes Interesse daran, die arabischsprachige Wissenschaft kennenzulernen bzw. wie Gutas [2006, 18] es ausdrückt: ...“in the case of the Arabic-Latin transmission, Latin Europe was manifestly inferior to Islam in intellectual, economic, and military terms, and thus this transmission can be ascribed to the natural tendency, on the part of the Latin world, to follow the path of and imitate the higher civilization - in essence, become the other civilization and acquire for itself the glory and prestige that belonged to the Arabs and Islam in general.”
Schon gegen Ende des 10. Jahrhunderts reisen europäische Gelehrte zu Studienzwecken in die islamischen Staaten. Mit den christlichen Eroberungen Toledos (1085), Siziliens (1091) und der muslimischen Levante mit Jerusalem (1091) öffnen sich Gebiete mit langjähriger Vielsprachigkeit und bieten ideale Bedingungen für die Übersetzung arabischsprachiger Schriften.
Spätestens seit der fortschreitenden Reconquista der nördlichen Königreiche Spaniens ist das in wirtschaftlicher und kulturell-wissenschaftlicher Hochblüte stehende cordobesische Kalifat von al-Andalus im Blickpunkt des christlichen Abendlandes. Das ins Arabische übersetzte antike Wissen befindet sich in al-Andalus, und es ist im wortwörtlich-geografischen Sinne naheliegend, dass hier dasjenige seinen Schwerpunkt findet, was Hasse [2006, 68] die „Arabic- (Hebrew-)Latin Translation Movements in Medieval Spain“ bezeichnet.
Die maurisch-christlichen Grenzen sind durchlässig, verschieben sich ständig und die Convivencia zwischen Mauren, Christen und Juden ist Grundlage für permanente kulturelle Austauschbeziehungen. Von daher ist es erstaunlich, dass keine einzige Übersetzung auf dem jeweils von Mauren beherrschten Gebiet stattfindet und kein muslimischer Gelehrter aus al-Andalus am Übersetzungsprojekt mitwirkt. „In sum, one can say: the translation movement in Spain was not a matter of direct cultural contact, but rather of the appropriation of a cultural heritage after the conquest of a country” [Hasse 2006, 72].
Zunächst sind es Übersetzungsinitiativen einzelner Gelehrter und Klöster. Danach entstehen regelrechte Übersetzungsbewegungen [Hasse 2006], und zwar eine spanische Phase sowie eine Renaissance-Phase (1450-1700).
5.1. Die Übersetzungstätigkeit einzelner Gelehrter und Klöster
Gelehrte
Was für diese, aber auch für die anderen Phasen ins Auge fällt, ist die Tatsache, in welchem Ausmaß Gelehrte in der mittelalterlichen Welt Studienreisen quer durch die Staatengefüge unternehmen, und dies bei den damals äußerst anstrengenden Reisebedingungen.
Gerbert von Aurillac (~950-1003)
Aquitanischer Mathematiker und Astronom, Kleriker und späterer Papst Sylvester II.
Als Folge eines Studienaufenthalts in al-Andalus wird ihm in der Literatur die Einführung der arabischen Zahlenschrift zugeschrieben. Dies sei aber eine Legen- de71 ; denn erst im 12. Jahrhundert seien die Übersetzungen des Rechenbuches von Al-Chwarizmi erfolgt. Er soll aber Anteil an der Einführung einer mittelalterlichen Sonderform des Abakus mit bezifferten Rechenmarken gehabt haben.
Adelard von Bath (1080-1152)
Englischer Universalgelehrter72.
Nach Studien in Tours und Lehrtätigkeit in Laon verbringt er sieben Jahre in Sizilien, ist auch in Salerno, reist nach Kleinasien und Spanien und kehrt dann nach England zurück. Er übersetzt zahlreiche arabischsprachige und griechische Werke aus den Gebieten der Astrologie, Astronomie, Mathematik und Philosophie ins Lateinische. Von ihm stammt die erste vollständige Übersetzung von Euklids Elementen aus dem Arabischen, ebenso von al-Chwarizmis astronomischem Werk ZTj al-Sindhind, bei dem es sich um astronomische Tafeln handelt. In seinen Quaestiones naturales reflektiert er „auf subtile Weise das Spannungsverhältnis zwischen den traditionellen Gallicae sententiae und den neuen Arabica studia, wobei er allein die Vernunft als Richtmaß akzeptiert“ [Speer 2006, XVIII].
Constantinus Africanus (~1015 - ~1087)
Nordafrikanischer medizinischer Gelehrter aus Kairouan73.
Er verbringt 39 Jahre im Vorderen Orient und studiert in Bagdad Sprache, Medizin und weitere Wissenschaften. Er macht Geschäfte mit medizinischen Kräutern und Arzneidrogen und soll während seiner mesopotamischen Zeit mit seinen Handelspartnern bis in deren Heimatländer nach Indien, Äthiopien und Ägypten gekommen sein. Um 1077 wird er Lehrer an der damals berühmten medizinischen Schule von Salerno, für die er zu Lehrzwecken eine umfangreiche griechischarabische Fachliteratur zusammenstellt. An seinem letzten Schaffensort in Monte- cassino, dem Mutterkloster der Benediktiner, entsteht ein umfassendes Übersetzungswerk aus arabischen, persischen und jüdischen Quellen, das sich bis zum 17. Jahrhundert in Gestalt von Lehrbüchern nachweisen lässt. Constantinus zählt zu denjenigen Übersetzern, welche die arabische Herkunft der übersetzten Schriften verbergen, den Autor nicht nennen, den Titel oft verändern und dem übersetzten Werk durch die Verwendung griechischer Lehnwörter einen gräzisierenden Eindruck verleihen [Hasse 2017, 379].
Zu diesem Problem bemerkt Burnett [2006, 22]: „It is noticeable that translators from Arabic into Latin in the Middle Ages tend to adopt one of two different approaches: either they parade the Arabic origin of their translations, or they attempt to disguise that origin”. Als beispielhaften Übersetzer der ersten Position nennt er Adelard von Bath, der dem Leser die Bedeutung der arabischen Fachbegriffe erläutert und sogar eine Liste arabischer Fachbegriffe zusammenstellt [ebenda, 27 f.].
Klöster
Im 10. Jahrhundert übersetzen Mönche im katalanischen Kloster Santa Maria de Ripoll arabische Schriften ins Lateinische. Der Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau , Hermannus Contractus (1013-1054) verfasst anhand der arabischen Schriften aus Ripoll einen Traktat über das Astrolabium [Crespi 1992, 307].
Zu erwähnen ist, dass im Kloster Mont Saint-Michel nach Gouguenheim [2011, 85 ff.] in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts Werke des Aristoteles und anderer griechischer Gelehrter direkt aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt worden seien.
5.2. Die spanische Phase der Übersetzungsbewegung
Hier lässt sich eine vortoledanische von einer toledanischen Phase unterscheiden.
5.2.1. Die vortoledanische Phase
Zur vortoledanischen Phase zählt Hasse [2006, 70] zum Beispiel die Gelehrten Robert of Chester, Robert of Ketton, Hugo of Santalla, Petrus Toletanus, Hermann of Carinthia und Plato of Tivoli. Von ihnen sind insgesamt rund 31 Übersetzungswerke dokumentiert.
Robert von Chester
Englischer Arabist und Mathematiker74.
Er wirkt um 1140 im spanischen Segovia. Dort übersetzt er mathematische Texte der Araber ins Lateinische, darunter die Algebra von Al-Khwarizmi (1145) und verschiedene Euklid-Kommentare. Später kehrt er nach England zurück.
Robert von Ketton
Ein englischer Theologe, Astronom und Arabist75.
Er erfährt seine Ausbildung in der Domschule von Paris. Mit seinem Freund Hermann von Carinthia besucht er das Byzantinische Reich, die Kreuzfahrerstaaten in Palästina und Damaskus. Ab 1141 befindet er sich in Spanien. Er übersetzt unter anderem Werke von Al-BattänT. Später wirkt er als Kleriker in Pamplona und Tudela.
Hermann von Carinthia
Ein Philosoph, Astronom, Astrologe, Mathematiker, Übersetzer und Autor aus Is- trien76.
Hermann besucht eine Kathedralschule in Chartres. Nach einem Studium in Paris und der ausgedehnten Studienreise mit seinem Freund Robert von Ketton wirkt er als Gelehrter in Spanien und Südfrankreich. Er gilt als der wichtigste Übersetzer arabischer astronomischer Texte im 12. Jahrhundert. So hat er die lateinische Übertragung der arabischen Version des Planisphaerium des Claudius
Ptolemaeus und des Kitab al-madkhal ila ilm ahkam al nujum (Einführung in die Astronomie) des Abu Ma'shar realisiert77
Hugo von Santalla
Vermutlich Priester am Hof des Bischofs von Tarazona78.
Von ihm sind Übersetzungen arabischer Manuskripte über Hermetik und Alchemie sowie zehn Übersetzungen magisch-astronomischer Werke [Ricklin 2006, 56] ins Lateinische bekannt.
Petrus Alfonsi (1062-1140)
Ein spanisch-jüdischer Arzt79.
Er nimmt nach seiner Konversion den Namen Petrus Alfonsi an. Während eines längeren Englandaufenthalts fungiert er als Hofarzt Heinrich I. [Ricklin 2006, 53]. Später wird er Leibarzt des Königs Alfons I. von Aragón. Er ist beteiligt an der Übersetzung des Korans ins Lateinische. Im Vorwort seiner Schrift Epistola ad peripateticos unterzieht er am Beispiel der Astronomie den zeitgenössischen lateinischen Wissenschaftsbetrieb einer beißenden Kritik80 [Ricklin 2006, 53 f.]:
„Da ich nun festgestellt habe, daß so gut wie alle Lateiner in der Kunst der Astronomie Ignoranten sind, ich mich aber schon lange mit ihr beschäftige und mir einen nicht geringen Teil davon angeeignet habe, habe ich beschlossen, wenn es denn recht ist, sie mit euch zu teilen und sie sorgfältig und wohlwollend sozusagen als etwas Seltenes, Wertvolles und Süßes vorzustellen.“
Plato von Tivoli
Lat. Plato Tiburtinus. Mathematiker und Astronom.
Er lebt in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Barcelona. Er übersetzt Werke griechischer Mathematiker und Astronomen aus dem Arabischen und Hebräischen ins Lateinische. Seine Manuskripte werden unter anderem von Albertus Magnus und Fibonacci benutzt.
5.2.2. Die toledanische Phase
Im Rahmen der christlich-spanischen Reconquista erobert König Alfons VI. von Kastilien und León im Jahre 1085 Toledo und macht die alte Hauptstadt der Westgoten zur Hauptstadt seines kastilischen Königreichs. Die Bibliothek der Stadt ist mit arabischen Werken reichhaltig ausgestattet. Viele europäische Denker, wie Daniel Morley, reisen nach Toledo, um Vorlesungen zu hören[86]. Die Stadt ist „the singular city to which European scholars traveled to study Arabic, and to exploit the Arabic libraries housed there“ [Menocal 2006, 125].
Dies erkennt der Toledaner Erzbischof Raimund[87] (~1126-~1152) und er beginnt das Projekt, die im Arabischen vorliegenden philosophischen und wissenschaftlichen Schriften antiker Herkunft ins Lateinische übersetzen zu lassen. Die qualifi- katorischen Voraussetzungen für die Zusammenstellung von Übersetzerteams sind in der Stadt sehr günstig.
In Toledo leben Mozaraber, das sind die Christen, die seit der Maurenherrschaft arabisch sprechen, aber auch das Vulgärlatein beherrschen. Hier sind vertreten die jetzt unter christliche Herrschaft gelangten Muslime (Mudejaren). Weiterhin wohnt hier eine jüdische Minderheit, deren Gelehrte neben hebräisch auch die arabische und die lateinische Sprache beherrschen. Die an der Übersetzung führend beteiligten Kleriker können mit ihrem Gelehrtenlatein schließlich den Übersetzungen den letzten wissenschaftlichen Schliff geben.
Die zwischen 1130 und 1187 andauernde Übersetzungsphase wird in der Literatur vielfach unter der Bezeichnung Übersetzerschule von Toledo[88] thematisiert. Dieser Begriff wird erst im frühen 19. Jahrhundert von Amable Jourdain eingeführt. Zwar sind neben den Forschungs- auch Lehrtätigkeiten der Übersetzer belegt, aber es dürfte sich um keine Schulgründung gehandelt haben. Man sollte darunter vielmehr das Insgesamt der in Toledo abgelaufenen Übersetzungsaktivitäten vom Arabischen ins Lateinische verstehen.
Dominicus Gundissalinus (~1110-~1190)
Auch Dominicus Gundisalvi, Domingo Gonzales aus dem spanischen Segovia.
Er ist Erzdiakon in Cuellar und Domherr in Toledo. Ihm hat Erzbischof Raimund die Leitung des Übersetzungsprojekts übertragen. Ab etwa 1140 übersetzt er eigenständig und mit Kollegen rund zwanzig Werke aus dem Arabischen. Im Rahmen der Übersetzung aristotelischer Schriften entsteht seine Schrift De divisione philosophiae. In ihr begründet er die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen Theologie als divina scientia und Philosophie als humana scientia. Dies führt zu der Konsequenz, dass die septem artes liberales, die bis dahin die Inhalte des mittelalterlichen Studiums prägen, ihre Eigenständigkeit verlieren.
Abraham ibn Daud (~1110-1180)
Avendauth (europäisiert). Jüdischer Gelehrter81 aus dem maurischen Córdoba.
Er flieht während der intoleranten Almohadenzeit ins christliche Toledo. Er ist der erste Aristoteliker noch vor Maimonides. Zusammen mit Dominicus Gundisalvi übersetzt er Avicennas De anima sowie De medicinis cordialismus [Hasse 2017, 379 f.].
Johannes Hispaniensis (?-1215)
Johannes von Sevilla. Ein konvertierter jüdischer Gelehrter82.
Er übersetzt mathematische, astronomische und astrologische Texte sowie einige philosophische und medizinische Werke. Besonders bekannt ist die Übersetzung des Werkes De Differentia Spiritus et Animae von Qusta ibn Luqa83 (820-912), das er dem Toledaner Erzbischof Raimund widmet [Jankrift 2007, 88].
Michael Scotus (~1180-~1235)
Ein schottischer Gelehrter84.
Es ist nicht bekannt, wann er nach Toledo kommt. Er soll die Averroes- Kommentare der Aristoteles-Schriften in Lateinische übersetzt haben, von denen 14 erhalten sind. Weiterhin hat er vor 1220 die drei arabisch vorliegenden Bücher Historia animalium, De partibus animalium und De generatione animalium des Aristoteles übersetzt. Später geht er nach Sizilien an den Hof Friedrichs II., wo er weiterhin sehr produktiv ist. Als einer der bedeutendsten Übersetzer des Mittelalters habe er „wesentlich zum Siegeszug von Aristoteles und Averroes an den spätmittelalterlichen Universitäten beigetragen“ [Hasse, 383 f.].
Gerhard von Cremona (1114-1187)
Ein wahrscheinlich aus dem lombardischen Cremona85 stammender Gelehrter und späterer Kanoniker an der Kathedrale von Toledo.
Über sein Leben ist wenig bekannt. Er geht wohl früh nach Toledo, lernt Arabisch und wird dort zum arbeitsintensivsten und berühmtesten Übersetzer. Er soll mindestens 70 philosophische und naturwissenschaftliche Werke aus dem Arabischen ins Lateinische übertragen haben, unter anderem den fünfbändigen Canon der Medizin von Avicenna und den Almagest von Ptolemäus [Hasse 2015, 157]. Wenngleich die Qualität seiner Übersetzungen von unterschiedlichem Niveau sein soll, hat er das Verdienst, für die Bekanntheit vieler Werke sowohl der antiken griechischen als auch der mittelalterlichen arabischen Philosophie und Wissenschaft in der lateinischen Welt gesorgt zu haben, was die Entwicklung der Scholastik nachhaltig beeinflusst hat.
Das Islam-Informations- und Widerlegungs-Projekt des Petrus Venerabilis und die erste Koranübersetzung ins Lateinische
Petrus Venerabilis (1092-1156), Abt von Cluny, damals Zentrum eines klösterlichen Reiches und unter direktem Schutz des römischen Pontifex, unternimmt eine Inspektionsreise in die wieder christlich gewordenen Teile Spaniens. Mit Blick auf die Kreuzzüge reift in ihm die Überzeugung, „dass der Islam nicht mit Waffengewalt, sondern nur mit der Macht des Wortes zu besiegen sei“ [Bobzin 2014, 13]. Dabei musste er erkennen, „dass im Abendland selbst die wesentlichsten Grundlagen für eine geistige und theologische Auseinandersetzung mit dem Islam als Voraussetzung für die Vermittlung der spirituellen Wahrheit durch ratio und aucto- ritas noch nicht vorhanden waren, allen voran gründliche Kenntnisse der Lehre Muhammads, seines Lebens und seiner Taten“ [Vones 2006, 218].
Er möchte die Religion des Islam anhand ihrer Originalquellen bekämpfen und widerlegen. Daher initiiert er in Toledo das Projekt einer ersten Koranübersetzung ins Lateinische86, die von Robert von Ketton, Petrus Alfonsi und Hermann von Carinthia mit Unterstützung eines Mauren im Jahr 1043 fertiggestellt und von Peter von Poitiers, dem Abt-Sekretär, stilistisch überarbeitet wird. Sie trägt den Titel Lex Mahumet pseudoprophete (Die Schrift des Pseudopropheten Mohammed) und bleibt bis ins 16. Jahrhundert Hauptbezugspunkt abendländischer Islamstudien87.
Petrus Venerabilis veranlasst die Übersetzung weiterer islamischer Texte und stellt einen islamischen Informationskorpus mit dem Titel Collectio Toletana bzw. Corpus Toletanum zusammen. Er selbst verfasst darin eine Darstellung der islamischen Lehre (Summa totius haeresis Saracenorum = Das Insgesamt der Häresien der Sarazenen) sowie ein Schrift zur Widerlegung des Islam (Liber contra sectam sive haeresim Saracenorum = Das Buch gegen die Sekte oder Häresie der Sarazenen)88. Er ist der Überzeugung, dass der Islam eine christliche Häresie sei und es darum ginge, die Muslime als Heiden zu missionieren. Seine Collectio sei in erster Linie „als Quelle für antiislamische Polemik konzipiert“ [Soltani 2016, 73; vgl. auch Puig 2006].
5.3. Die Renaissance-Phase der Übersetzungsbewegung
Nach Hasse89 sei diese Phase, die für ihn den Zeitraum zwischen 1480 und 1700 umfasst, noch nicht systematisch erforscht, es lägen aber zahlreiche Einzelstudien vor. Hasse selbst führt im Anhang [S. 84 ff.] 22 Autoren auf, die arabische Werke oder zunächst ins Hebräische übersetzte arabische Schriften ins Lateinische übertragen haben.
Schriften von folgenden arabischen Gelehrten werden aufgeführt: Avicenna, Averroes, Ibn Tufayl, Avempace, Alpetragius, Albucasis, Afraganus, al-Abhari, Maimonides, Alfarabi, Alhazen, Ibn al-Nafis/al-Sirazi, Ibn al Baytar, Serapion und Mesue. Dabei liegt das Hauptinteresse bei der Medizin des Avicenna, der Philosophie des Averroes und bei der Astronomie diverser Gelehrter. Schriften von Avicenna werden von elf Autoren, Schriften von Averroes von sieben Autoren übersetzt.
Hasse unterscheidet zwei Wellen von Übersetzern. Die erste Welle datiert er von Girolamo Ramusio (1450-~1486) bis Jacob Mantino (?-1549); die zweite von Jean Cinqarbres (1514-1587) bis Edward Pococke (1604-1691). Die Übersetzer der zweiten Welle behandelt er nicht mehr, weil sie schon der Frühphase der Orientalischen Philologie zuzurechnen seien.
Die der frühen Orientalistik zugeschriebenen Übersetzer verteilen sich schon über das lateinische Europa: Jean Cinqarbres (Paris), Jacob Christmann (Heidelberg), Jean Faucher (?), Tommaso Obicini von Novarra (Rom), Peter Kirsten (Breslau), Johann Buxtorf (Basel), Antonius Deusing (Groningen), Jacob Golius (Leiden), Pierre Vattier (Orleans, Paris), Vopiscus Plemp (Louvain), Georg Hieronymus Welsch (Augsburg) und Edward Pococke (Oxford).
Der behandelten ersten Welle (1480-1550) werden folgende elf Übersetzer zugerechnet: Girolamo Ramusio, Elia del Medigo, Anonymus, Andrea Alpago, Giovanni Burana, Abraham de Balmes, Calo Calonymos ben David, Vitalis Nisso, Paolo Ricci und Jakob Mantino.
Es sind mehrheitlich jüdische Mediziner, die der Universität in Padua verbunden sind und vor allem bereits ins Hebräische übersetzte arabische Medizinschriften ins Lateinische übersetzen bzw. re-übersetzen; denn „Medicine was the Arabic science par excellence in the Renaissance“ [Hasse 2006, 77]. Nur Ramusio (Canon I) und Alpago (Canon I-V) übersetzen Avicenna aus dem Arabischen ins Lateinische, und dies vor Ort in Damaskus.
Andrea Alpago (~1450-~1521), geboren im italienischen Belluno, ist Arzt und Arabist. Er lebt rund dreißig Jahre als Arzt an der Venezianischen Gesandtschaft in Damaskus. Seine Korrekturen und Kommentare zu Avicennas Canon werden Standard für die Folgedrucke der frühen Neuzeit [Veit 2006, 307]. Er gilt „als einer der letzten großen Übersetzer aus dem Arabischen ins Lateinische. Er repräsentiert eine Richtung des Humanismus, die die mittelalterliche arabisch-lateinische Tradition nicht en bloc zugunsten von Autoren der Antike ablehnte, sondern sich um eine konstruktive Aneignung und Fortführung bemühte“ [ebenda, 305].
5.4. Weitere Übersetzungsaktivitäten
Alfons X., der Weise 90, bemüht sich um die Entwicklung einer spanischen Hochsprache. Deshalb lässt er während seiner Regierungszeit (1252-1284) in Toledo sowohl das Alte Testament aus der lateinischen Fassung der Vulgata ins Kastilische übersetzen als auch vorliegende klassische arabische Werke über Astronomie, Mathematik und Philosophie.
Am sizilianischen Hof des staufischen Königs Friedrich II. (1194-1250) sind christliche, muslimische und jüdische Gelehrte versammelt. Auch Michael Scotus kommt in diesen Kreis91. Er übersetzt arabische philosophische Texte. Bekannt ist seine lateinische Übersetzung von Avicennas Abbreviatio de animalibus, die dann Friedrich für sein berühmtes Falkenbuch verwendet.
5.5. Die Vermittlung der arabischsprachigen Wissenschaften
im lateinischen Europa
Die ins Lateinische übersetzten arabischsprachigen wissenschaftlichen Werke werden erworben und finden Eingang in die Bibliotheken von privaten Gelehrten, von Klöstern, von Herrscherhöfen und dann insbesondere von den ab dem späten 11. Jahrhundert entstehenden Universitäten.
Privatbibliotheken
Berühmt ist die von Speer [2006, XX] beschriebene private Bibliothek des Magister und Arztes Amplonius Rating de Berka aus dem 15. Jahrhundert. Im Katalogverzeichnis dieser Bibliotheca Amploniana finden sich 42 Bände von arabischsprachigen Autoren. Der böhmische Arzt und Gelehrte Johann Schindel vermacht Mitte des 15. Jahrhunderts dem Karlskollegium viele Bücher aus seiner Privatbibliothek, darunter mehrere Werke von Avicenna, Razes und Isaac [Blahova 2006, 141].
Klosterbibliotheken
Die mittelalterlichen Klöster haben in Verbindung mit ihrer Lehrtätigkeit in den Kloster- und Domschulen unterschiedlich umfangreiche Bibliotheken, in die im Laufe der Zeit auch die sog. weltlichen Wissenschaften Eingang finden. Vor allem im Rahmen der klösterlichen Krankenfürsorge finden Mönchsärzte Zugang zur aus dem Arabischen übersetzten antik-römisch-griechischen Medizin. In Monte Cassino, dem Mutterkloster des Benediktiner-Ordens, werden u.a. Werke von Avicenna übersetzt und das medizinische Wissen im monastischen Infirmarium angewendet [Mazal 2006, II-336 ff.].
Herrscherhöfe
Die Herrscherhäuser haben ein vielfältiges Interesse an Astronomie/Astrologie.
Aufgrund von Familienkontakten zwischen dem Prager und dem kastilischen Königshof kommen zum Beispiel Ende des 13. Jahrhunderts spanische Astronomen mit lateinischen Übersetzungen arabischsprachiger Werke nach Prag. Besonders unter Wenzel IV. (1378-1419) entstehen mehrere bis heute erhaltene prunkvoll mit arabischen Motiven ausgeschmückte astronomisch-astrologische Codices [Blahova 2006, 142].
Universitäten
Die ab dem späten 11. und 12. Jahrhundert in Italien, Frankreich und England sowie danach im lateinischen Europa entstehenden Universitäten werden Ausbildungsstätten für die kirchlichen und weltlichen Führungsschichten.
Die Ausbildungsinhalte sind „fast vollständig bestimmt von heidnischen Autoritäten: Griechen und Arabern. Christliche Autoren las man (mit wenigen Ausnahmen) erst dann, wenn man an der theologischen Fakultät sein Studium fortsetzte“ [Hasse 2015, 158].
Die Universität Paris als intellektuelles Zentrum der damaligen christlichen Welt erklärt im Jahre 1255 sämtliche Schriften des Aristoteles zur Pflichtlektüre der Ar- tes-Fakultät, verbunden mit den entsprechenden Kommentaren des Averroes.
In den späteren medizinischen Fakultäten gehören neben Hippokrates und Galen die arabischsprachigen Autoren Avicenna, Rhazes und Mesue zur Pflichtlektüre [ebenda, 158].
Vor der Prager Universitätsgründung studieren medizinische Scholaren aus den böhmischen Ländern vor allem an der Universität in Montpellier, „wo man seit dem Jahre 1230 die toledanisch-arabische Richtung der Medizin rezipierte und wo besonders Kenntnisse der Werke Avicennas, jedoch auch Razes‘ und anderer Autoren vermittelt wurden“ [Blahova 2006, 140].
An der dann im Jahre 1348 gegründeten Prager Universität lassen sich Texte von rund zwanzig arabisch-islamischen Autoren nachweisen, die im Rahmen des Studiums der Medizin, Philosophie, Mathematik, Astronomie und Astrologie verwendet werden [ebenda].
An der medizinischen Fakultät werden ins Lateinische übersetzte arabischsprachige Werke unter anderem von Galen, Hippokrates, Razes, Avicenna, Isaac, Al- bucasis und Avenzoar benutzt.
Gleichsam zusammenfassend lässt sich das große Gewicht der arabischsprachigen Wissenschaften an den universitären Ausbildungsinhalten aus der von Hasse [2015] zusammengestellten Tabelle entnehmen. Jeder akademisch gebildete Mensch der Renaissance- und Reformationszeit hätte die Namen dieser arabischen Gelehrten gekannt, und dies wegen der „Verankerung arabischer Autoren in der Universitätskultur: vor allem in Philosophie, Medizin und Astrologie“ [ebenda, 160].
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
678 lateinische, zum Teil mehrbändige Drucke von 45 arabischsprachigen Autoren
von der Mitte des 15. Jh. bis zum 17. Jh.
in abendländischen Universitätsbibliotheken 92
Wörter arabischer Herkunft[101]
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Die Sprache als Vermittlungsmedium
Das Hauptmedium aller Vermittlungsprozesse ist die Sprache. In ihrem Wortschatz spiegeln sich alle kulturellen Einflüsse. Hasse [2015] veranschaulicht dies, wenn er seinem Aufsatz den Titel gibt „Von Alkohol bis Ziffer - Der arabische Einfluss in Europa im Spiegel der deutschen Sprache“. Ergänzt um zusätzliche Quellen habe ich in der folgenden Übersicht eine Liste mit 147 Wörtern arabischer Herkunft zusammengestellt, die vornehmlich über den romanischen Sprachraum in die deutsche Sprache Eingang gefunden haben.
In der islamischen Frühzeit sind die Araber ihren Nachbarvölkern zivilisatorischkulturell weit unterlegen. Von den Persern und Griechen, aber auch Indern und Chinesen, übernehmen sie aus den Bereichen des Handels, der Landwirtschaft, 93 der Industrie und der Wissenschaft das hochentwickelte Wissen mit den entsprechenden Fachtermini, zum Beispiel im Hinblick auf Möbel, Kleidung, Früchte, Parfümerie, Pflanzen, Utensilien, Handwerkzeuge oder Musik.
In der Hochblüte des islamischen Reiches sind die zivilisatorisch-kulturellen Fachtermini ein fester Bestandteil der arabischen Sprache geworden. „Zwischen dem 8. und 13. Jh. war das Arabische die einzige Wissenschaftssprache überhaupt, zu der später Latein hinzukam, indem man sehr vieles in den Bereichen der Chemie, der Mathematik, übersetzte. Wörter wurden vom Arabischen übernommen, die heute noch Bestandteil des Latein und später der modernen europäischen Sprachen wurden“94.
Infolge der leistungsfähigen astronomischen Forschung tragen bis heute hunderte von Sternen arabische Namen95, zum Teil, weil die griechischen Bezeichnungen zu kompliziert waren96. Im Sternbild des Großen Bären bzw. Großen Wagen tragen von sieben Hauptsternen fünf arabische Namen: Dubhe, Megrez, Alioth, Mizar und Alkaid [Al-Khalili 2016, 21].
6. Bedeutung und Bewertung des arabisch-islamischen Kultureinflusses für die zivilisatorisch-kulturelle Entwicklung des christlichen Abendlandes
6.1. Die lineare Verwurzelung der Renaissance in der altgriechischen Kultur
- ein Mythos der eurozentrischen Wissenschaftsgeschichte
Die Humanisten der Renaissance bekommen aus dem byzantinischen Raum Zugriff auf die noch erhaltenen antiken römisch-griechischen Originalquellen. Sie entwerfen ein neues Übersetzungsprogramm unter dem Motto ad fontes (zurück zu den Quellen). Bestärkt durch aufgedeckte Übersetzungsfehler der aus dem Arabischen transformierten lateinischen Texte entwickeln sie sich zu „stimmgewaltigen Antiarabisten“ [Strohmaier 2006, 130]. Sie erklären die arabischsprachigen Wissenschaftler zu bloßen Plagiatoren. „Fast alle spätmittelalterlichen Bibliotheken des akademischen Milieus sind von arabischen Namen durchzogen. Gegen diese Arabisierung kämpften wenig später die Humanisten der Renaissance, als sie die Rückkehr zu den Griechen predigten - und dies mit Erfolg“ [Speer 2006, XX].
Nach wie vor ist die Ansicht verbreitet, dass der arabisch-islamische Kulturraum das antike Wissen nur durch Übersetzungen tradiert habe, ohne etwas Neues hinzuzufügen. Fatalerweise gelte dieses Urteil heute auch „für den gegenwärtigen arabisch-islamischen Kulturraum, in dem die Schulbücher nach amerikanischen oder europäischen Vorbildern gestaltet werden“ [Sezgin 2003, XI].
Als Konsequenz entstehen „kulturelle Klischees über die arabische Welt von unerfreulich langer Lebenszeit. Diese Klischees summieren sich bei manchen Humanisten und leider auch bei manchen heutigen Intellektuellen zu einem kulturellen Rassismus“ [Hasse 2015, 167]. Dies sieht auch Strohmeier so [2006, 131] und er fordert, Abschied zu nehmen „von einem letztlich rassistisch motivierten Europamythos, der uns in einer exklusiven Kontinuität mit den alten Griechen“ sieht.
Inhaltliche Tendenzen dieser Art zeigen sich bei Sylvain Gouguenheim [2011], dessen Studie den apodiktischen Untertitel trägt „Die griechischen Wurzeln des christlichen Abendlandes“. Sein Fokus liegt auf der Übersetzungsgeschichte wissenschaftlicher Werke aus dem antiken Griechenland. Für den islamischen Kulturraum und in der Folge für das lateinische Europa marginalisiert er das Verdienst muslimischer Gelehrter an der Bewahrung des antiken Wissens, und er negiert dessen eigenständige Weiterentwicklung durch sie. Es seien orientalische Christen gewesen, die fast alle vom griechischen Originaltext in die syrische Sprache und von dort ins Arabische übersetzt hätten [164]. „Die Hellenisierung Europas im Mittelalter gelang den Europäern aus eigener Kraft“ [165].
Diese These Gouguenheims ist schlicht falsch, was in den vorausgehenden Abschnitten am Beispiel vieler Wissenschaftler veranschaulicht wurde, und was Sali- ba [2011,231] nach seinen Studien wie folgt bestätigt: „...the Renaissance men of science were apparently looking to the world of Islam for the latest in scientific activities rather than looking to the Greek classical sources, especially for those sciences that were more of the empirical type like astronomy and medicine which needed to be constantly updated.”
6.2. Der Mythos vom Tod des Rationalprinzips und der Wissenschaft im arabisch-islamischen Kulturraum ab dem 13. Jahrhundert
Die in obiger Überschrift enthaltene These wird nach Saliba [2011] insbesondere von zwei Gruppen von Historikern vertreten. Die erste Gruppe betrachte die Geschichte des arabisch-islamischen Kulturraums unter politischen Aspekten als eine Abfolge von Herrscherdynastien und deren Kriege. Mit der Eroberung des Abbasi- den-Reichs durch die Mongolen und der Zerstörung Bagdads im Jahre 1258 sei der Verfall der arabisch-islamischen Zivilisation und damit auch der Wissenschaften eingeleitet worden. Viele Legenden über barbarische Verwüstungen und Gräueltaten während der Mongolenherrschaft hätten zu dieser Ansicht mit beigetragen.
Saliba belegt mit vielen Beispielen, dass nach dem Ende des Abbasidenreichs in vielen islamischen Nachfolgestaaten trotz politischer Turbulenzen die kulturellwissenschaftliche Entwicklung auf hohem Niveau weiterläuft. Zudem negiert dieser Mythos die Kalifate im andalusischen Córdoba und im ägyptischen Kairo.
Die zweite Gruppe fokussiere sich auf die Entwicklung des islamisch-religiösen Denkens. Die rationalistische Mu’tazila-Bewegung habe gegenüber den traditionellen Hadith-Gelehrten eine Niederlage erlitten. Und der persisch-arabische Theologe und Philosoph al-GhazälT (1058-1111) habe in seinem Buch Die Inkohärenz der Philosophen (At-Tahafut Al-Falasifa) den Philosophen das Recht abgesprochen, ihr Prinzip der Kausalität auch auf den jenseitigen Gott anzuwenden97. Damit habe die orthodoxe Religion über das rationale Denken gesiegt.
Letztere These mag für die damaligen religiösen Wissenschaften gelten, für die sog. profanen Wissenschaften, wie Mathematik, Astronomie, Geografie usw., trifft sie nicht zu. Dass die Vertreter der religiösen Wissenschaften hier nicht kritisch eingreifen, könnte daran liegen, dass das geozentrische Weltbild nicht angetastet wird. Die Religionsgelehrten haben vor allem ein großes Interesse an einer empirisch orientierten Astronomie, deren exakte Ergebnisse sie für ihre religiösen Zwecke benötigen, wie zum Beispiel für die Bestimmung der Gebetsrichtung. Das führt sogar so weit, dass „most astronomical works seem to have been produced by men of religion, and most of them were in fact employed in religious institutions“ (Saliba 2011, 243].
6.3. Das universalhistorische Kontinuitätsaxiom, veranschaulicht am Beispiel der Astronomie und am Werk des Kopernikus
Das traditionelle wissenschaftshistorische Narrativ geht von der Annahme aus, „that Islamic civilization was a desert civilization, far removed from urban life, that had little chance to develop on its own any science that could be of interest to other cultures” [Saliba 2011,1 und ff.]. Wissenschaftliches Denken und Arbeiten habe sich erst durch die Kontakte mit den alten Kulturräumen, wie dem indischen, dem sassanidischen oder dem greco-hellenistischen herausgebildet, in der Übersetzungsbewegung der Abbasidenzeit seinen Höhepunkt gefunden, dabei keine eigenständige Weiterentwicklung erfahren und sei ab dem 12./13. Jahrhundert dem Niedergang verfallen, während die europäischen Wissenschaften mit der beginnenden Renaissance sich im direkten Rückgriff auf die griechisch-römischen Quellen entfalteten, ohne auf arabisch-islamische Quellen angewiesen zu sein.
Demgegenüber geht das universalhistorische Narrativ von der Einheit der Geschichte der Wissenschaften aus, was in der hier anstehenden Frage besagt, „dass der arabisch-islamische Bereich in der Periode zwischen der Spätantike und der europäischen Neuzeit der entwicklungsfähigste und in seiner Ausstrahlung stärkste Kulturraum und das eigentliche Bindeglied zwischen der alten Welt und dem werdenden Abendland war“ [Sezgin 2003, XI].
Diese kontinuierliche Wissenschaftsentwicklung sieht in der arabisch-islamischen Wissenschaftswelt so aus, dass vom Beginn der ersten Übersetzungsbewegung an die Gelehrten, von Ausnahmen abgesehen, mehrheitlich nicht nur passiv übersetzen, sondern das Übersetzte kritisch hinterfragen und mit Hilfe neuer Methoden nach eigenen Erkenntnissen weiterentwickeln. Die Folgegenerationen der Gelehrten überprüfen diese Weiterentwicklungen ihrerseits und tragen so zum vertieften disziplinären Fortschritt bei.
Am Beispiel der arabisch-islamischen Astronomie beschreibt Saliba [1999 und 2011] diesen wissenschaftlichen Revisions- und Konstruktionsprozess vom 9. bis zum 16. Jahrhundert sehr eindrucksvoll. Mit dem Werk Al-Shukük ‘ala Batlamyüs (Zweifel an Ptolemäus) und von al Haitham/Alhacen (965-1040) erreicht die Kritik an Ptolemäus‘ Almagest und seinen planetarischen Annahmen einen ersten Höhepunkt, bewegt sich aber noch im systemimmanenten ptolemäischen Rahmen. Zweihundert Jahre später gewinnt man die Einsicht, „that Ptolemy’s mathematics itself was inadequate, and that new mathematics had to be invented for the purpose” [2011, 169].
Al-TüsT (1201-1274), al-UrdT (1200-1266), Ibn al-Shatir (1304-1375), Khafri (~1470-~1525) und weitere Gelehrte erfinden neue mathematische Instrumente und Modelle, die sowohl die theoretische Astronomie voranbringen, als auch für astronomische Beobachtungserfordernisse adaptiert werden können. Damit verändert sich der inhaltliche Charakter der Astronomie: sie nennt sich jetzt 'ilm al- hay'a (wörtlich: die Wissenschaft von der Konfiguration der Welt). „And of course it had no Greek equivalent“ [2011, 175], und zugleich hat sie sich bewusst und endgültig von der Astrologie getrennt.
Unter universalhistorischem Aspekt vollzieht sich die Entwicklung von Wissenschaft einerseits im fortlaufenden Generationenprozess und andererseits als ein kontinuierlicher Austausch von Ideen und Ergebnissen zwischen den Wissenschaftlern aller Völker. Dies gilt auch für die Zeit der sog. Renaissance. Am Beispiel des Nikolaus Kopernikus (1473-1543) sei dies kurz erläutert; denn sein Werk stellt keine creatio ex nihilo dar.
Ab dem Jahr 1496 studiert Kopernikus98 an der Universität Bologna neben Rechtswissenschaft und Griechisch auch Astronomie bei Domenico Maria da No- vara99 (1454-1504), der Zweifel am damaligen ptolemäischen geozentrischen Weltbild hat und offenbar neuere Theorien zur Bewegung der Planeten lehrt. Gute vierzig Jahre später (1543) veröffentlicht Kopernikus sein Hauptwerk De revolutio- nibus orbium coelestium (Über die Umschwünge der himmlischen Kreise), ein Modell, demzufolge sich die Planeten einschließlich der Erde um die Sonne bewegen und die Erde sich um ihre eigene Achse dreht. Dieser Wandel vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild wird auch als kopernikanische Wende bezeichnet.
Seit den 1950er Jahren finden mehrere Wissenschaftshistoriker heraus [Saliba 2011, 193 ff.], dass Kopernikus mit mathematischen Verfahren und Modellen arbeitet, die in identischer Weise schon von den arabisch-islamischen Gelehrten al- TüsT, al-UrdT und Ibn al-Shatir formuliert worden sind. Bezogen auf das Werk von Ibn al-Shatir formuliert Saliba [193 f.] es so: „All that someone like Copernicus had to do was to take any of Ibn al-Shatir’s models, hold the sun fixed and then allow the Earth’s sphere, together with all the other planetary spheres that were centered on it, to revolve around the sun instead. As we shall soon see that was the very step that was taken by Copernicus when he seemed to have adopted the same geocentric models as those of Ibn al-Shatir and then translated them to heliocentric ones whenever the situation called for it.”
Saliba beschreibt dann mehrere mögliche Wege, über die Kopernikus Kenntnis von den arabisch-islamischen Astronomen erhalten haben könnte, gesteht aber zu, dass dies alles noch Vermutungen seien und er schließt: „These findings do not only explain the background and motivation of the Copernican works; they also explain the continuity of thought from the Middle Ages into the Renaissance time, without having to make wild assumptions about ideas being born in abstract contexts. Their sheer number and complexity, as well as their technical nature also remove the possibility of coincidental discovery, and force us to agree with Swerdlow and Neugebauer that it is no longer the problem of ‘if’ but ‘when, where and in what form’ did Copernicus learn of those earlier works” [ebenda, 217].
6.4. Zwischenbetrachtung
Festzuhalten bleibt, dass der arabischsprachige islamische Kultureinfluss auf die Wissenschaftsentwicklung bis heute auf der einen Seite unterschätzt, auf der anderen Seite wiederum überschätzt wird.
Unterschätzung
Noch in seinem im Jahre 2019 veröffentlichten Werk beschreibt Rovelli die kumulative Evolution der Naturwissenschaft, erwähnt aber deren Weiterentwicklung nach der griechischen Antike durch den arabischsprachigen islamischen Kulturraum nur mit beiläufigen Sätzen [84, 125, 170] und hinterlässt den Eindruck, als ob die frühen westeuropäischen Wissenschaftler direkt an ihre griechischen Vorgänger angeknüpft hätten.
So heißt es zum Beispiel, die Idee des Experiments [57, 131] sei erst mit Galilei systematisch umgesetzt worden, oder: die der Zerstörungswut der frühen Christen entgangenen antiken Werke seien unter anderem „von weisen Männern und Frauen ... in der arabischen Welt studiert und ehrfürchtig weitgereicht“ [181] wor- den, aber man dürfe „den Meister nicht nur ehren, ihn studieren und auf seine Lehren aufbauen. Man muss seine Fehler suchen“ [ebenda], und damit habe erst Kopernikus begonnen.
Überschätzung
Fast als eine Art Gegendarstellung zu Gouguenheim kann man das Buch von al- Khalili [2016] auffassen, der unter dem Titel „Im Haus der Weisheit“ die arabischsprachige Übersetzungsbewegung mit ihren Gelehrten zur Abbasidenzeit mit vielen Beispielen beschreibt. Er erliegt der Gefahr einer vereinseitigenden Betrachtungsweise, wenn er dem Untertitel seines Werkes die Formulierung gibt „Die arabischen Wissenschaften als Fundament unserer Kultur“.
Selbst die in dieser Hinsicht sehr kritische Billig [2017, 283] lässt sich zum Urteil hinreißen: „Überall bietet sich dasselbe Bild: Das Abendland wurde zum Kulturfolger des arabisch-islamischen Kulturraums.“
Zwischenfazit
Ohne Zweifel sind die arabischsprachigen Werke und ihre Übersetzung ins Lateinische ein bedeutender Einflussfaktor (neben vielen anderen) für die kulturelle Entwicklung Europas gewesen. Die kulturellen Austauschprozesse zwischen der christlich-europäischen und der arabisch-islamischen Welt sind wechselseitig und unter den vielfältigsten Bedingungsfaktoren verlaufen. Es ist heute eine vorherrschende Erkenntnis, „dass sich die Beziehungen zwischen lateinisch-christlicher und arabisch-islamischer Welt mit dem Hinweis auf einen Antagonismus monolithischer Kulturblöcke letztlich nicht hinreichend erklären lassen“... .[König 2011, 239].
In diesem Sinne verabschiedet die Parlamentarische Versammlung des Europarats im Jahre 1991 die Empfehlung „Contribution of the Islamic civilisation to European culture“, in der Vorschläge zur Verbesserung der Beziehungen zwischen der westlichen und der islamischen Welt gemacht werden; denn der Islam „is still suffering from misrepresentation, for example through hostile or oriental stereotypes, and there is very little awareness in Europe either of the importance of Islam’s past contribution or of Islam’s potentially positive role in European society today.
Historical errors, educational eclecticism and the over-simplified approach of the media are responsible for this situation”100.
Aus der arabischsprachigen islamischen Welt stammende Kulturgüter
Die unterschiedlichen islamischen Welten haben dem Abendland vielfältige materielle und immaterielle Kulturgüter vermittelt. Materieller Art zum Beispiel aus der Landwirtschaft (Bewässerungssysteme, Pflanzenanbau, Tierhaltung, Gartengestaltung), aus Produktion und Handel (orientalische Stoffe, Hölzer, Gewürze, Getränke, edle Metall-, Leder- und Teppichartikel), Luxusartikel des Wohnens (Sofa, Ottomane) oder Spiel (Schach) und Musik (Gitarre, Laute). Auch die arabische Küche genießt im europäischen Mittelalter großes Ansehen. „Verschiedene Gerichte, allen voran romania, limonia und sumachia, fanden Eingang in Kochbücher des gesamten Mittelmeerraumes, ja durch normannische Vermittlung von Sizilien und Neapel bis auf die Britischen Inseln“ [Weiss-Adamson 2006, 369].
Die intensivsten arabisch-islamischen Einflüsse hat die rund achthundertjährige Maurenherrschaft in Spanien hinterlassen. Bis heute sind sie sichtbar in der landwirtschaftlichen Struktur, in Architektur, Sitten, Gebräuche, Künste, Wissenschaften und damit auch in der Sprache. In der spanischen Hochsprache zeugen davon über viertausend arabische Lehnwörter101.
Vor allem in Andalusien und im Maghreb zeigen sich noch viele Bauwerke im maurischen Stil102 mit ihren typischen Ausdrucksformen, wie zum Beispiel Hufeisenbögen, Lambrequinbögen, Alfiz-Rahmen um gewölbte Fenster-, Türen- und Arkadenöffnungen, schlanke Säulen, gekuppelte Fenster und Säulen, Stuckdeko- re mit geometrischen und pflanzlichen Motiven, Inschriftbänder mit Koranzitaten, usw. Im sog. Neomaurischen Stil entstehen im 19. und 20. Jahrhundert historisierende Bauten auf der Iberischen Halbinsel, aber auch in Frankreich, England, Österreich und Deutschland.
Die unter christlicher Herrschaft lebenden Mauren (Mudejaren) prägen als Kunsthandwerker, Baumeister und Bildhauer insbesondere zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert die Architektur. Der nach ihnen benannte sog. Mudejar-Stil [Schlicht 2013, 118] ist noch heute in zahlreichen Bauwerken Spaniens zu bewundern. Er vereinigt orientalische Bau- und Ornamentformen mit romanischen, gotischen und später mit Renaissance-Motiven. Hervorstechende Stilelemente sind Artesonados (kassettierte Decken und Türen), Azulejos (Fayence-Wandfliesen in leuchtenden Farben und Mustern) und Yesera (Dekorationen aus Stuck).
Gesamtfazit
Zusammenfassend lässt sich mit Speer/Wegener (2006, Vorwort V) feststellen: „Der Einfluss der arabischsprachigen Kultur und insbesondere der arabischsprachigen Wissenschaft auf das lateinische Mittelalter gilt der heutigen Mediävistik als eine unbestrittene Tatsache. Die Entdeckung des ,vergessenen Erbes’ und seiner Bedeutung für das lateinische Mittelalter beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Vermittlung der antiken Welt, sondern muss als ein komplexer Vorgang verstanden werden, der ein Wissensverständnis freisetzt, das die bis heute wirksame Entfaltung und Diversifizierung der Wissenschaften begründet.“
Die Gelehrten fühlen sich dem Konzept der Universalität der Vernunft103 verpflichtet. Der universalistische Anspruch der westlichen Kultur gründe sich nach Speer104 auf einem Wissenschaftsverständnis, das sie in erheblichem Maße auch der intensiven Begegnung mit der arabischen Wissenskultur verdanke. Die komplexen Arbeitsbemühungen der mittelalterlichen Aristoteles-Rezeption seien ein arabisch-griechisch-lateinisches Gemeinschaftsunternehmen mit enormen Auswirkungen auf den lateinischen Westen.
6.5. Der Niedergang der Wissenschaftskultur und ihre ungewisse Zukunft in der islamischen Welt
Nach Saliba [2011, 248 ff.] sei bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts das wissenschaftliche Entwicklungsniveau in der islamischen Welt, in China und in Europa in etwa auf gleich hohem Niveau gewesen. Wenn man Niedergang in dem Sinne definiert, dass eine Zivilisation mehr wissenschaftliche Erkenntnisse konsumiert statt produziert, dann verläuft der Niedergangsprozess der islamischen Wissenschaft noch fast unmerklich ab 1500, verstärkt sich zwischen 1600 und 1700 und wird massiv sichtbar zu Beginn des 18. Jahrhunderts.
Ein früher Keim für die wissenschaftliche Entfaltung des christlichen Abendlandes [Wulff 2010, 182 f.] wird ab dem 12. Jahrhundert mit der Gründung der europäischen Universitäten in Bologna, Paris und Oxford und danach in weiteren Standor- ten gelegt. Der zunächst als Nachteil erscheinende Umstand, dass die Universitäten anfangs der päpstlichen Zulassung und Kontrolle unterworfen sind, führt zu dem Vorteil, dass europaweit ein vergleichbarer und hoher Bildungsstandard geschaffen wird. Letztendlich entsteht eine sich selbst verwaltende Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden mit einem akademischen Freiheitsraum für neue Ideen und Erkenntnisse, relativ unabhängig von Staat und Kirche.
Mit den Fächern Metaphysik, Ethik und Naturphilosophie im universitären Lehrplan der artes liberales gehören die Proto-Naturwissenschaften zum Pflichtlernprogramm. „Damit werden die Naturwissenschaften erstmals in der Menschheitsgeschichte institutionalisiert. Es begann die systematische Beschäftigung mit der Naturforschung und es entstand der Beruf des Hochschullehrers und Wissenschaftlers“ [ebenda].
Dieser Institutionalisierungsprozess verstärkt sich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit der Gründung wissenschaftlicher Akademien. Die Accademia Nazionale dei Lincei 105 106 oder kurz Accademia dei Lincei ist die erste private, von römischen Adligen im Jahre 1603 errichtete Institution zur Förderung der Naturwissenschaften in Europa. Es folgen die Royal Society of England (1662) und die Pariser Académie des sciences (1666). „In their very structure, the academies offered those intellectual elites an invironment of scientific and intellectual competition” [Saliba 2011, 252].
Die Verbreitung dieser neuen Ideen und Erkenntnisse wird durch die Gutenberg- sche Erfindung des Buchdrucks ab 1448 in außerordentlicher Weise beflügelt. Bis zum Jahr 1500 seien rund fünfzehntausend Werke mit einer Gesamtauflage von rund zwanzig Millionen produziert worden [Wulff 2010, 183]. Wegen der Fragmentierung des europäischen Kulturraumes kann ein in einem Land verbotenes Buch in einem anderen Land hergestellt werden. So habe Galilei ein in Italien verbotenes Spätwerk in Holland drucken lassen.
Die Grundnormen der islamischen Kultur vereiteln vergleichbare Entwicklungen. Das Amalgam von Religion und Welt, von religiösem Recht und weltlichem Recht, verhindert oder erschwert zumindest den Prozess der Säkularisierung. Damit findet der Denkansatz eines Naturrechts im europäischen Sinne keine Wurzel. Im Gegensatz zu den koran- und hadithbezogenen islamischen Wissenschaften blei- ben griechische Philosophie und Naturwissenschaften die Wissenschaften der Fremden. Sie finden keinen Eingang in den höheren Unterricht der den Moscheen angeschlossenen Madrasas. Bis zur Moderne gelangen die rationalen Wissenschaften nicht in das höhere Bildungssystem der islamischen Welt [ebenda, 95, 138].
Der Buchdruck gilt fälschlicherweise als eine Erfindung der Ungläubigen. Die heilige Sprache des Koran darf durch diese Technik nicht entweiht werden. Das Druckverbot im Osmanischen Reich wird im 18. Jahrhundert etwas gelockert. „Erst im Laufe des 19. Jh. setzten sich Buch- und Zeitungsdruck in den islamischen Ländern durch. Das erste im Iran gedruckte Buch datiert von 1817“ [ebenda, 127].
Die globalen sozioökonomischen und soziopolitischen Entwicklungstrends beschleunigen die Stagnation der islamischen Kultur, Zivilisation und Wissenschaft, als da zu nennen sind: der Zerfall des islamischen Weltreichs, die Entdeckung der Neuen Welt und neuer Handelsrouten und der damit hereinströmende Reichtum in das christliche Abendland, schließlich der mit militärischer Überlegenheit gestützte Imperialismus und Kolonialismus.
Mit dem Status insbesondere der Naturwissenschaften in der Gegenwart des islamischen Kulturraumes beschäftigt sich ausführlich Karl Wulff [2010, 188 ff.]. Sein Bericht ist von tiefer Skepsis geprägt. In den seit dem 19. Jahrhundert nach westlichem Vorbild gegründeten Universitäten gäbe es keine Meinungsfreiheit, sie unterlägen einer strengen ideologischen Kontrolle.
Arabische Länder bestritten nur 1,1 Prozent der weltweiten Veröffentlichungen, nur 15 Prozent von ihnen kämen aus der Grundlagenforschung. Nach dem Arab Knowledge Report 2009 setze ein wissenschaftlicher Aufbruch in der islamischen Welt die Schaffung eines Klimas politischer, sozialer und intellektueller Freiheit voraus.
In solchen Freiheitsräumen, die bislang nur im Ausland zu finden sind, könnten dann auch muslimische Wissenschaftler erfolgreich sein. Dies beweisen zwei Nobelpreisträger: der pakistanische Physiker Mohammed Abdus Salam (1926-1996) bekam im Jahre 1979 den Nobelpreis für Physik. Er arbeitete in England. Der Ägypter Ahmad Zewail (geb. 1946) erhielt im Jahre 1999 den Nobelpreis für Chemie. Er ist in den USA tätig.
Literaturverzeichnis
Al-Daghistani, Raid (2016): Falsafa. Einführung in die klassische arabischislamische Philosophie. Studienreihe Islamische Theologie. Bd. 3: Kalam Verlag, Freiburg i. Br.
Al-Khalili, Jim (2016[2]): Im Haus der Weisheit. Die arabischen Wissenschaften als Fundament unserer Kultur. Fischer Taschenbuch, Frankfurt/M.
Billig, Susanne (2017): Die Karte des Piri Re’is. Das vergessene Wissen der Araber und die Entdeckung Amerikas. Verlag C.H. Beck, München.
Blahova, Marie (2006): Spuren des arabischen Wissens im mittelalterlichen Böhmen. In: Speer/Wegener (2006), S. 133-142.
Bobzin, Hartmut (2011): Mohammed. 4., durchgesehene Aufl., C.H. Beck Wissen, München.
Bossong, Georg (2016[3]): Das maurische Spanien. Geschichte und Kultur, 3., durchges. Aufl. Verlag C.H. Becck, München.
Burnett, Charles (2006), Humanism and Orientalism in the Translations from Arabic into Latin in the Middle Ages. In: Speer/Wegener (2006), S. 22-31.
Cobb, Paul M. (2015): Der Kampf ums Paradies. Eine islamische Geschichte der Kreuzzüge. Zabern Verlag und WBG Darmstadt.
Crespi, Gabriele (1992): Die Araber in Europa. Sonderausgabe. Belser Verlag Stuttgart (Erstausgabe 1979, Editoriale Jaca Book, Milano).
Croitoru, Joseph (2018): Die Deutschen und der Orient. Faszination, Verachtung und die Widersprüche der Aufklärung. Carl Hanser Verlag, München.
Crone, Patricia (1992): Die vorindustrielle Gesellschaft. Eine Strukturanalyse. DTV München.
Der Spiegel (2010): Der Islam. 1400 Jahre Glaube, Krieg und Kultur. Geschichte, Nr. 5.
Die Zeit (2012): 1300 Jahre gemeinsame Geschichte. Der Islam in Europa. Zeit Geschichte. Epochen, Menschen, Ideen. Nr.2.
Eichner, Heidrun/Perkams, Matthias/Schäfer, Christian (Hrsg. 2017): Islamische Philosophie im Mittelalter. Ein Handbuch. 2., unveränderte Aufl., WBG Darmstadt.
Fansa, Mamoun (Hrsg. 2009): Ex oriente lux? Wege zur neuzeitlichen Wissenschaft. Begleitband zur Sonderausstellung im Augusteum Oldenburg. Zabern Verlag Mainz. Schriftenreihe des Landesmuseums für Natur und Mensch, Heft 70.
Frankopan, Peter (2016): Licht aus dem Osten. Eine neue Geschichte der Welt. Rowohlt-Berlin Verlag, Berlin.
Freely, John (2012[4]): Platon in Bagdad. Wie das Wissen der Antike zurück nach Europa kam. Klett-Cotta, Stuttgart [Englisches Original: New York 2009]
Gouguenheim, Sylvain (2011): Aristoteles auf dem Mont Saint-Michel. Die griechischen Wurzeln des christlichen Abendlandes. Mit einem Kommentar von Martin Kintzinger und Daniel König. WBG Darmstadt.
Gutas, Dimitri (2006): What was there in Arabia for the Latins to Receive? Remarks on the Modalities of the Twelfth-Century Translation Movement in Spain. In:
Halm, Heinz (2010): Die Araber. Von der vorislamischen Zeit bis zur Gegenwart. 3., durchgesehene u. aktualisierte Aufl., Verlag C.H. Beck, München.
Hasse, Dag Nikolaus (2006): The Social Conditions of the Arabic-(Hebrew) Latin Translation Movements in Medieval Spain and in the Renaissance. In: Speer/Wegener (2006), S. 68-86.
Hasse, Dag Nikolaus (2015): Von Alkohol bis Ziffer - Der arabische Einfluss in Europa im Spiegel der deutschen Sprache. In: Klein, Dorothea (Hrsg. 2015): „Überall ist Mittelalter“. Zur Aktualität einer vergangenen Epoche. Würzburger Ringvorlesungen, Bd. 11, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, S. 151-172.
Hasse, Dag Nikolaus (2017): Die Überlieferung arabischer Philosophie im lateinischen Westen. In: Eichner et al. (Hrsg. 2017), S. 377 - 400.
Hattstein, Markus; Delius, Peter (Hrsg. 2000): Islam. Kunst und Architektur. Kö- nemann Verlag, Köln.
Heine, Peter (2011): Märchen, Miniaturen, Minarette. Eine Kulturgeschichte der islamischen Welt. Primus Verlag und WBG Darmstadt.
Hendrich, Geert (2011[2]): Arabisch-islamische Philosophie. Geschichte und Gegenwart. 2., aktualisierte Aufl., campus studium, Campus Verlag, Frank- furt/New York.
Herrmann, Dietmar (2014): Die antike Mathematik: Eine Geschichte der griechischen Mathematik, ihrer Probleme und Lösungen. Springer Spektrum, Ber- lin/Heidelberg.
Jankrift, Kay Peter (2007): Europa und der Orient im Mittelalter. WBG Darmstadt.
Kettermann, Günter (2001): Atlas zur Geschichte des Islam. WBG Darmstadt.
Kintzinger, Martin & König, Daniel G. (2011): Arabisch-islamisches Erbe und europäische Identität. In: Sylvain Gouguenheim (2011), S. 229-257.
Köhler, Bärbel (1994): Die Wissenschaft unter den ägyptischen Fatimiden. Arabis- tische Texte und Studien, Bd. 8, Georg Olms Verlag, Hildesheim-ZürichNew York.
Mann, Frido; Mann, Christine (2018): Es werde Licht. Die Einheit von Geist und Materie in der Quantenphysik. FISCHER Taschenbuch, Frankfurt/M.
Markowski, Mieczyslaw (2006): Der averroistisch geprägte Aristotelismus als via communis. In: Speer/Wegener (2006), S. 655-661.
Maurer, Karl (2019): Die karolingische Renaissance. In: Wellbery, David E. et al. (Hrsg.): Eine neue Geschichte der deutschen Literatur. Erster Teilband. WBG Darmstadt, S. 34-39.
Mazal, Otto (2006): Geschichte der abendländischen Wissenschaft des Mittelalters. Bd. I und II. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
Menocal, Maria Rosa (2006): The Castilian Context of the Arabic Translation Movement: Imagining the Toledo of the Translators. In: Speer/Wegener 2006, S. 119-125.
Nagel, Tilman (1991[2]): Das Kalifat der Abbasiden. In: Haarmann, Ulrich (1991[2]), S. 101-165.
Osman, Nabil (2010[8]): Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Herkunft. Verlag C.H. Beck, München.
Perkams, Matthias (2017): Ein historischer Überblick über die islamische Philosophie bis Averroes. In: Eichner et al. (Hrsg. 2017), S. 32 - 49.
Puig, Josef (2006): The Polemic against Islam in Medieval Catalan Culture. In: Speer/Wegener (2006), S. 238-258.
Renn, Jürgen (2022): Die Evolution des Wissens. Eine Neubestimmung der Wissenschaft für das Anthropozän, Suhrkamp.
Ricklin, Thomas (2006): „Arabes contigit imitari.“ Beobachtungen zum kulturellen Selbstverständnis der iberischen Übersetzer der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. In: Speer/Wegener (2006), S. 47-67.
Rovelli, Carlo (2019): Die Geburt der Wissenschaft. Anaximander und sein Erbe. Rowohlt Verlag, Hamburg.
Rudoph, Ulrich (2013[3]): Islamische Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 3., durchges. u. erweit. Aufl., Beck, München.
Saliba, George (1999): Whose Science is Arabic Science in Renaissance Europe? Aus: http://www.columbia.edu/~gas1/project/visions/visions.html (21.08.2018).
Saliba, George (2011): Islamic Science and the Making of the European Renaissance. First MIT Press paperback edition (© 2007 Massachusetts Institute of Technology).
Schlicht, Alfred (2013): Geschichte der arabischen Welt. RECLAM, Stuttgart.
Sezgin, Fuat (2003): Einführung in die Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften. Wissenschaft und Technik im Islam, Bd. I., Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Universität Frankfurt/M.
Singer, Hans-Rudolf (1991): Der Maghreb und die Pyrenäenhalbinsel bis zum Ausgang des Mittelalters. In: Haarmann, Ulrich (1991), S. 264-322.
Soltani, Zakariae (2016): Orientalische Spiegelungen. Alteritätskonstruktionen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Orients vom Spätmittelalter bis zur klassischen Moderne. LIT-Verlag Dr. W. Hopf, Berlin.
Speer, Andreas (2006): Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter. In: Speer/Wegener (2006), S. XIII-XXIII.
Speer, Andreas; Wegener, Lydia: (Hrsg. 2006): Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter (Miscellanea Mediaevalia, 33), Verlag de Gruyter, Berlin und New York.
Steiner, Heinrich (1865): Die Mutaziliten oder die Freidenker im Islam. Ein Beitrag zur Allgemeinen Culturgeschichte. S. Hirzel Verlag Leipzig [Reprint 2017 in India by Facsimile Publisher , 12 Pragati Market, Ashok Vihar, Ph-2, Delhi- 110052].
Strohmaier, Gotthard (2006): Die geistigen und gesellschaftlichen Bedingungen der lateinischen Rezeption arabischen Wissens. In: Speer/Wegener (2006), S. 126-132.
Tolan, John (2019): Islam - dasselbe und das andere Europa. In: François, Èti- enne/Serrier, Thomas (Hrsg.): Europa. Die Gegenwart unserer Geschichte. WBG Darmstadt, S. 413-434.
Vones, Ludwig (2006): Zwischen Kulturaustausch und religiöser Polemik. Von den Möglichkeiten und Grenzen christlich-muslimischer Verständigung zur Zeit des Petrus Venerabilis. In: Speer/Wegener (2006), S. 217-237.
Watt, W. Montgomery (2002): Der Einfluss des Islam auf das europäische Mittelalter. Neuausgabe, 2. Aufl., Wagenbachs Taschenbuch 420, Berlin.
Weiss-Adamson, Melitta (2006): Ibn Gazla auf dem Weg nach Bayern. In: Speer/Wegener (2006), S. 357-376.
Wulf, Karl (2010): Bedrohte Wahrheit. Der Islam und die modernen Naturwissenschaften. GRIN Verlag.
Yousefi, Hamid Reza (2016): Einführung in die islamische Philosophie. Eine Geschichte des Denkens von den Anfängen bis zur Gegenwart. 2., überarbeitete Aufl., Wilhelm Fink Verlag, Paderborg (UTB-Band Nr. 4082).
[...]
1 Vgl. zum Beispiel Sylvain Gouguenheim 2011, WBG Darmstadt.
2 Vgl- Strohmeier, Gotthard: Die geistigen und gesellschaftlichen Bedingungen der lateinischen Rezeption arabischen Wissens. In: Speer/Wegener (2006), S. 131.
3 Vg. Renn, Jürgen (2022): Die Evolution des Wissens. Eine Neubestimmung der Wissenschaft für das Anthropozän, Suhrkamp.
4 Vgl. Sezgin, Fuat (2003), S. XI.
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Stubbe. (15.11.2019)
6 Der Gesellschaftsvertrag oder Grundlagen des Staatsrechts von Jean Jacques Rousseau, ins Deutsche übertragen von Fritz Roepke. In: http://www.welcker-online.de /Texte/Rousseau/Contract.pdf., S. 81. (15.11.2019)
7 http://theconversation.com/why-jeffersons-vision-of-american-islam-matters-today-97915. (16.11.2019)
8 Fittkau, Ludger: In: https://www.deutschlandfunk.de/johann-wolfgang-von-goethe-grosse- kenntnis-der-islamischen.886.de.html?dram:article_id=298559. (15.11.2019)
9 Formal handelt es sich bei Westrom nicht um einen eigenständigen Staat, sondern lediglich um die Westhälfte des unteilbaren Imperium Romanum: vgl. zum Folgenden https://de.wikipedia.org/wiki/Weströmisches _Reich. (29.10.17)
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Justinian_I. (09.03.2018)
11 Zitiert in: ebenda.
12 https://de.wikipedia.org/wiki/Bücherverbrennung. (09.03.2018)
13 wikipedia.org/wiki/Bücherverluste_in_der_Spätantike. CC BY-SA 3.0. File:Bibsta4.jpg. Der ursprünglich hochladende Benutzer war Bibhistor in der Wikipedia auf Deutsch - Übertragen aus de.wikipedia nach Commons durch PHansen. (01.12.2018)
14 Vgl. „Die Finsternis frühchristlicher Naturwissenschaftsfeindlichkeit“, in: Mann/Mann (2018), S. 35 ff.
15 15 www.mittelalter.wikia.com/wiki/Wissenschaften.
16 Vgl. dazu in aller Ausführlichkeit Mazal 2006, I, II.
17 Vgl. zum Folgenden Cobb 2015, S. 27 ff.
18 Aus Kettermann 2001, S. 66.
19 http://www.weltkulturerbe.com/weltkulturerbe/europa/cordoba.htm (30.01.2018)
20 https://de.wikipedia.org/wiki/Mezquita-Catedral_de_Córdoba. (30.01.2018)
21 http://www.zeit.de/2011/25/Al-Andalus. (30.01.2018)
22 Diese assyrische nestorianische Familie wird auch unter dem Namen „Bukhtishu“ geführt. Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Bukhtishu. (05.02.2018)
23 Kallfelz (1995, 102).
24 https://de.wikipedia.org/wiki/Akademie_von_Gundischapur. (06.02.2018)
25 https://de.wikipedia.org/wiki/HunainJbnJshäq. (07.02.2018)
26 https://de.wikipedia.org/wiki/Persisch-arabisch-islamische_Medizin. (30.01.2018)
27 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Blütezeit_des_Islam. (3001.2018)
28 Die von Kettermann an anderer Stelle aufgeführten Gelehrten der Religionswissenschaften werden hier nicht aufgeführt.
29 Die Daten stammen mehrheitlich von al-Khalili 2016, S. 409 ff. sowie aus den aufgeführten Wikipedia-Quellen.
30 https://de.wikipedia.org/wiki/Galenos. (29.12.2018)
31 https://de.wikipedia.org/wiki/Hunain_ibn_ Ishaq. (03.02.2018)
32 https://de.wikipedia.org/wiki/Rhazes. (02.02.2018)
33 https://de.wikipedia.org/wiki/Abulcasis. (03.02.2018)
34 https://de.wikipedia.org/wiki/Avicenna. (02.02.2018)
35 Ebenda.
36 https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Wafid. (04.02.2018)
37 https://teil2einfachesleben.wordpress.com/tag/ibn-alwafid/. (04.02.2018)
38 https://www.lesejury.de/jochem-straberger-schneider/buecher/der-kitab-al-adwiya-al-mufrada- des-abu-l-mutarrif-ibn-wafid-und-der-liber-aggregatus-in-medicinis-simplicibus-des-pseudo- serapion/9783736995710. (04.02.2018)
39 https://de.wikipedia.org/wiki/Ibn_AbT_Usaibi'a (15.10.2018); Sezgin 2003, 51.
40 https://de.wikipedia.org/wiki/Ibn_an-Nafis. (14.10.2018)
41 https://de.wikipedia.org/wiki/Persisch-arabisch-islamische_Medizin. (15.10.2018)
42 https://de.wikipedia.org/wiki/Persisch-arabisch-islamische_Medizin.(15.10.2018)
43 Die Null wird bei den Arabern als sifr bezeichnet, woraus das Lehnwort Ziffer entstand. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Indische_Zahlschrift. (26.10.17)
44 www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/roemische-zahlen-rechenhemmnis-aus-der-antike-a- 617902.html (25.10.17).
45 Vgl. Kaske, Rainer (2001): Quadratische Gleichungen bei al-Khwarizmi. Überarbeitete PDFVersion, S. 1-14. Aus: http://www.raikas.net/alkh.pdf, (25.10.17).
46 Vgl. ebenda, S. 13.
47 https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Haddschadsch_ibn_Yusuf_ibn_Matar. (04.02.2018)
48 Die beste Übersetzung verdanken wir Ishaq ibn Hunayn, dem Sohn des Meisterübersetzers Hunain ibn Ishaq; so zitiert aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Almagest. (04.02.2018)
49 https://de.wikipedia.org/wiki/Thabit_ibn_Qurra. (13.10.2018]
50 https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Battani. (04.02.2018)
51 Zitat aus: https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Battani. (04.02.2018)
52 https://de.wikipedia.org/wiki/Alhazen. (02.02.2018)
53 https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni. (08.03.2018). Vgl. auch Mazal 2006-II, 38, 95, 106, 212.
54 https://www.spektrum.de/magazin/al-biruni-ein-gelehrter-den-das-abendland-uebersah/82757. (09.10.2018)
55 https://de.wikipedia.org/wiki/Az-Zarqali. (14.10.2018)
56 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/ NasTr_ad-DTn_at-TüsT (07.10.2018).
57 https://de.wikipedia.org/wiki/ Hülegü (07.10.2018).
58 https://de.wikipedia.org/wiki/Ibn_asch-Schatir (07.10.2018).
59 https://islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Khafri_BEA.htm, aus: Thomas Hockey et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer Reference. New York: Springer, 2007, pp. 623624 (07.10.2018).
60 Ebenda.
61 https://de.wikipedia.org/wiki/Dschamschid _Mas'ud_al-Kaschi. (16.10.2018)
62 Sehr differenziert wird die arabisch-islamische Philosophie behandelt in dem Sammelband von Eichner et al.( 2017) sowie von Al Daghistani (2016) sowie Hendrich (2011).
63 https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Kindi_(Philosoph). (04.02.2018)
64 https://de.wikipedia.org/wiki/Al-FäräbT. (06.04.2020)
65 https://en.wikipedia.org/wiki/Said_al-Andalusi. (24.02.2018)
66 https://books.google.de/books/about/Science_in_the_Medieval_World. html?id=2xfKk2MJ0f8C&redir_esc=y. (24.02.2018).
67 https://de.wikipedia.org/wiki/Averroes. (03.02.2018)
68 https://en.wikipedia.org/wiki/Averroes (03.02.2018)
69 Andreas Speer in: http://www.deutschlandfunk.de/averroes-vordenker-einer-islamischen- aufklaerung-gott-und.886.de.html?dram:article_id=343718. (03.02.2018)
70 https://de.wikipedia.org/wiki/Maimonides. (03.02.2018)
71 Cavuldak, Ahmet, in: https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status= init&vmfile=no&publishid=109981&moduleCall=webInfo&publishConfFile =webInfo&publishSubDir=veranstaltung. (04.02.2018)
72 https://de.wikipedia.org/wiki/Ibn_ Chaldün. (16.10.2018)
73 https://de.wikipedia.org/wiki/Silvester_II. (11.02.2018)
74 https://de.wikipedia.org/wiki/Adelard_von_Bath. (11.02.2018)
75 https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Afrikaner. (11.02.2018)
76 https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Chester. (12.02.2018)
77 https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Ketton. (12.02.2018)
78 https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Carinthia. (12.02.2018)
79 http://www.ruhr-uni-bochum.de/klass-phil/Projekte/machumet.htm. (16.02.2018)
80 https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_von_Santalla. (12.02.2018)
81 https://de.wikipedia.org/wiki/Petrus_Alfonsi. (12.02.2018)
82 Eine ähnliche Kritik übt nach Ricklin [2006, 64] auch Plato von Tivoli im Vorwort seiner Übersetzung von al-Battanis‘ De sciencia stellarum: ...“Die unsrigen, d.h. die Lateiner, haben nicht einen einzigen Autor. An Stelle von Büchern haben sie Phantastereien, Träume und Ammenmärchen.“
83 https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_ibn_Daud. (13.02.2018)
84 https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hispalensis. (13.02.2018)
85 https://en.wikipedia.org/wiki/Qusta_ibn_Luqa. (28.02.2018)
86 https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Scotus. (13.02.2018
87 https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_von_Cremona. (13.02.2018)
88 https://de.wikipedia.org/wiki/Petrus_Venerabilis. (16.02.2018)
89 https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Ketton. (16.02.2018)
90 https://de.wikipedia.org/wiki/Petrus_Venerabilis. (16.02.2018)
91 Vgl. Hasse 2006, S. 75, Fußnote 41.
92 https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_X._(Kastilien). (17.02.2018)
93 https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._(HRR). (16.02.2018)
94 Aus: Hasse 2015, S. 159. Eigene Zusammenstellung aus Osman 2010 und Kettermann 2001
95 http://www.inst.at/trans/16Nr/06_1/matta16.htm. „Hilda Matta: Sprachkontakte über die Jahrhunderte. Eine Darstellung der interlingualen und sprachlichkulturellen Beziehungen zwischen dem Arabischen und den europäischen Sprachen“.(21.02.2018)
96 Um 150 n.Chr. dokumentiert Ptolemäus die griechischen Sternbezeichnungen. Um 800 n.Chr. übersetzen die Araber diese, ändern sie teilweise und benennen Sterne neu. Ab 1115 werden die arabischen Namen in die europäischen Sprachen (teilweise fehlerhaft) übernommen: http://www.astronomie-tagebuch.de/sterne.php. (23.02.2018)
97 http://www.astronomie-tagebuch.de/sterne.php (27.01.2018)
98 https://de.wikipedia.org/wiki/Al- Ghazali. (17.10.2018)
99 https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Kopernikus. (23.10.2018)
100 https://de.wikipedia.org/wiki/Domenico_Maria_da_Novara. (26.10.2018)
101 Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1162 (1991), Nr. 6.
102 https://20000lenguas.com/2015/01/11/mas-de-4000-palabras-en-castellano-tienen-origen- arabe/. (28.03.2017)
103 https://de.wikipedia.org/wiki/Maurischer_Stil. (28.02.2018)
104 Speer 2006, XV.
105 Speer 2006, XXII, XIX.
106 https://de.wikipedia.org/wiki/Accademia_Nazionale_dei_Lincei. (30.11.2018)
- Quote paper
- Reinhard Czycholl (Author), 2025, Islam. Der kulturell-szientifische Einfluss der arabischsprachig-islamischen Welten auf das christliche Abendland (750 -1700), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1553225