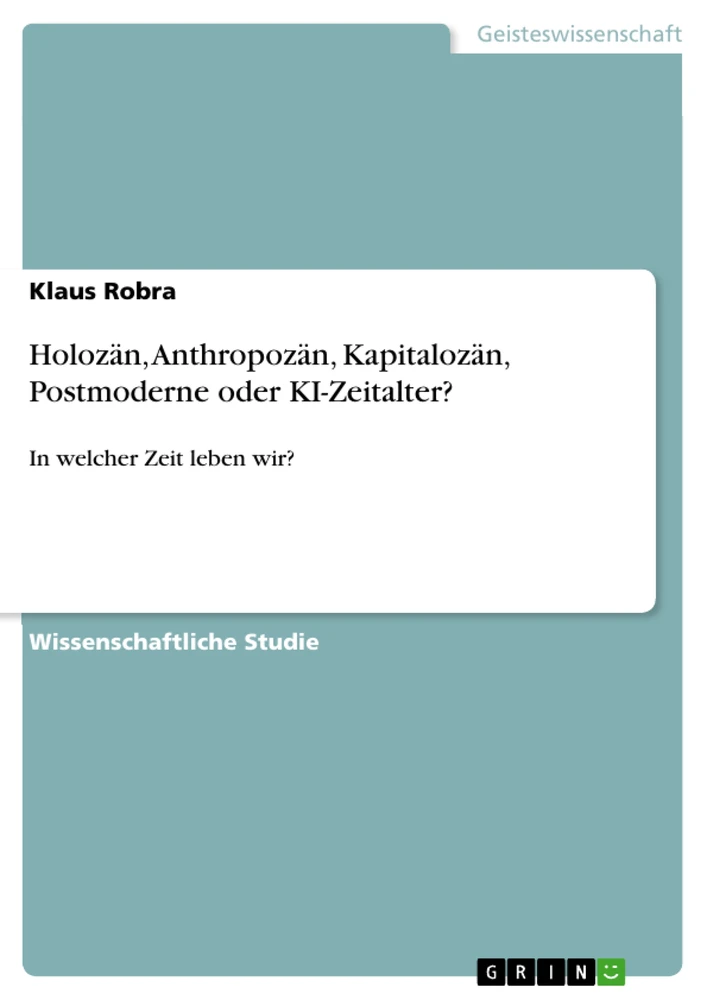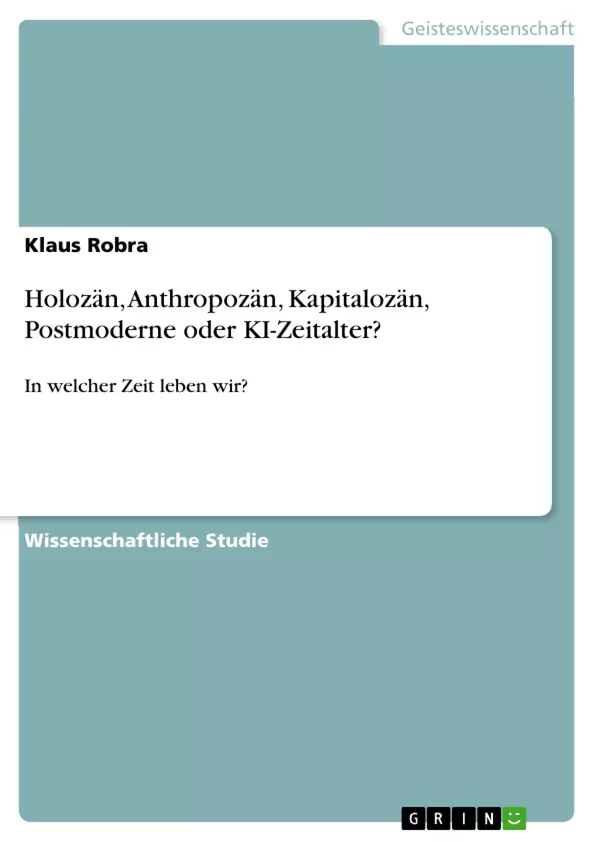Dieser wissenschaftliche Aufsatz beleuchtet die Frage, wie unsere gegenwärtige Zeit aus einer philosophischen Perspektive definiert werden kann. Dabei werden verschiedene Begriffe wie Holozän, Anthropozän, Kapitalozän, Postmoderne und das KI-Zeitalter diskutiert. Die philosophische Reflexion orientiert sich an Hegels Idee von Vernunft und Wirklichkeit, um die Beziehung zwischen Geschichte, Zeit und menschlichem Handeln kritisch zu hinterfragen. Ziel des Textes ist es, den Begriff der Wirklichkeit neu zu interpretieren und die Spannungsfelder zwischen Vernunft und Unvernunft in der Geschichte sichtbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zu den Zeit-Bezeichnungen im Einzelnen
1. Holozän
2. Anthropozän
3. Kapitalozän
4. Postmoderne
5. KI-Zeitalter
Zur Kritik an den Zeit-Bezeichnungen
Holozän
Anthropozän
Kapitalozän
Postmoderne
KI- Zeitalter
Fazit und Ausblick
Schlusswort
Literaturhinweise
Einführung
Die im Untertitel gestellte Frage impliziert eine philosophische Frage, und zwar danach, wie unsere gegenwärtige Zeit bestimmt werden kann. Wobei mit dieser Zeit natürlich nicht nur die z.B. in Sekunden und Minuten messbare Zeit gemeint ist, sondern vor allem die des geschichtlichen Inhalts, die zugleich als Rahmen und als Medium jeglicher Erkenntnis und Erklärung dient. Was an Hegel s Definition erinnert, wonach Philosophie „ihre Zeit, in Gedanken erfasst“ sei.1 Der Kontext dieser aus den Grundlinien der Philosophie des Rechts (von 1820) stammenden Definition lautet:
„Das was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie, denn das was ist, ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit; so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt.“(a.a.O. ebd.)
Was allerdings nicht bedeutet, dass Hegel auf Geschichtsphilosophie verzichtet, im Gegenteil. In der Geschichte waltet, so Hegel, von Anfang an „die Vernunft“ – als „Vernunft in der Geschichte“ –, und die Vernunft sei von Anfang an identisch mit aller Wirklichkeit. („Das Wirkliche ist vernünftig, und das Vernünftige ist wirklich.“) – Was aber nachweislich einseitig bzw. falsch ist! Träfe es zu, wäre es ein Hohn auf die zahllosen Opfer von Kriminalität und Bosheit, die sich auch mit Hegels „List der Vernunft“ nicht leugnen lassen. Wenn aber die Wirklichkeit nicht nur vernünftig, sondern auch unvernünftig ist, muss der Be- griff Wirklichkeit – als von der Zeit getragene und durchdrungene Grundlage jeglicher Erklärung (s.o.) – anders begründet werden.
Hegel führt Vernunft auf das „Vernehmen“ des Göttlichen zurück und lässt dabei außer Acht, dass es Wirklichkeit schon Milliarden von Jahren vor der Entstehung des Menschen und seiner Ideen gegeben hat; so dass es illusorisch ist, die gesamte Wirklichkeit aus Ideen und Begriffen ableiten und erklären zu können, wie Hegel es vermeint und dadurch schließlich wieder bei dem landet, was er überwinden wollte: bei Kants Apriorismus des Denkens.
Um solche Zirkularität zu vermeiden, kommt es vorrangig darauf an, den Begriff ‚Wirklich-keit‘ zu klären. Bekanntlich hat Meister Eckhart (ca. 1260-1327) den Begriff in den deut-schen Sprachgebrauch eingeführt, und zwar durch eine Übersetzung des von Aristoteles (ca. 384-322 v.Chr.) geprägten Begriffs ‚energeia‘, der so viel bedeutet wie ‚im Werk-, im Wirken-Sein‘. Es ist ein Wirken, das anscheinend überall im Universum anzutreffen ist, und zwar wohl auch schon im Big Bang, dem „Urknall“. Denn in den Elementar-Teilchen, die im Big Bang entstanden sind, lässt sich ein Wirken schon daran erkennen, dass sie sich in ständiger Bewegung befinden, die ohne eine bewirkende Triebkraft kaum vorstellbar ist. Der Leitsatz hierzu lautet: „Die Teilchen eines Stoffes sind in ständiger Bewegung.“2
Es genügt also nicht, auf den Big Bang (den vermuteten Anfang des Universums) zu rekur-rieren und dabei mit „einer Unterscheidung“ zu beginnen, wie dies David J. Krieger (1996, S. 11) vorschlägt. Entscheidend ist vielmehr die Einsicht, dass die Wirklichkeit – auch die der E-Teilchen – tatsächlich erschlossen werden kann, wenn auch nur in Ausschnitten, und zwar nicht bloß durch die Ableitung aus Ideen, sondern durch die Bestimmung wesentlicher, spezifischer Merkmale und Eigenschaften eines Gegenstandes.
Im Falle der E-Teilchen gehört zu diesen Eigenschaften neben der auf Triebkraft beruhenden Bewegung die Tatsache, dass diese Teilchen stets bestrebt sind, sich mit anderen zu verbinden, so dass neue atomare und molekulare Synthesen (z.B. chemische Elemente) entstehen. In beiden Fällen handelt es sich um Entelechie, Zweck- und Zielgerichtetheit. Demgemäß empfiehlt es sich, den Begriff Wirklichkeit mit dem der Information zu verbinden. In Natur und Geschichte in-formieren Gegenstände sich und ihre Umgebung aktiv und passiv über ihren Zustand – und umgekehrt. Und besser verständlich wird nunmehr auch, warum Aristoteles den Begriff ‚energeia‘ (s.o.) häufig als Synonym von ‚entelechia‘ verwendet hat.
‚Wirklichkeit‘ ist übrigens der umfassende Begriff, der auch den Begriff ‚Realität‘ enthalten kann. ‚Realität‘ bezieht sich auf die Objektwelt, soweit diese beobachtet wird bzw. beobachtet werden kann. Schon vom Wortursprung her verweist ‚Realität‘ auf die Sach- und Dinghaftig-keit der Objektwelt. Das Subjekt ist Person und keine Sache, obwohl es über mentale Objekte und (vor allem sprachliche) Referenz-Objekte verfügt. ‚Wirklichkeit‘ kann sich sowohl auf alles Subjektive als auch auf alles Objektive beziehen und umfasst somit auch den Bedeutungs-Radius des Begriffs ‚Realität‘. Zumal ‚Energeia‘ und Entelechie sowohl in subjektiver als auch in objektiver Wirklichkeit auftreten.
Die Zeit aber liefert den Inhalt, den Rahmen und das Medium für die jeweils zu erklärende ge-schichtliche Wirklichkeit. Womit noch nicht geklärt ist, wie unsere Zeit tatsächlich beschaffen ist, worin ihre Wesensmerkmale bestehen. Und hieran ändert auch nichts die im Haupttitel dieser Abhandlung enthaltene Aufzählung unterschiedlicher Bezeichnungen für unsere Zeit, zumal diese Aufzählung ergänzt werden kann durch Begriffe wie Neuzeit, Öl-, Industrie-, Technik-, Medien-Zeitalter usw., in denen jedoch das für unsere Gegenwart Typische und Wesentliche nicht recht zum Ausdruck kommt. Wie aber steht es mit den übrigen im Haupt-titel genannten Begriffen? Diese unterscheiden sich, kurz gefasst, wie folgt voneinander: 1. ‚Holozän‘ ist der geologische Grundbegriff, der sich auf die ca. 10.000 Jahre Erdgeschichte seit dem Ende der letzten Eiszeit bis zur Gegenwart bezieht. 2. ‚Anthropozän‘ stellt den Menschen in den Mittelpunkt, und zwar als Haupt-Verursacher der weltweiten Öko- und Klima-Krise. 3. ‚Kapitalozän‘ bedeutet so viel wie „Herrschaft des Kapitals“, deren Beginn, ähnlich wie der des Anthropozäns, auf das späte 18. Jahrhundert datiert wird. 4. ‚Post-moderne‘ wurde als neuer Begriff im 20.Jahrhundert geprägt und steht vor allem für die Vergleichgültigung der vorherigen Tradition. 5. ‚KI-Zeitalter‘ gilt seit Beginn des 21. Jahr-hunderts als gängige Bezeichnung für die Tatsache, dass die Künstliche Intelligenz in nahezu sämtliche unserer Lebensbereiche vordringt – dazu mit der beunruhigenden Perspektive einer „Singularity“ (R. Kurzweil), in der im Jahr 2045 superintelligente KI-Roboter den Menschen ersetzen sollen, um sodann den gesamten Kosmos zu erobern.
Zu den Zeit-Bezeichnungen im Einzelnen
1. Holozän
Hierzu heißt es im ‚Lexikon der Geowissenschaften‘:
„Holozän, Postglazial, Nacheiszeit, Alluvium (veraltet), der von H. Gervais 1867 benannte, jüngere Abschnitt (Epoche) des Quartärs (OIS 1), auf das Pleistozän folgend und von 10.000 Jahre v.h. (bei Zugrundelegung der Jahresschichtung, z.B. der grönländischen Eisbohrkerne 11.500 Jahre v.h.) bis in die Gegenwart reichend. Das Holozän umfaßt die nacheiszeitliche Warmzeit. Es ist gekennzeichnet durch die Wiedererwärmung des Klimas seit dem Ende der letzten Eiszeit mit der entsprechenden Entwicklung der Vegetation und durch marine Transgressionen im Nord- und Ostseegebiet. Das Holozän ist die Zeit der Entwicklung der Menschheit vom Jungpaläolithikum bis in die Gegenwart.“3
Es ist, wie gesagt, der unentbehrliche geologische Grundbegriff einer Periodisierung der Zeit.
2. Anthropozän
Laut Wikipedia ist ‚Anthropozän‘ ein „Kofferwort“, zusammengesetzt aus den altgriechi-schen Bezeichnungen für ‚Mensch‘ und ‚neu‘. Den Begriff erstmals vorgeschlagen hat der Naturwissenschaftler Paul Cruxen im Jahr 2000. Bezeichnet werden soll die Tatsache, dass der Mensch seit dem 18. Jahrhundert immer mehr als derjenige hervorgetreten ist, der die weltweite Öko-Krise verursacht und zu verantworten hat. – In einem Artikel der Bundes-zentrale für politische Bildung heißt es dazu:
„Urbanisierung, Ressourcenknappheit, Artensterben, Ozeanversauerung, Boden-erosion: Der Mensch ist spätestens seit der industriellen Revolution zum bestimmen-den Faktor für das globale Ökosystem geworden. Umweltauswirkungen betreffen den ganzen Planeten und sind mit allen Geoprozessen der Erde verwoben. Im Konzept des Anthropozäns als Zeitalter des Menschen handelt dieser immer im planetaren Maßstab: Kann der Mensch seiner Verantwortung gerecht werden und den von ihm selbst geschaffenen Risiken begegnen? Führt der Begriff des Anthropozäns zu einem neuen Verständnis von Natur- und Umweltpolitik? Wie können Strategien für eine globale Nachhaltigkeitspolitik aussehen und wie können sie sich international durch-setzen? Welche Art von Wachstum ist im Anthropozän überhaupt möglich und wie kann soziale Gerechtigkeit im globalen Zusammenhang gestaltet werden?“4
Mögliche Antworten auf Fragen dieser Art finden sich in einem Artikel des Researchgate s:
„Letztlich geht es darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir alle Teil eines großen vernetzten Systems sind, in dem nichts, was wir tun, ohne Folgen bleibt. Denn wir sind längst durch und durch globalisiert, ob wir das wollen oder nicht. Lange bevor wir uns über Telefon und Internet mit den entlegensten Winkeln der Welt verbinden konnten, waren unsere Körper schon kosmopolitisch.
Im Anthropozän könnte angesichts der drohenden Umweltkatastrophe der Durchbruch zu einer besseren, gerechteren Welt gelingen, wenn sich das Bewusstsein durchsetzt, dass wir Probleme auf internationaler Ebene wie Klimawandel, Migration, Ener- giesicherung, Lebensmittel- und Ressourcenverteilung nur miteinander und nicht gegeneinander lösen können. Das setzt die Überwindung nationaler Egoismen, ein Umsteuern der Ökonomie hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise und ein hohes Verantwortungsbewusstsein des einzelnen Verbrauchers in den Industrieländern voraus.
Die WBGU-Experten setzen neben verbindlichen internationalen Abkommen auf eine »Weltbürgerbewegung« als Motor für die zukünftige Politik. »Was wir vor allem brauchen«, sagt der Geobiologe Reinhold Leinfelder, »ist so etwas wie ein behut-sames, selbstkritisches gärtnerisches Gestalten der Welt, das die Komplexität des Gesamtsystems im Blick hat.“5
3. Kapitalozän
Statt ‚Anthropozän‘ wurde inzwischen der Begriff ‚Kapitalozän‘ vorgeschlagen, um zum Ausdruck zu bringen, dass nicht einfach „der Mensch“, sondern die Dauerkrise des Kapita-lismus (Marx) – bis hin zum globalisierten Neoliberalismus – die Öko-Krise verursacht hat. Dazu schreibt Jason W. Moore:
„Wir leben im Zeitalter der kapitalogenen Klimakrise, kapitalogen im Sinne von »vom Kapital gemacht«. Wie das verwandte Kapitalozän mag es zunächst etwas plump klingen. Das hat jedoch wenig mit dem Wort zu tun – das System bürgerlicher Herrschaft hat uns gelehrt, den Begriffen zu misstrauen, die das System der Unter-drückung beim Namen nennen. Doch genau das ist seit jeher die Praxis emanzi-patorischer Bewegungen. Sie schöpfen ihre Kraft aus neuen Ideen und einer neuen Art des Sprechens über die Dinge. Das verleiht Macht und intellektuelle sowie strategische Orientierung. In dieser Hinsicht war der Mainstream-Ökologismus, der ab 1968 einsetzte – die »Umweltbewegung der Reichen« (Peter Dauvergne), ein Desaster. Der Fokus auf den »ökologischen Fußabdruck« lenkte die Aufmerksamkeit auf den individuellen Konsum. Der Begriff Anthropozän legt nahe, die planetarische Krise sei eine natürliche Folge der menschlichen Natur – als rührte sie daher, dass Menschen halt handeln wie Menschen, so wie Schlangen Schlangen sind und Zebras Zebras. Die Wahrheit ist offensichtlich nuancierter: Wir leben im Kapitalozän, im Zeitalter des Kapitals. Wir wissen ziemlich genau, wer für die heutigen und vergange-nen Krisen verantwortlich ist. Die Verursacher*innen haben Namen und Adressen, angefangen bei den acht reichsten Männern der Welt, die mehr Vermögen besitzen als die ärmsten 3,6 Milliarden der Weltbevölkerung.“6
Dass allerdings auch der Begriff Kapitalozän verfänglich ist, zeigt die Art und Weise, wie Harald Lesch mit ihm umgegangen – und anscheinend fehlgegangen ist. Hierzu schreibt Nikolaus Gietinger (2021) in einem Kommentar zu einer TV-Sendung:
„ Lesch führt bald den Begriff des „Anthropozän“ ein, und dass wir mit der Industriellen Revolution in ein neues Zeitalter gekommen sind, in dem die Menschen die Natur massiv beeinflussen. Interessanterweise schlägt Lesch gleich darauf vor, doch lieber vom Kapitalozän zu sprechen: „Das ist das Erdzeitalter des Geldes. Das ist die Art und Weise, wie wir etwas bewerten.“ Wirklich erklärt wird der Begriff und sein Ursprung aber nicht. Merk-würdigerweise wäre genau hier der Zeitpunkt sich als Wissenschaftler mal mit dem Begriff und seiner Geschichte genauer auseinanderzusetzen. Für den berühmten Theoretiker Karl Marx, dem der Begriff „Kapital“ große Bekanntheit verdankt, ist das Kapital mehr als einfach nur Geld.
Es ist vielmehr der selbstbezügliche Kreislauf, aus Geld mehr Geld zu machen. Dazu müssen immer mehr Waren produziert und zu diesem Zweck immer mehr menschliche Arbeit in den Prozess der Kapitalverwertung einsaugt werden. Diese Arbeit, die dafür benötigt wird, nennt Marx „Wert“ und das Kapital ist für ihn nichts anderes als der Prozess der Wertverwertung, d.h. der selbstzweckhaften Vermehrung von „Wert“. Oder in anderen Worten: Aus Geld mehr Geld zu machen. Doch nur menschliche Arbeit kann Wert schaffen. Dieser ewige Kreislauf führt zum maßlosen Abbau von Ressourcen und der Zerstörung der Natur. Die Folgen dieses Prozesses können wir derzeit anhand des Klimawandels bewundern.
Was Lesch somit auf der Oberfläche erkennt, hat tieferliegende Gründe, die es erst zu ergründen gilt, möchte man eine wissenschaftlich-theoretische Erklärung für die Profitgier der Menschen haben. Diese Selbstzweckbewegung, das „automatische Subjekt“ wie Marx es nennt, zerstört jedoch nicht nur die Natur. Damit nicht genug unterwirft es unser gesamtes Leben dem ökonomischen Paradigma des Wachstums. Dafür muss möglichst viel ökonomisiert werden, was auch unserem Naturwissenschaftler auffällt:
„Das heißt, wir haben zum Beispiel in unserem Land Gebiete ökonomisiert, die wir niemals hätten ökonomisieren dürfen, unter anderem übrigens auch die Universitäten. Also der Begriff Wettbewerb ist bei der Suche nach Wahrheit zum Beispiel schwer zu verstehen. Also bei der Suche nach Wahrheit ist es ja keine Bundesliga-Saison, wo jemand am Ende des Jahres sagt: „Hier! Ich bin der Wahrheit am nahesten gekommen“. Im Gegenteil: Der ganze Forschungsprozess an Universitäten ist ja ein immerwährender, ein andauernder. Und gute Forschung zeichnet sich dadurch aus, dass eine gelöste Frage im Zweifel zwei neue Fragen aufmacht. Das heißt, es ist ein Prozess, der eigentlich nie zu Ende ist.“
So richtig die Erkenntnis ist, dass im Kapitalismus alles ökonomisch bewertet wird, so falsch und romantisch ist die Auffassung, früher sei das nicht so gewesen. Es ist eine typische Romantik nach den guten alten 50er und 60er Jahren, die auch Sarah Wagenknecht befallen hat und in der Linken nicht untypisch ist.
Leschs Forderungen für eine „nachhaltige Gesellschaft“ bleiben dann auch recht vage. Es solle einfach mehr in die erneuerbaren Energien investiert werden und das exponentielle Wachstum gestoppt werden. Außerdem zählt Lesch diverse staatliche Regularien auf. So könnte für jede Person ein CO2-Limit pro Jahr gesetzt werden, das nicht überschritten werden darf oder der CO2-Ausstoß wird in die jeweiligen Produkte eingepreist. Die Gesellschaft müsse das nur wollen. Diese Forderungen bleiben jedoch, ohne Rücksichtnahme auf den gesellschaftlichen Kontext, eine hohle Forderung, ein frommer Wunsch.
Dazu kommt, dass er unterstellt, innerhalb einer vom Kapital (als menschengemachte, aber gegenüber dem Menschen verselbständigten Dynamik) dominierten Gesellschaft seien Regulierungen der Produktion in einem sehr weitreichenden Maße tatsächlich umsetzbar. Wenn die Menschen nur genug guten Willen aufbrächten, sei das schon zu machen.
Leschs berechtigte Forderung nach mehr Humanismus wird jedoch radikal von der gesellschaftlichen Realität konterkariert. Im Kapitalismus geht es eben nicht um die Menschen, sondern um Profit. Möchte man eine Gesellschaft, die für die Menschen gemacht ist (wie sie im Humanismus postuliert wird), muss die gesellschaftliche Beziehung über den abstrakten Reichtum, die (abstrakte) menschliche Arbeit, überwunden werden. Da unsere Gesellschaft aber genau darauf basiert, wird das im Kapitalismus nicht funktionieren, sondern nur durch seine Überwindung. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der die Menschen sich über die sinnliche (oder auch stoffliche) Dimension des gesellschaftlichen Reichtums Gedanken machen und nicht über eine abstrakte Zahl, wie beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt.
Dabei ist Lesch zugute zu halten, dass er durchaus nachvollziehbare Vorstellungen präsentiert. Er kann auf einer technischen Ebene zeigen, dass bestimmte Technologien so eng mit dem Kapitalozän verbandelt sind, dass sie als Lösung für eine befreite Gesellschaft nicht taugen. Das gilt vor allem für seine Kritik am Elektroauto, aber auch für seine Kritik an der Atomenergie.
Etwa wenn er die Auffassung kritisiert, Elektroautos seien eine sinnvolle Alternative zum Verbrennungsmotor. Lesch möchte stattdessen weg vom Individualverkehr und fordert einen flächendeckenden und günstigen öffentlichen Nahverkehr. Außerdem wehrt er sich vehement gegen eine These aus dem Publikum, nach der das Bevölkerungswachstum, also die ehemaligen Kolonien, schuld am Klimawandel seien. Der Ressourcenverbrauch der westlichen Industrieländer ist nämlich laut Lesch deutlich höher als der in der restlichen Welt. Eine Kritik an der Überbevölkerungsdebatte ganz in diesem Sinne findet sich übrigens bei Tomasz Konicz in seinem Buch „Klimakiller Kapital“ sowie in dem Text von Julian Bierwirth in dem Sammelband „Shutdown“ zur Klimakrise.
Die Ignoranz gegenüber der gesellschaftlichen Ebene kritisierte Karl Marx mit dem Begriff des „Fetischismus“. Wird diese Beziehung nicht wahrgenommen, erscheint es so, als könne lediglich das Handeln der Menschen die Wogen glätten, vor allem das der Firmenchefs und Politiker. Harald Lesch könnte sich von seinem großen Idol, dem bekannten Idealisten Immanuel Kant, inspirieren lassen und den Weg aus „der selbstverschuldeten Unmündigkeit“ gehen, indem er sich mit Gesellschaftswissenschaft, der Moderne und ihren ganzen Unannehmlichkeiten beschäftigen würde.“7
4. Postmoderne
In einem Internet-Artikel aus Kunst 101 wird hierzu angeführt:
„Was ist Postmoderne?
Die Postmoderne ist ein Begriff, der eine kulturelle, intellektuelle und künstlerische Bewegung beschreibt, die im späten 20. Jahrhundert aufkam und bis heute anhält. Sie kann als eine Reaktion auf die Modernität betrachtet werden, wobei sie deren Ideale und Prinzipien in Frage stellt und oft parodiert oder dekonstruiert.
Im Gegensatz zur Moderne, die Rationalität, Fortschritt und Objektivität betonte, zeichnet sich die Postmoderne durch Skepsis gegenüber Großnarrativen, Relativismus und Fragmentierung aus. Hier sind einige Merkmale der Postmoderne:
1. Relativismus: Die Postmoderne hinterfragt absolute Wahrheiten und Betrachtungsweisen. Sie legt Wert darauf, dass Wahrheit und Realität von persönlichen, kulturellen und historischen Perspektiven abhängig sind.
2. Fragmentierung und Pluralismus: Statt einer einheitlichen kulturellen Identität gibt es eine Vielzahl von Identitäten und Perspektiven, die nebeneinander existieren. Kulturelle Produktionen können aus einer Vielzahl von Einflüssen und Stilen stammen.
3. Ironie und Parodie: Die Postmoderne verwendet oft Ironie und Parodie, um kulturelle Phänomene zu kommentieren oder zu kritisieren. Sie spielt mit Konventionen und erwarteten Normen, um Bedeutung zu hinterfragen.
4. Konsumkultur: Die postmoderne Gesellschaft wird oft als von Konsum geprägt beschrieben. Massenmedien, Werbung und Popkultur spielen eine wichtige Rolle in der Konstruktion von Identität und Bedeutung.
5. Intertextualität: Postmoderne Kunst und Literatur sind oft intertextuell, das heißt, sie beziehen sich auf und verweisen auf andere Werke, sei es durch direkte Zitate, Anspielungen oder Referenzen.
6. Hybridität und Mischung: Traditionelle künstlerische Grenzen und Kategorien werden in der Postmoderne oft aufgelöst. Es entstehen Mischformen und Hybride, die verschiedene Genres, Stile und Medien kombinieren.
7. Spiel mit dem Authentischen: Die Postmoderne hinterfragt den Begriff des Authentischen und die Idee eines einzigartigen, unverfälschten Ausdrucks. Sie spielt oft mit Simulation und Fälschung.
Insgesamt kann die Postmoderne als eine Zeit der Unsicherheit und des Umbruchs betrachtet werden, in der alte Gewissheiten in Frage gestellt werden und neue Formen des Ausdrucks und der Bedeutungssuche entstehen. Sie hat einen tiefgreifenden Einfluss auf verschiedene Bereiche der Kunst, Kultur, Philosophie und Gesellschaft.
Die Begriffe “Moderne” und “Postmoderne” bezeichnen zwei unterschiedliche Epochen und kulturelle Bewegungen, die jeweils verschiedene Ansichten, Werte und künstlerische Ausdrucksformen hervorgebracht haben. Hier sind einige wesentliche Unterschiede zwischen Moderne und Postmoderne:
1. Zeitliche Einordnung:
Die Moderne erstreckte sich grob vom späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert, während die Postmoderne ab den späten 1940er oder frühen 1950er Jahren bis heute dauert.
2. Werte und Ideale:
Die Moderne war geprägt von Glauben an Fortschritt, Rationalität, Individualismus und Universalismus. Sie betonte oft Objektivität und die Suche nach allgemeingültigen Wahrheiten.
Die Postmoderne hinterfragt diese Werte und Ideale der Moderne und betont stattdessen Relativität, Subjektivität und Pluralismus. Sie kritisiert die Idee eines linearen Fortschritts und betont die Vielfalt und Komplexität der menschlichen Erfahrung.
3. Künstlerische Ausdrucksformen:
In der Moderne dominierten oft abstrakte, geometrische Formen und klare Linien in der Malerei und Skulptur. Die Moderne umfasste Bewegungen wie Kubismus, Futurismus, Konstruktivismus und abstrakten Expressionismus.
Die Postmoderne führte zu einer Vielfalt von Stilen und Techniken in der Kunst, einschließlich der Wiederaufnahme figurativer Malerei und traditioneller Handwerkstechniken sowie der Verwendung von Collage, Appropriation und Ironie als künstlerische Strategien.
4. Narrative und Erzählformen:
In der Moderne wurde oft nach einer einheitlichen Erzählung oder einem Kernsinn gesucht. Moderne Literatur zeichnet sich oft durch klare Handlungsstränge und charakterbasierte Narration aus.
Die Postmoderne brach mit traditionellen Erzählkonventionen und experimentierte mit fragmentarischen Strukturen, Nichtlinearität und Metafiktion. Postmoderne Autoren spielten oft mit Ironie und Parodie und hinterfragten die Idee von Autorität und Authentizität.
5. Gesellschaftlicher Kontext:
Die Moderne war eng mit dem Aufkommen des Kapitalismus, der Industrialisierung und der Urbanisierung verbunden und prägte das moderne städtische Leben und die Massenkultur.
Die Postmoderne entwickelte sich in einer Zeit des Kalten Krieges, der Globalisierung und der technologischen Revolution. Sie reflektierte die Unsicherheiten und Ambivalenzen einer zunehmend vernetzten und fragmentierten Welt.
Insgesamt sind Moderne und Postmoderne komplexe und vielschichtige Epochen, die eine Reihe von kulturellen, intellektuellen und künstlerischen Entwicklungen hervorgebracht haben und die bis heute unsere Vorstellungen von Kunst, Literatur, Philosophie und Gesellschaft prägen.“8
5. KI-Zeitalter
Schwierigkeiten gibt es schon bei der Definition des Begriffs „Künstliche Intelligenz“, hauptsächlich wohl deshalb, weil Unklarheit über Inhalt und Umfang des Begriffs ‚Intelligenz‘ herrscht. Nicht verwunderlich ist es daher, dass auch die Definitionen des Begriffs KI divergieren. Bei Wikipedia (Artikel „Künstliche Intelligenz“) heißt es, die KI sei „ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem Maschinenlernen befasst“ (a.O. S. 1). Das Ziel der KI-Forschung sieht Claudia Niewels (2004, S. 105) darin, „kognitive Leistungen auf einer Hardware, auf der Informationsverarbeitungsprozesse genereriert werden können, zu erzeugen“, wobei die Hardware „nicht das menschliche Gehirn, sondern etwas aus funktionalistischer Sicht äquivalent Vorgestelltes – der Computer“ sei. In jedem Falle gehe es darum, die Erkenntnis-fähigkeiten des Menschen künstlich nachzubilden bzw. neu zu erzeugen und für den Menschen nutzbar zu machen. Wie weit dieser Ehrgeiz reichen kann, zeigt Bernhard Irrgang (2005, S. 130), wenn er feststellt: „KI will nicht Intelligenz simulieren, sondern Maschinen mit Geist bauen.“ Dies aber kann im Endeffekt nichts anderes bedeuten, als dass der Mensch sich selbst, nämlich seine umfassenden Subjekt-Objekt-Beziehungen (= Geist!) durch Maschinen (Roboter u.a.) ersetzen will. Mit kaum absehbaren Folgen.
Zu der Frage nun, ob Künstliche Intelligenz in der Lage ist, die Probleme des Anthropo-zäns/Kapitalozäns zu lösen, heißt es bei ‚Microsoft-Copilot‘:
„Die Probleme des Anthropozäns, einer Ära, in der menschliche Aktivitäten die dominierende Kraft für Umweltveränderungen sind, sind komplex und vielfältig. KI bietet jedoch vielversprechende Werkzeuge und Lösungen, um einige dieser Herausforderungen anzugehen:
1. Umweltüberwachung und Datenanalyse
KI kann große Datenmengen analysieren, um Umweltveränderungen zu überwachen und vorherzusagen. Dies umfasst Klimamodelle, Wettervorhersagen und die Überwachung von Ökosystemen. Solche Analysen können dabei helfen, fundierte Entscheidungen zum Umweltschutz zu treffen.
2. Nachhaltige Landwirtschaft
KI-gesteuerte Technologien können die Präzisionslandwirtschaft verbessern, indem sie den Einsatz von Wasser, Düngemitteln und Pestiziden optimieren. Dadurch wird die Effizienz erhöht und die Umweltauswirkungen der Landwirtschaft reduziert.
3. Energieeffizienz
KI kann zur Optimierung des Energieverbrauchs in verschiedenen Sektoren beitragen, von der Industrie bis hin zu Haushalten. Durch die Analyse von Nutzungsdaten können Energieversorger die Nachfrage besser vorhersagen und den Energieverbrauch reduzieren.
4. Kreislaufwirtschaft
KI kann Prozesse zur Wiederverwendung und zum Recycling von Materialien verbessern, wodurch die Abfallmenge reduziert und Ressourcen effizienter genutzt werden. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer Kreislaufwirtschaft.
5. Naturschutz und Artenvielfalt
KI-Technologien wie Bildverarbeitung und Drohnentechnologie können zur Überwachung und zum Schutz bedrohter Tierarten und ihrer Lebensräume eingesetzt werden. Dies hilft, die Artenvielfalt zu erhalten und Ökosysteme zu schützen.
Herausforderungen und Ethik
Trotz der vielversprechenden Ansätze müssen ethische und soziale Fragen berücksichtigt werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass KI-Technologien fair und transparent eingesetzt werden und dass sie nicht unbeabsichtigte negative Auswirkungen haben.
KI allein wird die Probleme des Anthropozäns nicht vollständig lösen können, aber sie kann ein mächtiges Werkzeug sein, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Der Schlüssel liegt in der verantwortungsvollen Nutzung und der Integration von KI in umfassende Strategien für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit.“
Zur Kritik an den Zeit-Bezeichnungen
Holozän
Der Begriff Holozän ist als geologischer bzw. erdgeschichtlicher Grundbegriff unentbehrlich, betrifft aber nicht die Besonderheiten des gegenwärtigen Zeitalters.
Anthropozän
Allgemein ist der Begriff nicht anerkannt worden. Dazu heißt es bei Wikipedia:
„In der geisteswissenschaftlichen Literatur ist das Konzept auf Kritik gestoßen. Das Anthropozän würde die Rolle des Menschen als aus der Natur herausgehobener Art betonen und gerade keine Alternative zur ungehemmten Umgestaltung der Erde durch den Menschen vermitteln. Im Gegenteil würden die bisherigen Eingriffe des Menschen in Naturkreisläufe zum Anlass oder als Rechtfertigung gebraucht, um – diesmal mit dem Anspruch der Reparatur – erneut, gezielt und mit größeren Zielen ökologische Steuerungsmechanismen zu beeinflussen. Vorschläge des Geoengi-neerings würden den Menschen endgültig zum Herrscher der Erde machen, auch wenn sie unter dem Aspekt der Verantwortung für frühere Eingriffe und die weitere Entwicklung kommuniziert würden.[…] Stattdessen wäre eine (Re-)Integration des Menschen in die natürliche Umwelt erforderlich, die gerade nicht mit einer heraus-gehobenen Stellung vereinbar sei.
In seiner Kritik an der Idee des Anthropozäns weist Jürgen Manemann darauf hin, dass dieses Konzept in einem Zivilisationsmodell gründe, das vom Machbarkeits- und Perfektibilitätswahn geprägt sei. Dies zeige sich nicht zuletzt an der inneren Dimension der Idee des Anthropozäns, die auf einen Trans- oder Posthumanismus ziele. Statt mehr Technik und mehr Wissen sei es nötig einen Kulturwandel einzu-leiten. Dazu müsste die Zivilgesellschaft in eine Kulturgesellschaft transformiert werden. Das Gegenkonzept zur Idee des Anthropozäns sei eine neue Humanökologie, die Wege zur kulturellen Erneuerung der Menschen aufweise und gleichzeitig daran mitwirke, kreativ neue Strukturen zu entwickeln, die helfen, Grundfähigkeiten zu entwickeln, die es Menschen ermöglichen, angesichts der Klimakatastrophe ein humanes Leben zu führen.“
Kapitalozän
Der Begriff kennzeichnet weitgehend die Besonderheiten des gegenwärtigen Zeitalters des Kapitalismus. Er ist allerdings zu differenzieren durch eine gründliche Analyse des globali-sierten Neoliberalismus und zu ergänzen durch Begriffe wie Anthropozän und KI-Zeitalter.
Postmoderne
An die Stelle jeglicher Festlegung setzen die Postmodernen die „Vergleichgültigung“ und würden daher auch keine Festlegung auf einen „gebrochenen Weltbezug“ akzeptieren. Dies mag einer der Gründe für die Kritik sein, die Walter Schulz (im Folgenden: W.Sch.) an ihnen übt. Aber vielleicht nicht der wichtigste, nicht der entscheidende. Denn W.Sch. trägt eine Reihe wohlbegründeter und zutreffender kritischer Argumente vor, denen er in Der gebrochene Weltbezug ein ganzes Kapitel mit der Überschrift „Kritische Einwände gegen die Postmoderne“ widmet (S. 148-156). Diese Einwände betreffen insbesondere die postmoderne „Vergleichgültigung“, und, noch gravierender, den postmodernen „Realitätsverlust“. Letzterer tritt dann ein, wenn man – wie Lyotard u.a. – das Subjekt-Sein des Menschen grundsätzlich in Abrede stellt. Und zwar in Verbindung mit der Leugnung elementarer, gesicherter wissen-schaftlicher und philosophischer Erkenntnisse zum Wesen der Sprache. Postmodernisten wollen nicht wahrhaben, dass die sprachlichen Bedeutungen von Signifikanten und Signifikaten tatsächlich existieren, nämlich in Form von objektiven Denotationen und Konnotationen (Grund- und Nebenbedeutungen) mit subjektiven Assoziationen. Die konven-tionalisierten Bedeutungen ermöglichen die genaue Bezeichnung von Sachverhalten, Ereignissen, Wesensmerkmalen und personalen Eigenschaften. Die Zusammenhänge von sprachlichen Formen, Inhalten und Referenz-Objekten können sehr wohl – auch und gerade im Sinne der Korrespondenztheorie der Wahrheit – überprüft werden; während die mit jedem Wort verbundenen subjektiven Assoziationen als Beleg dafür anzusehen sind, dass Sprache ohne sprechende Subjekte undenkbar ist, dass „doch jemand da sein muß, der die Sprache versteht und antwortet“, wie W.Sch. es ausdrückt.
Weitere Bastionen des Postmodernismus erweisen sich als brüchig: die „Vergleichgülti-gung“, die Wissenschaftskritik und die Negierung der Realität. Als Gegenpol gegen die Vergleichgültigung nennt W.Sch. die Verantowrtung. X-Beliebigkeit in jeder Lebenslage kann es nicht geben, weil lebenswichtige Unterscheidungen zwischen gut und schlecht, zuträglich und abträglich, vernünftig und unvernünftig zu treffen sind. So dass – entgegen postmoderner Kurzschlüssigkeit – auch auf den Vernunft-Begriff keineswegs verzichtet werden kann. Worüber immer wieder – auch und gerade in den Wissenschaften – das verantwortliche Subjekt zu befinden hat. Und zwar auch in den Naturwissenschaften, wozu W.Sch. erklärt:
„Das Subjekt bestimmt sich als wissendes allererst durch den Prozeß, und ebenso wird das Objekt erst im Prozeß herausgestellt, das heißt, beide, Subjekt und Objekt, oder noch genauer: die Verbindung von beiden, in der ihre Isolierung aufgehoben wird, das ist die eigentliche physikalische Welt.“9
Will sagen: Auch ohne metaphysische Überhöhung, z.B. im Sinne des idealistischen „Absoluten“, bleibt das Subjekt in den Wissenschaften entscheidend relevant (was W.Sch. u.a. durch Zitate von Max Planck und Werner Heisenberg illustriert).
Darüber hinaus verkennen die Postmodernen, dass es durchaus eine begreifbare Wirklichkeit gibt, und zwar nicht als platt „gegenständliche“, sondern, wie W.Sch. Max Planck zitierend hervorhebt, weil „mit dem Wort Wirklichkeit die Gesamtheit der Zusammenhänge bezeichnet wird, die sich zwischen dem formenden Bewußtsein und der Welt als einem objektivierbaren Inhalt ausspannen.“ (ebd.) Ohne das stets begleitende „Ich denke“ (wie bei Descartes und Kant) sind weder die wissenschaftlichen noch die lebensweltlichen Realitätsbezüge vorstellbar und darstellbar.
Umso überraschender und befremdlicher wirkt es, dass W.Sch. – zumindest zeitweise – zu akzeptieren scheint, was Wolfgang Welsch als These über den angeblichen Zusammenhang von Realität und Ästhetik verlautbart:
„Meine These lautet, daß ästhetisches Denken gegenwärtig das eigentlich realistische ist. Denn es allein vermag einer Wirklichkeit, die – wie die unsrige – wesentlich ästhetisch konstituiert ist, doch einigermaßen beizu-kommen. Begriffliches Denken reicht hier nicht aus. Eigentlich kompetent ist – diagnostisch wie orientierend – ästhetisches Denken. Ausschlaggebend für diese Veränderung in der Kompetenz eines Denktypus – für diese Verlagerung von einem logozentrischen zu einem ästhetischen Denken – ist die Veränderung der Wirklichkeit selbst.“10
Wieso die Wirklichkeit „wesentlich ästhetisch konstituiert“ sei, verrät Welsch hier ebenso wenig wie den Grund für die Tatsache, dass er als Alternative zum „Logozentrismus“ nur das „ästhetische Denken“ nennt. (Mit Nietzsches ominösem Fehlschluss auf den „Urgrund“ der Welt in der Kunst lässt sich ein Vorrang des Ästhetischen jedenfalls nicht begründen!)
W.Sch. wertet Welschs kühne These als „Absage an die traditionelle Bestimmung der Ästhetik“ mit den von Kant errichteten Grundpfeilern Schönheit und Erhabenheit. Woraus W.Sch. schließt, diese Neubestimmung lasse nicht nur die negierende Seite der Vergleich-gültigung erkennen, sondern auch eine positive: Man gewinne eine „neue Freiheit“, weil die Wirklichkeit nicht mehr als etwas Festes angesehen werde, da nunmehr „das Reale mit dem Fiktiven verbunden“ sei.11 – Meine Fragen: Hat es Synthesen von Realität und Fiktion nicht immer schon gegeben? Beruht nicht jegliche Kunst auf solchen Synthesen (z.B. des Dionysi-schen und des Apollinischen bei Nietzsche!)? W.Sch hat sich hier offenbar von der von Welsch vorgetragenen Argumentation beeindrucken und mitreißen lassen. Wie anders sollte es zu erklären sein, dass er seine Zustimmung schon wenige Seiten später relativiert bzw. revidiert, indem er vermutet, „ daß die Ästhetik eine neue Metaphysik darstellt “.12 Metaphysik habe jedoch stets die „Aufgabe der Beruhigung“ gehabt. Und er gibt zu bedenken, dass diese neue, postmoderne „Beruhigung“ im Zeichen der Vergleichgültigung und damit einer Beschränkung „auf das Wahrnehmen und das durch dieses ausgelöste Reflektieren“ stehe, und zwar in ständiger Abhängigkeit von einer als „Spiel-Phantasie“ aufgefassten, alles beherrschenden Phantasie:
„Die Phantasie geht von der Wahrnehmung aus und gleitet dann weiter. Phantasie ist Spiel-Phantasie, nicht nur ein einfaches Nachahmungs-Spiel. Die Phantasie-Gestalten sind von mir ausgedacht, und zugleich gilt: sie überkommen mich.“13
Wobei W.Sch. sich erstaunlicherweise auf Hegel beruft, der mit der Phantasie als „Mittelpunkt“ bereits die Einbildungskraft analysiert habe (ebd.). – Dagegen erinnere ich an die Auswüchse der Phantasie in Phantastereien, wie sie z,B. bei Fichte vorkommen. Wenn die Phantasie den Realitätsbezug förmlich wegschwemmt, kann es weder eine neue Ästhetik noch eine neue Metaphysik geben. In solchen Auswüchsen hebt sich die Postmoderne selbst auf – eine ständige Gefahr, nicht nur für die Postmoderne selbst.
Gravierend kommt hinzu, dass sich die Ideologie des Postmodernismus mit der des Neoliberalismus verbündet hat. Diesen zu kritisieren, halten die Postmodernen für zwecklos, weil es dafür ja angeblich keinerlei verlässliche wissenschaftlichen und philosophischen Orientierungsmarken gebe – und zwar erst recht nicht im Marxismus! Scharf verurteilt dies Nils Heisterhagen (2017), dessen Kritik ich derjenigen von W.Sch. hinzufüge:
„ Der Sprengstoff, der das Zusammenleben bedroht, ist der Relativismus. Es ist die Auffassung der Absage an Begründbarkeit, es ist die Aufgabe von Allgemeinheit. Der Relativismus regiert. Der Relativismus beherrscht den Zeitgeist. Der Blick für das Ganze geht so auch verloren. Das Subjekt schaut immer mehr auf sich. Das Wachsen des individualistischen Moments sorgt für eine Erosion der Moderne. Die Suche nach der Wahrheit und dem Gemeinsamen geht verloren. Der Neoliberalismus als hegemoniales Denken ist in so einem postmodernen Rahmen nahezu logisch. Der Neoliberalismus passt zum postmodernen Zeitgeist. Es ist eine Hochzeit des Subjektivismus, die beide zusammengeführt hat. Die Postmoderne ist das Gerüst, wodurch der Neoliberalismus überhaupt erfolgreich stehen kann. Ohne die Postmoderne wäre der Neoliberalismus niemals so hegemonial. Der zusammen-geführte postmoderne Liberalismus reklamiert für sich die Individuen befreit zu haben, aber er hat so gleichsam das Ganze geopfert. Der Blick für das Ganze ist verstellt. Das Allgemeine als Kategorie ist erodiert. Und die Postmoderne ist schuld. Die Schuld der Postmoderne liegt also darin, dem Relativismus alle Türen geöffnet zu haben, und sie liegt darin, dem Neoliberalismus zur Hegemonie verholfen zu haben. Der postmoderne Zeitgeist ist aber ein Resultat eines Irrtums, eines Fehlers der Philosophiegeschichte. Und auch der Neoliberalismus ist eine Verirrung, auch er ist ein Fehler.
Ein neuer Konsens ist so gefordert. Findet er sich nicht, könnte auch zunehmend die Toleranz erodieren, die die postmodernen relativistischen Gesellschaften des Westens momentan noch einigermaßen befriedet. Ein Toleranzethos hält die relativistischen Gesellschaften noch zusammen. Als Toleranzdemokratien funktionieren die liberalen Demokratien noch. Aber sobald die Toleranz mehr und mehr schwindet, und der Antagonismus, der immer eine Möglichkeit des Relativismus ist, voll durchbricht, werden die liberalen Demokratien auch wieder zu Demokratien werden, wo Gewalt, Hass und Hetze als legitime Mittel des politischen Streits angesehen werden. – Wir müssen aufhören der Illusion zu erliegen, dass das „Ende der Geschichte“ (vgl. Fukuyama 1992) bereits erreicht sei. Denn das Ende ist nicht erreicht. Die Postmoderne darf nicht das Ende sein. Es muss weiter gehen. Der Relativismus ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Der Relativismus ist sogar das Ende der Philosophie. Dabei darf es nicht bleiben. Das war es einfach noch nicht. Das „goldene Zeitalter“ ist noch nicht erreicht. – Es braucht nun eine neue Philosophie.“14
Einzuwenden ist hier wohl, dass hinter dem Neoliberalismus nicht nur Ideologien, sondern vor allem handfeste ökonomische Interessen stehen; dies entgegen der postmodernen Behauptung, es gebe nichts Festes, also auch nichts Handfestes.15
KI-Zeitalter
Zu bezweifeln ist, ob es gelingen kann, die Künstliche Intelligenz stets verantwortungsvoll zu nutzen und „in umfassende Strategien für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit“ zu inte-grieren (s.o.). Zumal der Kapitalismus nicht nur die Öko-Krise, sondern auch die – bislang ebenfalls ungelöste – Soziale Frage verursacht hat. Beide Probleme parallel oder zusammen zu lösen, scheint im Kapitalismus unmöglich zu sein. Hauptgrund: Mehr als umfassende Information – zweifellos eine großartige Errungenschaft! – kann KI anscheinend nicht anbieten. Um durchgreifende Veränderungen herbeizuführen, bedarf es aber sowohl einer Veränderungs-Ethik (Ernst Bloch) als auch umfassender Systemkritik und -veränderung. Genauer:
Auf die aktuell akuten Bedrohungen – Öko-Krise, Digitalisierung, Trans- und Post-humanismus, Künstliche Intelligenz – ergänzbar durch den Nuklearen Holocaust, – sind mit meiner Erweiterten Öko- Ethik[17 ]Antworten möglich, erst recht, wenn sie durch historische und aktuelle Werte-Synthesen gestützt werden können. Nicht jedoch auf die Bedrohung durch den aktuellen globalisierten Turbo-Kapitalismus – und auch nicht auf die Frage, wie die „Antworten“, z.B. in Form meiner legitimen Forderung [17 ] , denn in die Tat umgesetzt werden können, so dass sie gesellschaftsverbessernd wirken. Was leider auch dann nicht möglich ist, wenn sich veranschaulichen lässt, wie aus Werten Normen, d.h. verinnerlichte, verbindliche Verhaltensregeln bzw. „Maximen“ werden. Dies gilt wahrscheinlich für jede Art der Umwandlung von Werten in Normen, so a) bei angeborenen Werten, die der ursprünglichen Selbsterhaltung und Erstorientierung dienen; b) bei der Normierung von Werten durch Erziehung und Sozialisation, die auf Grund unterschiedlicher gesellschaftlicher und kultureller Rahmenbedingungen stattfinden; c) durch politische und sonstige Gesetzgebung. Die unter a) genannten Faktoren sind anscheinend kaum beeinflussbar, während bei b) und c) das „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ zum Tragen kommt. Darunter im turbo-kapitalistischen Westen die Macht der manipulativen Fakten: Arbeitgeber-Interessen, „Spaß“-Ideologie, analytisch-positivistisches Denken u.a.m. Wogegen ethische Grundsätze einen sehr schweren Stand bzw. häufig gar keine Chancen auf Verwirklichung haben. Wo Erkenntnisse auf Interessen prallen, blamieren sich meistens die Erkenntnisse, wie Marx feststellte. Legitime ethische Forderungen, z.B. nach Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität, durchzusetzen, stößt in einer Klassen-Gesellschaft („mit Herr und Knecht“) nicht selten auf unüberwindliche Hindernisse, verursacht z.B. durch digitale Überwachung, kapitalistische Herrschafts-Ideologie, Lobbyismus, Stigmatisierung und Verfolgung Andersdenkender, Gewaltmaßnahmen (z.B. Entlassungen in Krisen-Zeiten) u.a.m..[18 ]
Fazit und Ausblick
Mit Ausnahme des Begriffs Holozän erfüllen die behandelten Bezeichnungen das Kriterium, sich auf Besonderheiten des gegenwärtigen Zeitalters zu beziehen. Wobei allerdings die Be-zeichnung ‚Postmoderne‘ einen Sonderfall darstellt. Denn diese betrifft zwar die Gegenwart, tritt aber mit einem Anspruch auf, dem sie nicht gerecht zu werden vermag: dem Anspruch, den Begriff ‚Moderne‘ zu ersetzen. Die Gründe hierfür habe ich ausführlich dargestellt, insbe-sondere an Hand der von Walter Schulz und Nils Heisterhagen geäußerten Kritiken.
Wohl zu Recht kritisiert Walter Schulz das postmoderne Konzept „Vergleichgültigung“, in dem er einen Realitätsverlust erkennt, entstanden vor allem durch die Leugnung des mensch-lichen Subjekt-Seins und der Leistungen der verbalen Sprache. Abwegig ist die Negierung von Wissenschaft, Realität, Vernunft und Verantwortung, wodurch die Postmodernen sich auch den Zugang zur Subjekt-Objekt-Dialektik und damit zum Wesen des Geistes versperren. Ohne den Realitätsbezug gibt es überdies keine Möglichkeit, Ästhetik und Metaphysik neu zu begründen. „Gravierend kommt hinzu, dass sich die Ideologie des Postmodernismus mit der des Neoliberalismus verbündet hat.“ (s.o.) Nils Heisterhagen hat wohl Recht, wenn er den Postmodernismus – mit seinem uneingeschränkten Relativismus – als „Resultat eines Irrtums, eines Fehlers der Philosophiegeschichte“ anprangert.
Nicht viel besser steht es mit den Begriffen Anthropozän, Kapitalozän und KI-Zeitalter. Wenn der Mensch im Anthropozän als Verursacher der weltweiten Öko- und Klimakrise auftritt, muss nach den Gründen hierfür gefragt werden. Jürgen Manemann nennt u.a. den um sich greifenden „Machbarkeits- und Perfektibilitätswahn“ (s.o.) in Verbindung mit Trans- und Posthumanismus. Dem setzt er die Forderung nach einer neuen „Humanökologie“ entgegen, analysiert jedoch nicht das Widersacherische in Form des neoliberalen, globalisierten Kapita-lismus, der nicht durch den Begriff ‚Anthropozän‘, wohl aber durch den des ‚Kapitalozän‘ zu kennzeichnen ist. – Ähnliches gilt für die Fragen, die Thomas Bruhn stellt, und zwar im Zusammenhang mit dem globalen Rahmen des kollektiven Handelns, der individuellen Verantwortung jedes Menschen und der konkreten Gegenmittel und -technologien.[19 ] Zu Recht weist Bruhn darauf hin, dass hierzu im Konzept des Anthropozäns nicht Konkretes zu finden ist. Dabei sieht er ein Verdienst dieses Konzeptes darin, das „Bewusstsein einer globa-len Verbundenheit“ zu fördern, erwähnt aber nicht die Folgenlosigkeit dieses Bewusstseins, solange der Kapitalismus vorherrscht.
Kapitalozän
Die erforderliche Differenzierung des Begriffs könnte dem entsprechen, was ich schon 2003 bzw. 2017 über die Globalisierungskrise geschrieben habe:
„Ungewiss scheint, ob es eine durch die Globalisierung verursachte Krise überhaupt gibt. Neoliberale Theoretiker verneinen dies. Sie versuchen, die negativen Folgen der Globali-sierung zu verniedlichen und nur deren positive Wirkungen gelten zu lassen. Der Hauptgrund dafür, dass ich den Begriff Globalisierungs-Krise für richtig und unverzichtbar halte, liegt in der dem Phänomen Globalisierung innewohnenden Tendenz zur Verstetigung und Unum-kehrbarkeit (Irreversibilität). Unter den Bedingungen der neoliberalen „freien Marktwirt-schaft“ herrscht nahezu schrankenlose, internationale Konkurrenz unter den Produzenten und Anbietern, den kleinen und großen Unternehmen bis hin zu den Handwerksbetrieben. Anscheinend sind fast alle Klein-, Mittel- und Großunternehmer gezwungen, sich an dem gnadenlosen internationalen Konkurrenzkampf zu beteiligen. Das aber ist sozusagen des Pudels Kern. Nicht nur die Mammut-Fusionen (der Großkonzerne und der Hochfinanz) verstetigen die Globalisierung und machen sie unumkehrbar. Wer als Unternehmer überleben will, muss sich – offenbar in der großen Mehrheit der Fälle – an dem „Run ins Ausland“ beteiligen.
Diese Tendenzen können unkritische Beobachter dazu verleiten, die katastrophalen „Neben-wirkungen“ der Globalisierung, z.B. für die Soziale Frage (Verschärfung der sozialen Unter-schiede und Gegensätze), für Klima, Umwelt und Weltpolitik, zu übersehen oder als „unwichtig“ von sich zu weisen. Das halte ich für unverantwortlich.
Hinzu kommt, dass auch die nationalen Regierungen anscheinend nicht in der Lage sind, eine politische Kontrolle über den international und weltweit agierenden „Turbo-Kapitalismus“ (den globalisierten Neoliberalismus) zu gewinnen. Durch dessen Verstetigung geraten die politisch Verantwortlichen außerdem in Widersprüche und Zielkonflikte. Schützen und stützen sie die Auslandsaktivitäten ihrer heimischen Unternehmer, nehmen sie still-schweigend die negativen Folgen der Globalisierung in Kauf. Tun sie dies nicht, bezichtigt man sie der Untätigkeit und der Gleichgültigkeit.“[20 ]
Ein Update hierzu präsentieren Harald Schumann und Christiane Grefe im Jahre 2009 – und zwar unter dem Eindruck des fürchterlichen Finanzcrashs von 2008:
„Die wechselvolle Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts belegt: Die grenzenlose Aus-dehnung des Kapitalismus ist keineswegs vorherbestimmt. Der Lauf der Geschichte kann durchaus eine andere Richtung nehmen. Es handelt sich um einen dialektischen Prozess. Wo immer der Mechanismus von Angebot und Nachfrage, von Kapitalrendite und Strukturwandel Grenzen überwindet, Partikularinteressen verletzt oder bestehende Kulturen bedroht, erzeugt dieser Vorgang auch Gegenbewegungen. Und die Konsequenzen sind offen. Dass der Trend zur globalen Integration anhält und nicht wieder ins Gegenteil umschlägt, ist keineswegs ausgemacht.“ [21]
In der Tat gibt es vielfältige, teils bedenklich populistische Gegenbewegungen gegen die turbo-kapitalistische Globalisierung, die ich hier aus Platzgründen nicht näher beschreiben kann. Weiterhin gültig und geboten ist jedenfalls die Warnung vor einer Verharmlosung kata-strophaler „Nebenwirkungen“ der Globalisierung, darunter die der Verschärfung der sozialen Gegensätze und Konflikte, die schleichende bis akute Klima- und Umwelt-Katastrophe, zunehmend ungleicher Handel, zunehmende Weltmarkt-Beherrschung durch einige Groß-konzerne (die „Global Players“), mit bösen Folgen wie dem Kollaps ganzer Volkwirtschaften in Afrika und anderswo, was u.a. zu Kriegen, katastrophalen Flüchtlingskrisen und huma-nitären Katastrophen geführt hat.
Ki-Zeitalter
Die unabdingbare Kontrolle der Künstlichen Intelligenz wird durch das Fehlen eines allgemeinen, internationalen KI-Rechts erschwert. Umso mehr empfiehlt es sich, aus dem Vorliegenden die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Natürlich gibt es weltweit neben den Gesetzes-Vorlagen der EU, der USA und Chinas weitere, ähnliche Projekte. Wahrscheinlich aber nicht mit höherer inhaltlicher Relevanz. An den drei Gesetzesvorlagen fällt auf, dass sie die Probleme der schwachen KI nur ansatzweise, die der starken kaum oder gar nicht behandeln. Weder der US-amerikanische Nietzsche-Kult und -Hype noch R. Kurzweils „Singularitäts“-Phantastereien noch die monströse „Symbiose“ von Mensch und Technik werden analysiert. Die Gefahr einer Selbstauslöschung der Menschheit durch KI wird ignoriert.
Gravierend kommt hinzu, dass bisher anscheinend in keinem einzigen Gesetzes-Vorhaben die Tatsache erwähnt wird, dass die KI-„Singularität“ das Ende aller Bemühungen um sinnvolle Alternativen zum Bestehenden, d.h. zum globalisierten Neo-Liberalismus, bedeuten würde. An die Stelle eines Reichs der Freiheit würde eine hochexplosive, nicht funktionstüchtige „Symbiose“ von Menschen und Robotern treten.
Um die negativen Auswirkungen der schwachen und starken (generativen) KI wirksam zu bekämpfen, werden nationale Gesetze nicht ausreichen. Vielmehr bedarf es verbindlicher, internationaler Vereinbarungen, z.B. auf UN-Ebene. Dies hat auch Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, bereits erkannt. Angesichts der existenziellen Bedrohung der Mensch-heit durch KI kritisierte er die Macht von Großunternehmen und -Staaten, von denen die Menschenrechte missachtet werden. In einem Positionspapier der UNO stellte er Vorschläge zum weltweiten Umgang mit KI vor und kündigte die Einrichtung entsprechender hochrangiger Beratergremien und die Gründung einer UN - Regulierungsbehörde an.[22 ]
Kaum einen Monat später nahm der UNO-Menschenrechtsrat in Genf eine Resolution an, in der Schutz- und Kontrollmaßnahmen zur KI beschlossen wurden. Die Transparenz entsprechender Systeme soll gefördert werden, speziell zur Verwendung der für die KI-Technologie benutzten Daten, die „auf menschenrechtskonforme Weise gesammelt, verwendet, weitergegeben, archiviert und gelöscht werden“ sollen. Die Resolution wurde im Juli 2023 einvernehmlich angenommen.[23 ]
Europäische Charta der Grundrechte, KI und die Zukunft der Menschheit
Um ein einheitliches, internationales KI-Recht zu entwickeln, müssen die Menschenrechte gegenüber der KI geschützt werden. Möglichkeiten hierfür ergeben sich u.a. aus der Europä-ischen Charta der Grundrechte (seit 2012).[24 ] Darin geht es um Grundrechte, die sich in sechs Kategorien aufteilen lassen, und zwar in: Würde, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Bürger-rechte und Justizielle Rechte.
Gesichtserkennungstechnologie darf angeblich unter bestimmten Auflagen zu Justizzwecken verwendet werden, keinesfalls jedoch wie in China zur generellen Überwachung der Bevölkerung. Gegen Letzteres müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden, z.B. durch die Einbeziehung von Datenschutzbeauftragten.
Diese Grundrechte in einem verbindlichen internationalen KI-Abkommen zu verankern, scheint ausgeschlossen, solange Großmächte wie die USA und China darauf bedacht sind, –u.a. mittels KI – eine politische und ökonomische Vormachtstellung in der Welt zu behaupten oder neu zu erringen.[25 ]
Schlusswort
Am Schluss stellt sich die Frage, welcher Begriff denn geeignet wäre, das gegenwärtige Zeit-alter treffend und aufschlussreich zu bezeichnen. Möglich scheint ein solcher Begriff als Syn-these (mixtum compositum) aus Anthropozän, Kapitalozän und KI-Zeitalter, z.B. in Form von „Anthropo-,Kapitalo-KI-Zeitalter“; was jedoch schon wegen seiner Holprigkeit kaum Chan-cen auf Verwendung im allgemeinen Sprachgebrauch haben dürfte. – Immerhin würde der Bedeutungsumfang und -inhalt dieser Synthese zum Ausdruck bringen, welche Missstände, Gefahren und Risiken – neben beachtlichen Fortschrittsmöglichkeiten – unsere Zeit bereithält.
Zu bedenken ist aber, dass den Beteiligten zuweilen nicht klar zu sein scheint, was auf dem Spiel steht: das Schicksal der Menschheit, einschließlich eines möglichen Reichs der Freiheit, zu dem auch eine sinnvoll gehandhabte KI beitragen könnte. Dieses Reich ist eine Konkrete Utopie, die zu den edelsten Ambitionen und stärksten Hoffnungen der Menschheit gehört.[25 ] – Inwieweit hierzu auch mein mehrfach (2017, 2018, 2021 im GRIN-Verlag) vorgetragenes Modell eines Demokratischen Öko-Sozialismus beitragen kann, ist daselbst nachzulesen. Jedenfalls besteht die Hoffnung, dass mit einem solchen Sozialismus nicht nur ein neues Zeitalter, sondern auch eine neue Epoche der Weltgeschichte anbrechen würde.
Literaturhinweise
Krieger, David J. 1996: Einführung in die allgemeine Systemtheorie, Stuttgart
Robra, Klaus 2015: Wege zum Sinn, Hamburg
Robra, Klaus 2017: Person und Materie. Vom Pragmatismus zum Demokratischen Öko-Sozialismus, München, https://www.grin.com/de/e-book/375344/person-und-materie-vom-pragmatismus-zum-demokratischen-oeko-sozialismus
Robra, Klaus o.J. (2020): Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München, https://www.grin.com/document/923015
Robra, Klaus o.J. (2021): Sind die Diktatur des Proletariats und die Bürokratie das Ende des Sozialismus? Die Frage nach Auswegen aus den Sackgassen, München, https://www.grin.com/document/1032082
Robra, Klaus 2022: Das „verkommene“ Subjekt. Hypokeimenon, Cogito, Übermensch? Grundlegung einer Subjekt-Objekt-Philosophie, München, https://www.grin.com/document/1183185
Robra, Klaus 2023: Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Möglichkeiten und Gefahren, München, https://www.grin.com/document/1383067
Robra, Klaus (i. Vorb.): Was ist der Mensch im KI-Zeitalter? Philosophische Anthropologie im 21. Jahrhundert
Schulz, Walter 1994: Der gebrochene Weltbezug. Aufsätze zur Geschichte der Philosophie und zur Analyse der Gegenwart, Stuttgart
Schumann, Harald / Grefe, Christiane 2009: Der globale Countdown. Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung – die Zukunft der Globalisierung, Köln
[...]
1 Hegel 1972 ( 1820), S. 12
2 In: https://www.leifichemie.de/einfuehrung-die-chemie/teilchenmodell/grundwissen/diffusion-teilchen-bewegung
3 https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/holozaen/7053
4 https://www.bpb.de/themen/umwelt/anthropozaen/
5 https://www.researchgate.net/publication/281633131_Das_Anthropozan_-_Die_Erde_in_der_Menschenzeit
6 J. W. Moore in: https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/planetarische-gerechtigkeit-im-kapitalozaen/
7 https://disposabletimes.org/2021/03/lesch-kapitalozan/
8 https://www.com/was-ist-postmoderne/
9 Schulz 1994, S. 151
10 Welsch in: Schulz 1994, S. 147 f.
11 Vgl. Schulz a.a.O. S. 148
12 Schulz a.a.O. S. 154 f.
13 Schulz a.a.O. S. 155
14 N. Heisterhagen in: theoblog.de/postmodernismus-eine-kritik-von-links/37297/
15 Vgl. Robra o.J. S. 148-152
16 Vgl. Robra o.J. S. 148-153
17 Näheres hierzu in: Robra o.J. (2020), S. 304 f.
18 Vgl. Robra (i. Vorb.) S. 87 f.
19 Vgl. Thomas Bruhn in: https://www.bpb.de/themen/umwelt/anthropozän/216922/der-men..., S. 17
20 Vgl. Robra 2017, S. 146
21 Schumann / Grefe 2009, S. 14
22 UNO-Generalsekretär Guterres für Regulierungsbehörde zu KI (2023), https://www.deutschlandfunk.de/generalsekretaer-guterres-fuer-regu...
23 UNO-Menschenrechtsrat-Resolution zu Kontrolle von KI angenommen (2023), https://www.deutschlandfunk.de/resolution-zu-kontrolle-von-ki-an...
24 KI und Grundrechte (2019), https://www2.deloitte.com/de/de/pages/public-sector/articles/ki-un..., S. 3 ff.
25 Näheres hierzu: Robra o.J. (2021), S. 144 ff. sowie Robra 2023 (darin auch mit „ethisch fundierten Folgerungen“ und mit Hinweisen auf KI-Gesetze in USA und China)
- Quote paper
- Klaus Robra (Author), 2024, Holozän, Anthropozän, Kapitalozän, Postmoderne oder KI-Zeitalter?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1553781