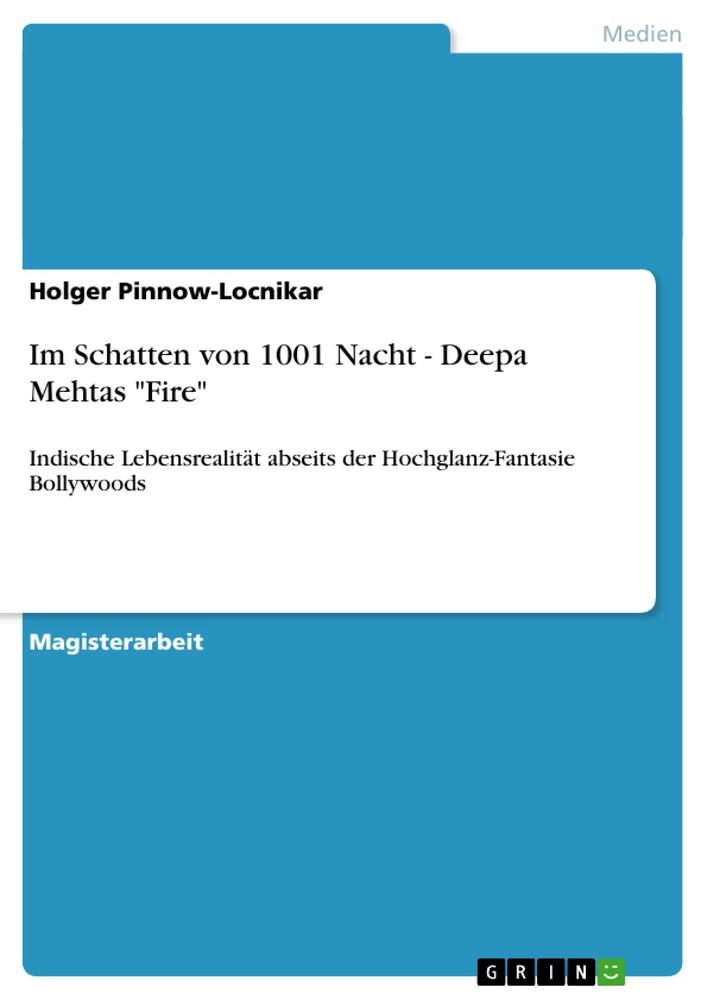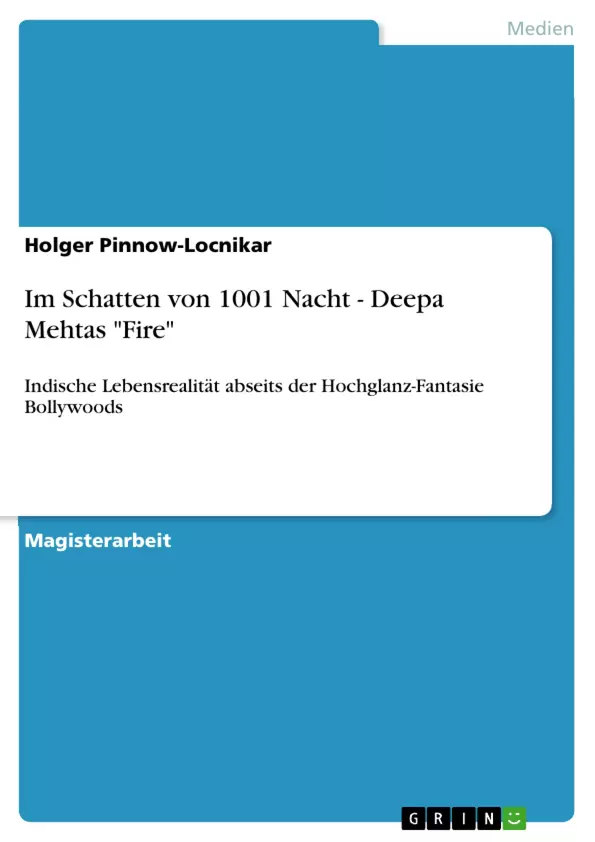Über die filmwissenschaftliche Analyse des Films „Fire“ wirft der Autor einen tiefen Blick in die urbane indische Gesellschaft. Dabei geht er explizit der Frage nach, was „Fire“ über die Lebensumstände von Frauen in der städtischen Mittelschichtgesellschaft Indiens aussagt. Mittels der Filmanalyse arbeitet er die zentralen Aussagen des Films und seine Rollenbilder heraus und setzt diese Aussagen in Relation zu wissenschaftlichen Erkenntnissen über die indische Gesellschaft. Dabei berücksichtigt er auch die filmdramaturgischen Aspekte des indischen Kinos.
Den umfassenden Rahmen des Forschungsfeldes bilden zum einen der indische Film als nationale Kunstform und dabei – in Abgrenzung zum exemplarischen Betrachtungsgegenstand – insbesondere Bollywood, und zum anderen die kulturethnologische, kulturgeschichtliche und sozialwissenschaftliche Forschung zur Situation von Frauen in Indien und zu den verschieden definierten Rahmenbedingungen dieser Situation. Die thematische Fokussierung des Forschungsfeldes erfolgt über den spezifischen Betrachtungsgegenstand, den Film „Fire“ von Deepa Mehta.
Zum indischen Film und dort insbesondere zu Bollywood gibt es mittlerweile umfassende Literatur mit einer stetig wachsenden Zahl von Werken, die leider nur zum Teil den Anspruch von Wissenschaftlichkeit erfüllen kann.
Zu den Filmen von Deepa Mehta existiert bislang sehr wenig wissenschaftliche Literatur. Die hier vorliegende Arbeit leistet somit Pionierarbeit in einem bislang wenig untersuchten Forschungsfeld abseits der Bollywood-Hochglanzindustrie und bedient sich zudem einer modernen analytischen Methode, um Einblicke in eine für uns immer noch fremde Kultur zu gewinnen.
Der Film „Fire“ von 1996 bildet den Auftakt einer Trilogie, in der sich die Regisseurin Deepa Mehta äußerst kritisch mit der Geschichte ihres Heimatlandes auseinander setzt. Deepa Mehta gilt heute als bekannteste und erfolgreichste Regisseurin Kanadas.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Hauptteil
- 1. Deepa Mehta
- 1.1 Vita
- 1.2 Filmografie
- 2. Das indische Kino der Gegenwart
- 2.1 Bollywood und die indische Filmindustrie
- 2.2 Zensur
- 2.3 Verbreitung
- 2.4 Rezeption in Indien
- 2.5 Rezeption im Westen
- 3. Filmanalyse: Fire (1996)
- 3.1 Bedingungsrealität: Entstehung und Hintergrund
- 3.1.1 Persönliche Bedingungen
- 3.1.2 Historische Bedingungen
- 3.1.3 Das indische Diaspora-Kino
- 3.2 Die Filmrealität und ihre Bezugsrealität
- 3.2.1 Filmhandlung und Dramaturgie
- 3.2.2 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- 3.2.2.1 Tradition, Religion, Kastenwesen
- 3.2.2.2 Städtisches Leben
- 3.2.2.3 Familie
- 3.2.2.4 Das Verhältnis von Frauen untereinander
- 3.2.2.5 Ehe
- 3.2.2.6 Sexualität
- 3.2.3 Figuren
- 3.2.3.1 Frauen
- 3.2.3.2 Männer
- 3.2.4 Figuren-Interaktionen
- 3.2.4.1 Frau → Mann
- 3.2.4.2 Frau ←→ Frau
- 3.2.4.3 Figurenentwicklungen
- 3.3 Wirkungsrealität: Reaktionen auf den Film in Indien und im Westen
- 3.3.1 Reaktionen im Westen
- 3.3.2 Reaktionen in Indien
- 3.1 Bedingungsrealität: Entstehung und Hintergrund
- II. Schlussteil
- 1. Ergebnisse
- 1.1 Film und Wirklichkeit
- 1.2 Quellenkritik
- 2. Ausblick: Gesellschaft im Wandel
- 1. Ergebnisse
- 1. Deepa Mehta
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit analysiert den indischen Spielfilm „Fire“ von Deepa Mehta aus kulturwissenschaftlicher Perspektive und beleuchtet die Lebensrealität in Indien abseits des Bollywood-Klischees. Die Arbeit untersucht die Produktionsbedingungen des Films, die filmische Umsetzung und die Rezeption des Films in Indien und im Westen.
- Das indische Kino der Gegenwart und die Rolle von Bollywood
- Die Darstellung von Tradition, Religion und Kastenwesen in „Fire“
- Die Darstellung der Lebensumstände von Frauen in der urbanen indischen Gesellschaft
- Die Rezeption des Films in Indien und im Westen
- Der Einfluss des Films auf die Diskussion über Geschlechterrollen und soziale Veränderungen in Indien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Magisterarbeit ein und stellt den Film „Fire“ als ein Beispiel für indisches Kino jenseits des Bollywood-Mainstreams vor. Der erste Teil der Arbeit geht auf die Biografie und Filmografie der Regisseurin Deepa Mehta ein, analysiert die indische Filmindustrie und die Rolle von Bollywood, und beleuchtet die Rezeption indischer Filme in Indien und im Westen.
Der zweite Teil der Arbeit fokussiert auf die Filmanalyse von „Fire“. Es werden die Entstehungsbedingungen des Films, die Filmhandlung und Dramaturgie, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Figurenkonstellationen im Detail analysiert. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Darstellung der Lebensumstände von Frauen in der urbanen indischen Gesellschaft gewidmet.
Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit den Reaktionen auf den Film in Indien und im Westen. Die Arbeit beleuchtet die Kritik an „Fire“ sowie die Bedeutung des Films für die Diskussion über Geschlechterrollen und soziale Veränderungen in Indien.
Schlüsselwörter
Indisches Kino, Bollywood, Deepa Mehta, Fire, Filmanalyse, Kulturwissenschaft, Lebensrealität, Frauen, Geschlechterrollen, Tradition, Religion, Kastenwesen, Familie, Ehe, Sexualität, Rezeption, Kritik, soziale Veränderungen
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Films „Fire“ von Deepa Mehta?
Der Film thematisiert die Lebensumstände von Frauen in der städtischen Mittelschicht Indiens und bricht dabei mit traditionellen Rollenbildern.
Wie unterscheidet sich „Fire“ vom typischen Bollywood-Kino?
Im Gegensatz zur Bollywood-Hochglanzindustrie setzt sich Mehta kritisch mit Religion, Tradition und dem Kastenwesen auseinander.
Welche gesellschaftlichen Probleme werden im Film analysiert?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von arrangierten Ehen, weiblicher Sexualität und dem Verhältnis von Frauen innerhalb patriarchaler Familienstrukturen.
Wie wurde der Film in Indien aufgenommen?
Die Arbeit beleuchtet die kontroversen Reaktionen in Indien, die von Zensurdebatten bis hin zu heftigen Protesten reichten.
Wer ist Deepa Mehta?
Mehta ist eine renommierte Regisseurin, die für ihre Trilogie bekannt ist, in der sie die Geschichte und soziale Realität Indiens kritisch hinterfragt.
- Citation du texte
- Holger Pinnow-Locnikar (Auteur), 2008, Im Schatten von 1001 Nacht - Deepa Mehtas "Fire", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155420