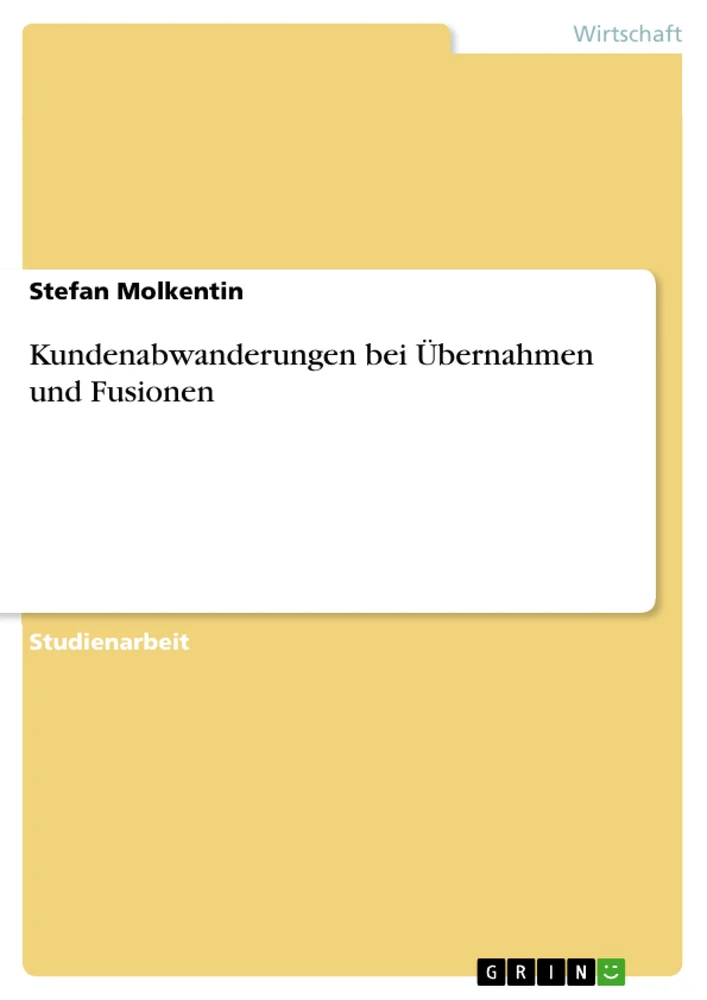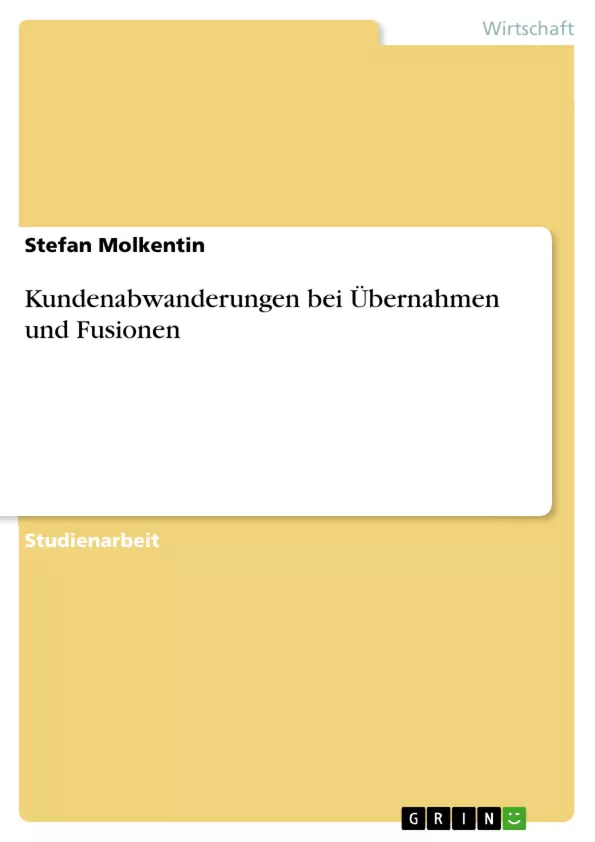Neben einem veränderten Nachfrageverhalten gestaltet sich eine Unternehmensdifferenzierung von der Konkurrenz immer schwieriger, da Leistungs- und Produktunterschiede zunehmend geringer werden. Dies bewirkt ein Umdenken einer aktuellen Unternehmenszusammensetzung zu einer neuen Art des Unternehmenszusammenschlusses. Fusionen und Übernahmen rücken in den Fokus der Unternehmensgestaltung, um mit gemeinsam gebündelten Kräften gegenüber den Auswirkungen der derzeitigen (Finanz-)Krisen und einer potenziellen, langfristigen Gewinnmaximierung positiv aufgestellt zu sein. Die verfolgten Zielsetzungen bei Fusionen und Übernahmen sind zahlreich und können sowohl einzeln als auch durch eine Kombination von mehreren Motiven gleichzeitig wirken.
Diese Ausarbeitung behandelt sowohl die wesentlichen Merkmale einer potenziellen Kundenabwanderung durch Fusionen und Übernahmen, als auch die einzelnen Ausprägungsformen. Neben einer grundlegenden Begriffsdefinition von Unternehmenszusammenschlüssen im zweiten Abschnitt, befasst sich der dritte Teil der Ausarbeitung mit den einzelnen Merkmalen von Fusionen und Übernahmen. Der vierte Abschnitt erläutert die verschiedenen Motive und Ziele von Fusionen und Übernahmen, unterteilt nach strategischen, finanziellen und persönlichen Zielen. Der fünfte Abschnitt formuliert dementsprechend die Auswirkung von Fusionen und Übernahmen auf den Kunden und potenzielle Abwanderungsgründe. Außerdem interpretiert dieser Abschnitt die Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen auf die Unternehmenskultur. Der sechste Abschnitt beendet die Ausarbeitung mit einem abschließenden Resümee.
1 Einleitung
2 Definition Unternehmenszusammenschlüsse
3 Fusionen und Übernahmen
3.1 Merkmale von Fusionen
3.2 Merkmale von Übernahmen
4 Motive von Fusionen und Übernahmen
4.1 Strategische Motive
4.1.1 Marktmotive
4.1.2 Leistungsmotive
4.1.3 Risikomotive
4.2 Finanzielle Motive
4.2.1 Kapitalmarktbedingte Motive
4.2.2 Steuerliche Motive
4.3 Persönliche Motive
4.3.1 Hybris-Hypothese
4.3.2 Managerialismus-Hypothese
4.3.3 Free-Cash-Flow-Hypothese
4.3.4 Diversifikations-Hypothese
5 Kundenabwanderung durch Fusionen und Übernahmen
5.1 Kundenabwanderungsprozess
5.2 Ursachen Kundenabwanderung
5.3 Unternehmenskulturverlust als Kundenabwanderungsgrund
5.3.1 Berücksichtigung Unternehmenskultur
5.3.2 Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Einbindung der Unternehmenskultur
6 Kritische Würdigung
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition Unternehmenszusammenschlüsse
- 3 Fusionen und Übernahmen
- 3.1 Merkmale von Fusionen
- 3.2 Merkmale von Übernahmen
- 4 Motive von Fusionen und Übernahmen
- 4.1 Strategische Motive
- 4.1.1 Marktmotive
- 4.1.2 Leistungsmotive
- 4.1.3 Risikomotive
- 4.2 Finanzielle Motive
- 4.2.1 Kapitalmarktbedingte Motive
- 4.2.2 Steuerliche Motive
- 4.3 Persönliche Motive
- 4.3.1 Hybris-Hypothese
- 4.3.2 Managerialismus-Hypothese
- 4.3.3 Free-Cash-Flow-Hypothese
- 4.3.4 Diversifikations-Hypothese
- 4.1 Strategische Motive
- 5 Kundenabwanderung durch Fusionen und Übernahmen
- 5.1 Kundenabwanderungsprozess
- 5.2 Ursachen einer Kundenabwanderung
- 5.3 Unternehmenskulturverlust als Kundenabwanderungsgrund
- 5.3.1 Berücksichtigung der Unternehmenskultur
- 5.3.2 Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Einbindung der Unternehmenskultur
- 6 Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die potenziellen Kundenabwanderungen im Kontext von Fusionen und Übernahmen. Sie analysiert die Ursachen und Prozesse dieser Abwanderung und beleuchtet insbesondere den Einfluss des Verlustes der Unternehmenskultur auf die Kundenbindung.
- Merkmale von Fusionen und Übernahmen
- Motive für Fusionen und Übernahmen (strategisch, finanziell, persönlich)
- Prozesse und Ursachen der Kundenabwanderung
- Einfluss des Unternehmenskulturverlustes auf die Kundenbindung
- Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Integration der Unternehmenskultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kundenabwanderung im Kontext von Fusionen und Übernahmen ein und beleuchtet die Relevanz dieser Thematik in der heutigen Wirtschaftslandschaft.
Kapitel 2 definiert den Begriff der Unternehmenszusammenschlüsse.
Kapitel 3 erläutert die Merkmale von Fusionen und Übernahmen.
Kapitel 4 analysiert die verschiedenen Motive für Fusionen und Übernahmen, unterteilt in strategische, finanzielle und persönliche Ziele.
Kapitel 5 befasst sich mit den Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen auf den Kunden und untersucht die Ursachen und Prozesse der Kundenabwanderung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss des Unternehmenskulturverlustes auf die Kundenbindung. Außerdem werden Handlungsempfehlungen zur Integration der Unternehmenskultur gegeben.
Schlüsselwörter
Kundenabwanderung, Fusionen, Übernahmen, Unternehmenszusammenschlüsse, Unternehmenskultur, Kundenbindung, strategische Motive, finanzielle Motive, persönliche Motive, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum wandern Kunden nach Fusionen und Übernahmen ab?
Gründe sind oft Unsicherheit, veränderte Ansprechpartner, befürchtete Qualitätsverluste oder der Verlust der vertrauten Unternehmenskultur.
Was ist der Unterschied zwischen einer Fusion und einer Übernahme?
Eine Fusion ist der Zusammenschluss zweier gleichwertiger Partner zu einer neuen Einheit, während bei einer Übernahme ein Unternehmen die Kontrolle über ein anderes erwirbt.
Welche strategischen Motive stecken hinter M&A-Aktivitäten?
Dazu gehören Marktmotive (Erschließung neuer Märkte), Leistungsmotive (Synergieeffekte) und Risikomotive (Diversifikation).
Was besagt die Hybris-Hypothese bei Übernahmen?
Sie beschreibt ein persönliches Motiv von Managern, die aus Selbstüberschätzung glauben, den Wert des Zielunternehmens besser steigern zu können als der Markt, was oft zu Überzahlungen führt.
Wie beeinflusst die Unternehmenskultur die Kundenbindung?
Kunden identifizieren sich oft mit den Werten eines Unternehmens. Gehen diese durch eine Fusion verloren, schwindet die emotionale Bindung, was zur Abwanderung führt.
Welche Handlungsempfehlungen gibt es zur Integration der Kultur?
Wichtig sind eine transparente Kommunikation gegenüber den Kunden, die Beibehaltung von Kernwerten und eine schrittweise Zusammenführung der Organisationen.
- Quote paper
- B.A. Stefan Molkentin (Author), 2010, Kundenabwanderungen bei Übernahmen und Fusionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155437