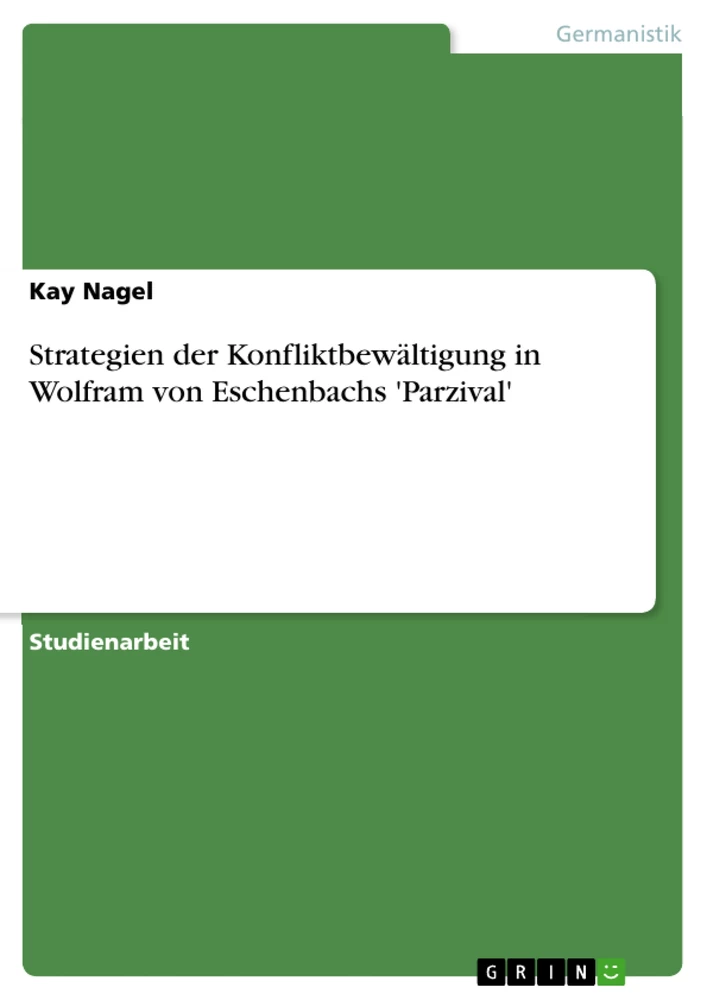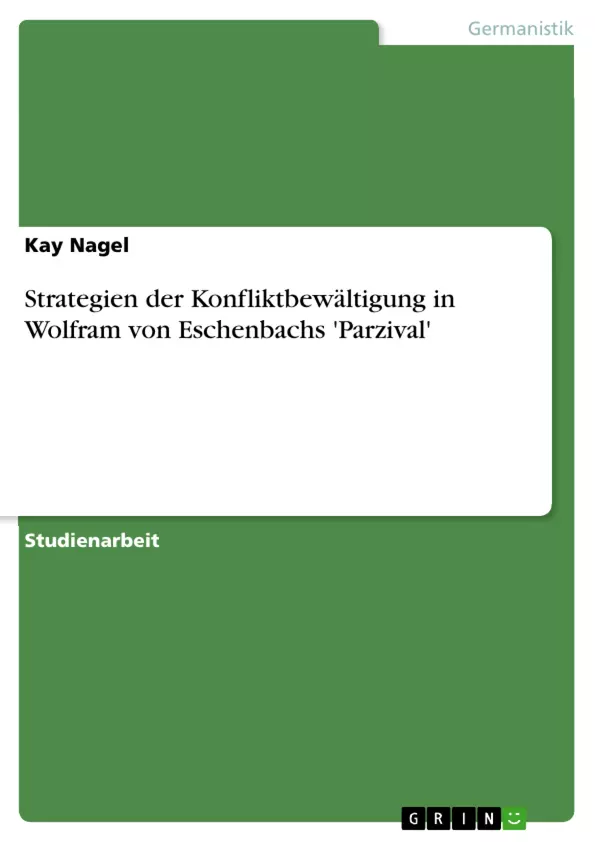Mit der geheimnisvollen Welt der Gralsburg konstruiert Wolfram von Eschenbach eine geistlich angelegte Parallelhandlung zum herkömmlichen Artusroman Hartmannscher Prägung. Das Grundprinzip der Entwicklung des Helden und die Doppelwegstruktur bleiben sowohl in der Artus- als auch in der Gralswelt erhalten. Doch die Bewährung des Helden verläuft natürlich nicht problemlos; vielmehr gilt es, Konflikte zu erkennen, zu lösen und zu bewältigen. Dass dabei dem spirituell angelegten Parzival andere Konfliktlösungsstrategien zugeordnet werden als dem Artusritter Gawan, ist Gegenstand dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Introductio
- Drei Helden – zwei Welten
- Die Konflikte der Helden und deren Bewältigungsstrategien
- Gahmuret zwischen Kampf und Minne
- Parzival im Konflikt mit Höfischkeit und Gott
- Verlust und Wiedergewinnung der ritterlichen êre
- Der zwivel als Gefahr für das göttliche Heil
- Gawan und die Lösung zwischenmenschlicher Konflikte
- Die Konfliktentschärfung als Minneritter
- Gawan als Opfer im Kampf der Emotionen
- Erlösung durch Gawan und Versöhnung durch Artus
- Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Strategien der Konfliktbewältigung in Wolframs von Eschenbachs ,Parzival'. Sie untersucht, wie die Protagonisten Gahmuret, Parzival und Gawan mit Konflikten in den beiden Welten des Artusrittertums und der Gralswelt umgehen. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob bestimmte Handlungsmuster an die Zugehörigkeit zu einem der beiden Rittergeschlechter gebunden sind.
- Untersuchung der Konfliktarten und -bewältigungsstrategien in den beiden Welten
- Analyse der Handlungsmuster der Protagonisten in Konfliktsituationen
- Bedeutung der Minne und des Kampfes in der Artuswelt
- Die Rolle des Grals und die mystische Dimension der Gralswelt
- Die Entwicklung der Protagonisten im Laufe der Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
Introductio
Die Einleitung stellt den Kontext des Themas Konfliktbewältigung in der deutschen Artusepik des Mittelalters dar. Am Beispiel von Hartmanns von Aues ,Erec' wird gezeigt, wie ein Protagonist mit Konflikten umgeht und welche Folgen diese für ihn haben können. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Reifeprozessen und der Entwicklung des Protagonisten im Laufe der Handlung.
Drei Helden – Zwei Welten
Dieses Kapitel beleuchtet die beiden Welten des ,Parzival': die Artuswelt und die Gralswelt. Es werden die charakteristischen Merkmale beider Welten und ihre jeweiligen Wertvorstellungen erläutert. Die Artuswelt wird als klassische Ritterwelt mit Betonung von Minne und Kampf beschrieben, während die Gralswelt durch ihre mystische Dimension und ihre Fokussierung auf das Göttliche geprägt ist.
Die Konflikte der Helden und deren Bewältigungsstrategien
Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Konfliktbewältigungsstrategien der Protagonisten Gahmuret, Parzival und Gawan. Es wird untersucht, wie sie mit unterschiedlichen Konflikten umgehen und welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben. Der Fokus liegt dabei auf den spezifischen Herausforderungen, die sich aus der Zugehörigkeit zu den beiden Rittergeschlechtern ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Welche Konfliktarten werden in Wolframs 'Parzival' untersucht?
Untersucht werden Konflikte zwischen ritterlicher Ehre (êre), Minne (Liebe), Gottestreue und zwischenmenschlichen Beziehungen.
Wie unterscheidet sich Parzival von Gawan in der Konfliktlösung?
Parzival folgt einem spirituellen Weg der Läuterung, während Gawan als klassischer Artusritter eher weltliche und zwischenmenschliche Konflikte entschärft.
Was bedeutet 'zwivel' im Kontext von Parzival?
Der 'zwivel' (Zweifel/Wankelmut) gilt als Gefahr für das göttliche Heil und ist ein zentraler innerer Konflikt, den Parzival überwinden muss.
Welche Rolle spielt Gahmuret in der Arbeit?
Gahmuret wird als Figur analysiert, die im Spannungsfeld zwischen kriegerischem Kampf und der Verpflichtung durch die Minne steht.
Was ist die Doppelwegstruktur im Artusroman?
Sie beschreibt den Weg des Helden, der nach einem ersten Erfolg tief fällt (Krise) und sich durch eine zweite Bewährungsphase wahre Reife erarbeiten muss.
- Quote paper
- Kay Nagel (Author), 2008, Strategien der Konfliktbewältigung in Wolfram von Eschenbachs 'Parzival', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155486