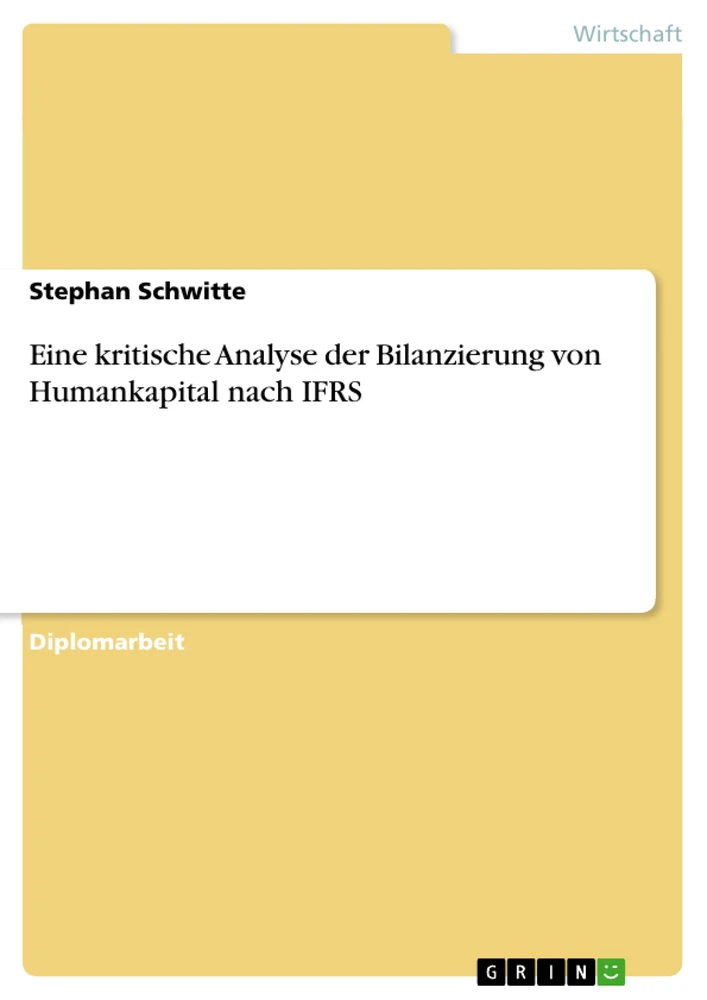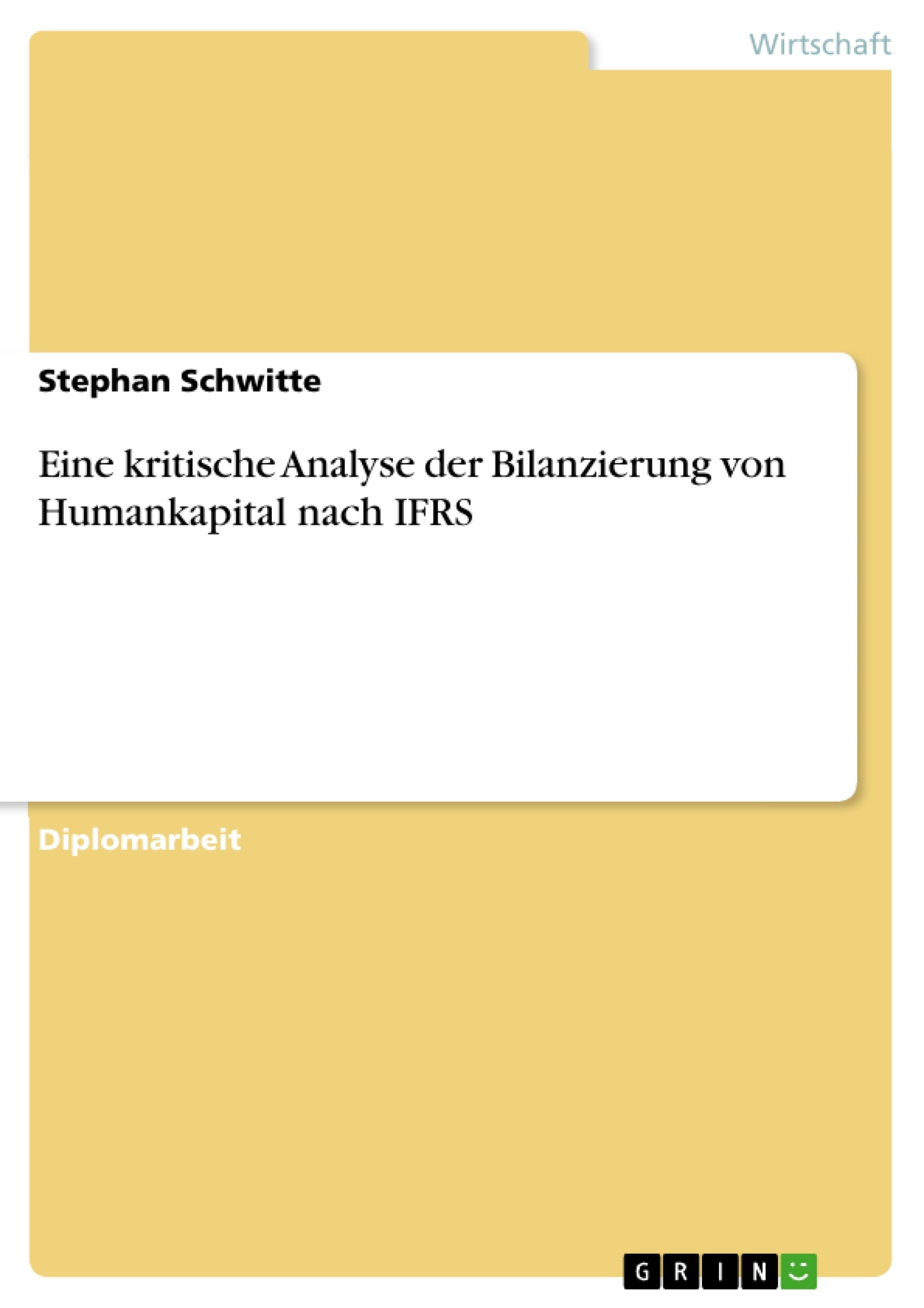Der durch die multiplen Veränderungen im Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschehen bedingte Strukturwandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft geht mit einer erhöhten Bedeutung immaterieller Werte für den Leistungsprozess von Unternehmen einher. Immaterielle Werte wie Kundenbeziehungen, Marken und Humankapital stellen für eine wachsende Zahl an Unternehmen zentrale Erfolgsdeterminanten dar und beeinflussen als Werttreiber maßgeblich die Höhe des Unternehmenswertes, so dass sich dieser zunehmend weniger durch materielle und finanzielle Vermögenswerte bestimmt. Daher beziehen nicht zuletzt potentielle Investoren, die ihre Investitionsentscheidung regelmäßig am Wert eines Unternehmens ausrichten, immaterielle Werte verstärkt in ihr Entscheidungskalkül ein.
Da es als einziger immaterieller Wert unmittelbar an den im Unternehmen beschäftigten Mitarbeitern gebunden ist, nimmt Humankapital innerhalb der immateriellen Werte eine exponierte Stellung ein.5 Obschon die Belegschaft eines Unternehmens vielfach in der Öffentlichkeit u.a. in Folge der medialen Berichterstattung über betriebliche Restrukturierungs- oder Rationalisierungsmaßnahmen lediglich als reiner Kostenfaktor für Unternehmen wahrgenommen wird,6 zeigen die in den letzten Jahren stetig gestiegenen betrieblichen Investitionen in die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern, dass Unternehmen im mitarbeiterbezogenen Humankapital zunehmend einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor sehen.7 Dieser Bedeutungsgewinn von Humankapital wird durch empirische Studien bestätigt, die Humankapital als bedeutendste Komponente der immateriellen Werte einstufen8 und ihm dadurch den stärksten Einfluss auf den langfristigen Unternehmenserfolg beimessen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Grundlagen der Analyse
- 2.1 Definition und Abgrenzung grundlegender Begriffe
- 2.1.1 Immaterielle Werte
- 2.1.2 Humankapital
- 2.2 Zielsetzung und Grundsätze der Rechnungslegung nach IFRS
- 3 Bilanzierung von Humankapital nach IFRS
- 3.1 Bilanzierung von Humankapital als immaterieller Vermögenswert
- 3.1.1 Ansatzkonzeption und Zugangsarten immaterieller Vermögenswerte
- 3.1.2 Anwendung der Ansatzkonzeption auf Humankapital
- 3.1.2.1 Abstrakte Bilanzierungsfähigkeit von Humankapital
- 3.1.2.2 Konkrete Bilanzierungsfähigkeit von Humankapital
- 3.1.3 Bilanzierung von Humankapital in Abhängigkeit der Zugangsart
- 3.1.3.1 Zugang von Humankapital durch Einzelerwerb
- 3.1.3.2 Zugang von Humankapital durch Selbsterstellung
- 3.1.3.3 Zugang von Humankapital im Rahmen eines Unternehmens-erwerbs
- 3.1.4 Exkurs: Bilanzierung von Spielervermögen im Profisport
- 3.2 Humankapital als Bestandteil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktivierungsfähiger Vermögenswerte
- 3.3 Berichterstattungspflichten über Humankapital
- 4 Kritische Würdigung der Bilanzierung von Humankapital vor dem Hintergrund der Primärgrundsätze der IFRS
- 4.1 Relevanz
- 4.2 Verlässlichkeit
- 4.3 Vergleichbarkeit
- 4.4 Zusammenfassende Würdigung
- 5 Möglichkeiten und Grenzen einer erweiterten bilanziellen und außerbilanziellen Abbildung von Humankapital
- 5.1 Erweiterte bilanzielle Abbildung von Humankapital
- 5.2 Erweiterte Berichterstattung in außerbilanziellen Informationsinstrumenten
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit einer kritischen Analyse der Bilanzierung von Humankapital nach IFRS. Ziel ist es, die aktuellen Regelungen und ihre Anwendungspraxis im Hinblick auf die Erfassung von Humankapital in der Bilanz zu untersuchen. Dabei werden die zentralen Herausforderungen und Probleme sowie die potenziellen Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzierung von Humankapital im Fokus stehen.
- Definition und Abgrenzung von immateriellen Werten und Humankapital
- Zielsetzung und Grundsätze der Rechnungslegung nach IFRS
- Bilanzierung von Humankapital als immaterieller Vermögenswert
- Kritische Würdigung der Bilanzierung von Humankapital im Lichte der Primärgrundsätze der IFRS
- Möglichkeiten und Grenzen einer erweiterten bilanziellen und außerbilanziellen Abbildung von Humankapital
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problemstellung und die Relevanz der Bilanzierung von Humankapital im Kontext der IFRS-Rechnungslegung. Das zweite Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse fest, indem es zentrale Definitionen und Abgrenzungen zu immateriellen Werten und Humankapital erläutert und die Zielsetzung und Grundsätze der IFRS-Rechnungslegung darlegt.
Das dritte Kapitel analysiert die Bilanzierung von Humankapital nach IFRS, wobei die Ansatzkonzeption und Zugangsarten von immateriellen Vermögenswerten im Vordergrund stehen. Insbesondere wird die konkrete und abstrakte Bilanzierungsfähigkeit von Humankapital beleuchtet.
Das vierte Kapitel widmet sich der kritischen Würdigung der Bilanzierung von Humankapital vor dem Hintergrund der Primärgrundsätze der IFRS. Relevanz, Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der Bilanzierung werden in diesem Kontext untersucht.
Das fünfte Kapitel beleuchtet Möglichkeiten und Grenzen einer erweiterten bilanziellen und außerbilanziellen Abbildung von Humankapital.
Schlüsselwörter
Humankapital, IFRS, Bilanzierung, immaterielle Vermögenswerte, Primärgrundsätze, Relevanz, Verlässlichkeit, Vergleichbarkeit, erweiterte bilanzielle Abbildung, außerbilanzielle Berichterstattung.
Häufig gestellte Fragen
Warum gewinnt Humankapital in der modernen Wirtschaft an Bedeutung?
Im Strukturwandel zur Dienstleistungsgesellschaft sind Wissen und Fähigkeiten der Mitarbeiter zentrale Erfolgsfaktoren und maßgebliche Werttreiber für den Unternehmenswert.
Kann Humankapital nach IFRS als immaterieller Vermögenswert aktiviert werden?
Die Aktivierung ist schwierig, da das Unternehmen oft keine ausreichende Verfügungsmacht über die Mitarbeiter hat (kein Eigentum) und der künftige Nutzen schwer verlässlich messbar ist.
Was sind die Primärgrundsätze der IFRS bei der Bilanzierung?
Zentrale Grundsätze sind Relevanz, Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der Informationen für die Abschlussadressaten (insbesondere Investoren).
Wie wird Spielervermögen im Profisport bilanziell behandelt?
Im Profisport (z.B. Fußball) wird Spielervermögen oft als immaterieller Vermögenswert aktiviert, da Transferrechte eine Form der rechtlichen Kontrolle darstellen, die im normalen Arbeitsrecht fehlt.
Gibt es Alternativen zur Bilanzierung von Humankapital?
Da eine bilanzielle Erfassung oft an den IFRS-Regeln scheitert, gewinnt die erweiterte Berichterstattung in außerbilanziellen Informationsinstrumenten an Bedeutung.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Kfm. Stephan Schwitte (Autor:in), 2009, Eine kritische Analyse der Bilanzierung von Humankapital nach IFRS, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155547