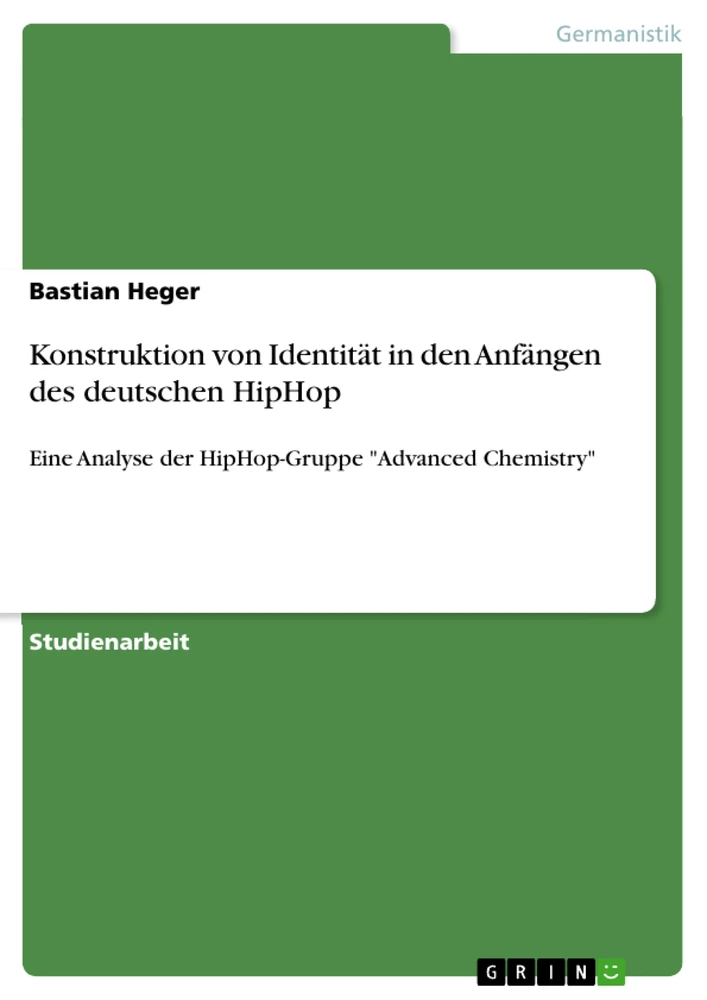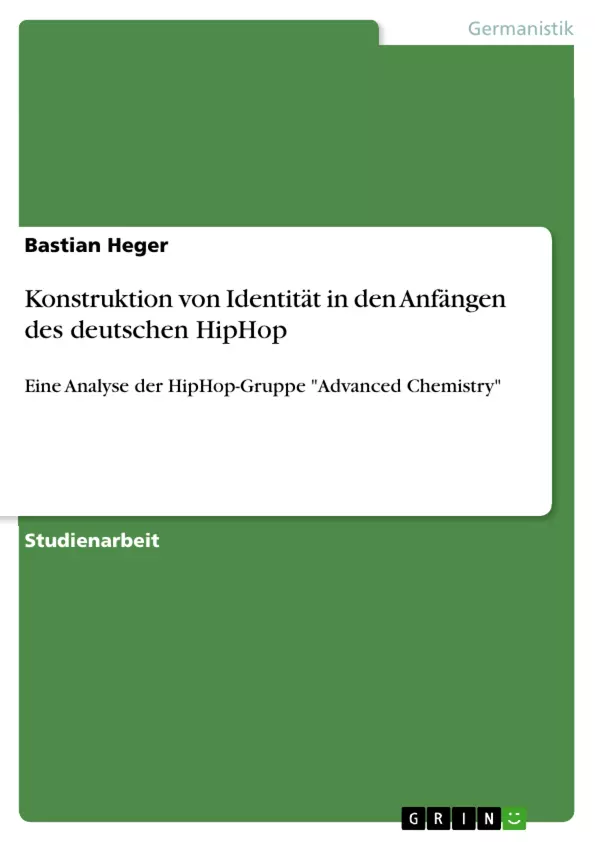(...)
Innerhalb der Linguistik beschäftigt sich auch die Pragmatik mit den Phänomenen des HipHop. Pragmatische Untersuchungen basieren auf dem konstruktivistischen Ansatz, der „Sprache als Medium und Werkzeug der kommunikativen Hervorbringung von sozialer Identität“ (Birkner 2002; S. 242) betrachtet und dadurch ein fixes, statisches Identitätskonzept durch ein flüssiges, wandelbares Identitätsverständnis (vgl. Androutsopoulos 2005; S. 161) ersetzt: Man spricht in diesem Zusammenhang vom Konzept der Konstruktion von Identität , welches den theoretischen Rahmen für die vorliegende Untersuchung bildet. Die besondere Rolle, die der konstruktivistische Ansatz bei der Betrachtung von HipHop spielt, hebt Menrath (2003; S. 218f.) hervor: „In der künstlerischen Praxis kristallisiert die Persönlichkeit eines HipHoppers. Die Identität des einzelnen HipHoppers ist ein dynamischer Prozess […] Ohne Performance gibt es keinen HipHop.“ Die vorliegende Arbeit untersucht eben diese ständige performative Inszenierung von Identität in den Anfängen des deutschen HipHop. Exemplarisch für diese Zeit wird die HipHop-Gruppe Advanced Chemistry einer Analyse unterzogen. Nach einigen Vorbemerkungen, in denen in der gebotenen Kürze ein Einstieg in die HipHop-Kultur gegeben (1.1.) und die Gruppe und ihre Mitglieder vorgestellt wird (1.2.), steht die Konstruktion von Identität bei Advanced Chemistry im Zentrum des Interesses. Den Untersuchungsgegenstand stellen Rap-Texte der Gruppe aus den Jahren 1992 bis 1995 dar (siehe IV.1.) , wobei vereinzelt auch ein Interview miteinbezogen wird. Die Analyse gliedert sich den häufigsten Themen der Lieder von Advanced Chemistry folgend in zwei Teile: Während zunächst die Aussagen innerhalb der Thematik der Sozialkritik (2.1.) im Fokus stehen sollen, werden im zweiten Teil die Äußerungen im Bereich des Szenediskurses (2.2.) behandelt . Beide Gliederungspunkte gleichen sich in ihrem Aufbau: Auf eine Untersuchung der inhaltlichen Beschreibung der Sachverhalte folgt eine Analyse der sprachlichen Darstellung. Die Leitfrage, der bei der Analyse nachzugehen sein wird, lautet dabei: Welche Identität wird von den Mitgliedern von Advanced Chemistry konstruiert und wie wird diese auf sprachlicher Ebene realisiert?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Hauptteil: Analyse der HipHop-Gruppe Advanced Chemistry
- 1. Vorbemerkungen
- 1.1. Einstieg in die HipHop-Kultur
- 1.2. Vorstellung der Gruppe Advanced Chemistry
- 2. Konstruktion von Identität
- 2.1. Sozialkritik: Fremd im eigenen Land
- 2.1.1. Beschreibung der Situation von Migranten in Deutschland
- 2.1.2. Sprachliche Darstellung
- 2.2. Szenediskurs: HipHop lebt im Untergrund
- 2.2.1. Vermittlung von HipHop-Kultur
- 2.2.2. Sprachliche Darstellung
- 2.1. Sozialkritik: Fremd im eigenen Land
- 1. Vorbemerkungen
- III. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Konstruktion von Identität im deutschen HipHop der frühen 1990er-Jahre. Sie analysiert die Rap-Texte der Gruppe Advanced Chemistry und untersucht, wie diese die Identität ihrer Mitglieder auf sprachlicher Ebene gestalten. Das Ziel der Arbeit ist es, das Konzept der Identitätskonstruktion im Kontext des deutschen HipHop zu beleuchten und aufzuzeigen, wie die Gruppe Advanced Chemistry dieses Konzept in ihren Texten umsetzt.
- Die Entwicklung der HipHop-Kultur in den USA und ihre Verbreitung in Deutschland
- Die Rolle von Sprache als Werkzeug zur Gestaltung von Identität
- Die Themen der Sozialkritik und des Szenediskurses in den Rap-Texten von Advanced Chemistry
- Die sprachlichen Mittel, die von Advanced Chemistry zur Konstruktion ihrer Identität eingesetzt werden
- Der Einfluss des konstruktivistischen Ansatzes auf das Verständnis von Identität im HipHop
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Identitätskonstruktion im Kontext von HipHop ein und stellt den theoretischen Rahmen der Arbeit vor. Sie erläutert das Konzept der konstruktivistischen Identität und hebt die Bedeutung von HipHop als performative Inszenierung von Identität hervor.
Der Hauptteil der Arbeit analysiert die HipHop-Gruppe Advanced Chemistry und ihre Texte. Er beginnt mit einer kurzen Vorstellung der Gruppe und der Entstehung der HipHop-Kultur. Der Fokus liegt auf den Themen Sozialkritik und Szenediskurs in den Texten. Die Analyse zeigt, wie die Gruppe Advanced Chemistry in ihren Texten mit den Themen der Migration, der Diskriminierung und der HipHop-Szene umgeht und wie sie ihre Identität in Bezug auf diese Themen konstruiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind HipHop-Kultur, Identitätskonstruktion, Sozialkritik, Szenediskurs, Advanced Chemistry, Rap-Texte, Sprachliche Darstellung, Migranten, Diskriminierung, Performativität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Arbeit über deutschen HipHop?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von Identität in den Anfängen des deutschen HipHop, insbesondere am Beispiel der Gruppe Advanced Chemistry zwischen 1992 und 1995.
Welcher theoretische Ansatz wird für die Analyse verwendet?
Es wird der konstruktivistische Ansatz der Linguistik und Pragmatik genutzt, der Sprache als Werkzeug zur kommunikativen Hervorbringung sozialer Identität betrachtet.
Welche Rolle spielt die Gruppe Advanced Chemistry in der Untersuchung?
Advanced Chemistry dient als exemplarisches Beispiel für die performative Inszenierung von Identität, wobei Themen wie Sozialkritik und der Diskurs innerhalb der HipHop-Szene analysiert werden.
Wie wird Identität im Kontext von HipHop definiert?
Identität wird nicht als statisches Konzept, sondern als flüssiger, wandelbarer und dynamischer Prozess verstanden, der maßgeblich durch die künstlerische Performance entsteht.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzt die Analyse der Rap-Texte?
Die Analyse gliedert sich in zwei Teile: die Thematik der Sozialkritik (z. B. Umgang mit Migration und Diskriminierung) und den Bereich des Szenediskurses.
Welche Zeitspanne umfasst der untersuchte Gegenstand?
Der Fokus liegt auf den Jahren 1992 bis 1995, in denen die untersuchten Rap-Texte von Advanced Chemistry entstanden sind.
- Citar trabajo
- B.A. Bastian Heger (Autor), 2009, Konstruktion von Identität in den Anfängen des deutschen HipHop, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155587