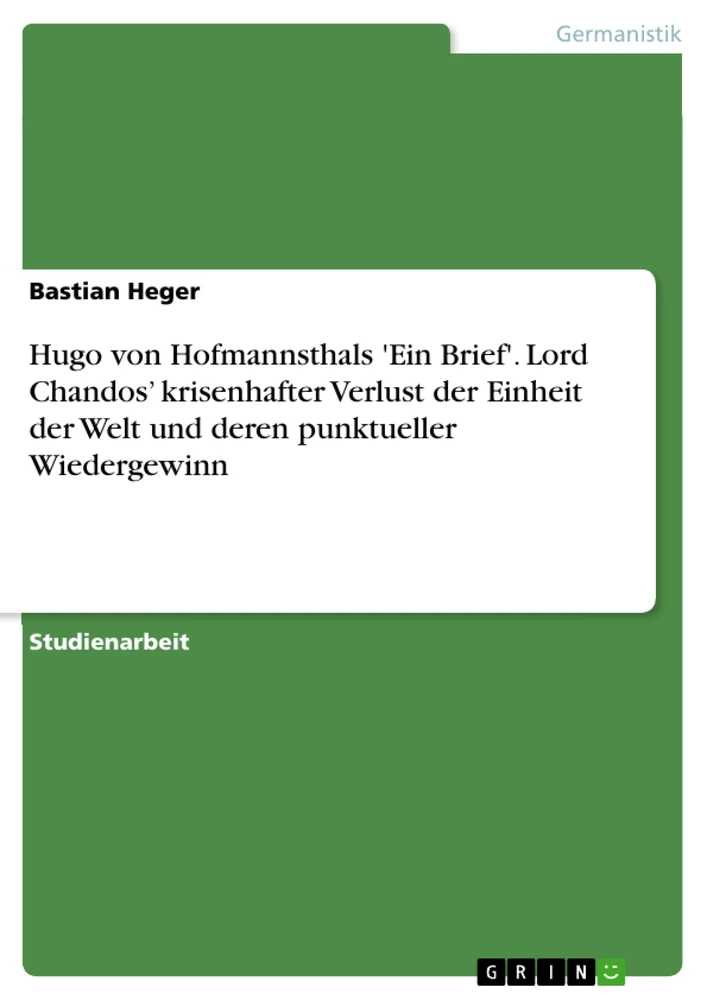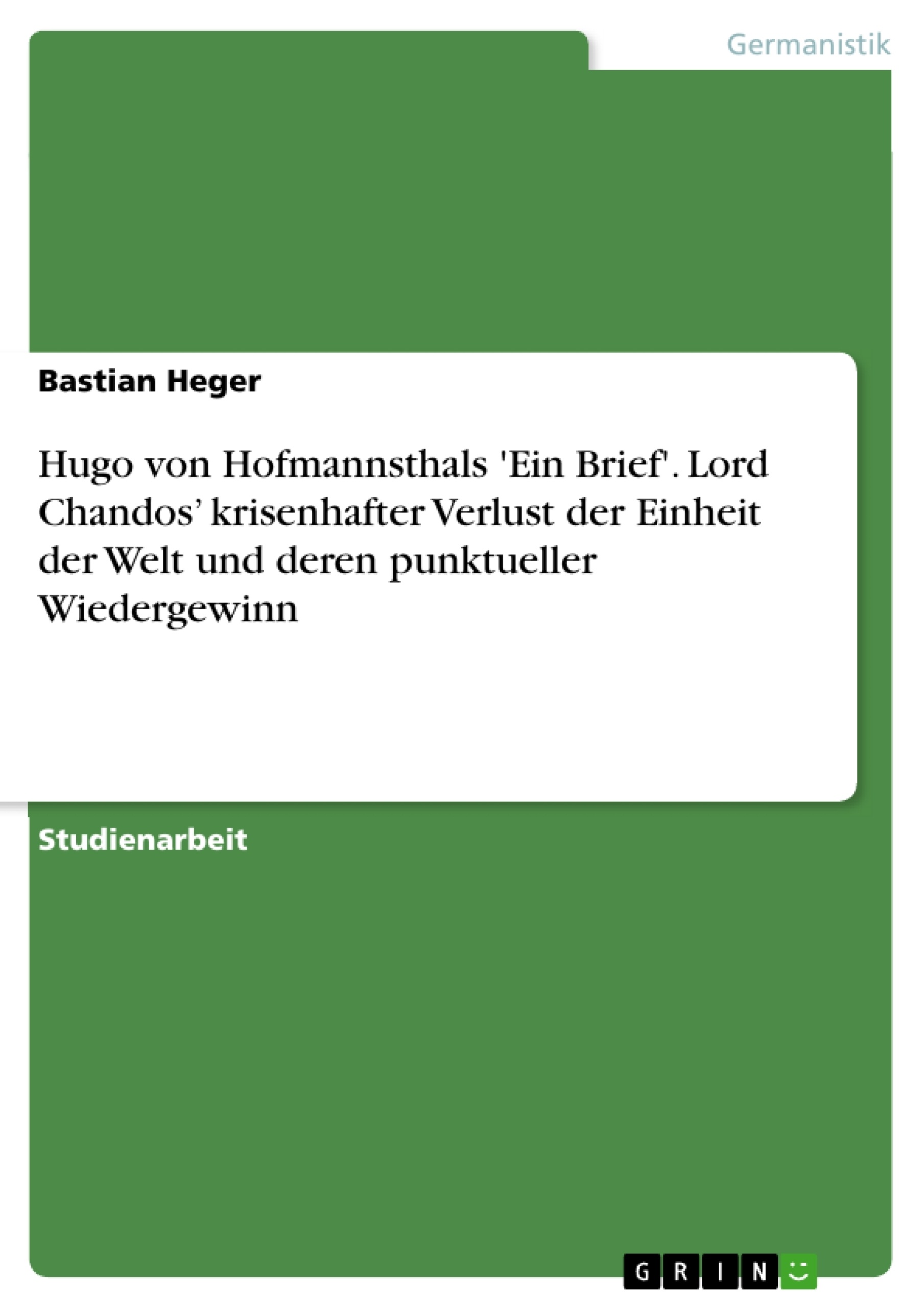Hugo von Hofmannsthals "Ein Brief", auch Chandos-Brief genannt, wurde seit seiner Erstveröffentlichung in der Berliner Zeitung „Der Tag“ im Jahre 1902 zum Gegenstand zahlreicher literaturwissenschaftlicher Untersuchungen und gab Anlass zu den unterschiedlichsten Interpretationen. Häufig wurde der fiktive Brief, in dem Lord Chandos 1603 seinen Verzicht auf literarische Betätigung vor seinem einstigen Meister Francis Bacon rechtfertigt, auf die Biographie Hofmannsthals bezogen und in Chandos’ Sprachkrise eine ähnliche Störung des jungen Hofmannsthal in seinem Verhältnis zur Sprache gesehen.
Die vorliegende Arbeit will diese biographische Einengung überwinden und eine Deutung des Chandos-Briefes auf textimmanenter Ebene unternehmen.
Um den Text verstehen zu können, ist es notwendig, den historischen Rahmen und dessen Bedeutung für das Werk zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck werden zunächst einmal Chandos’ geschichtliche Zeit, die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, und der Empfänger des Briefes, die historische Persönlichkeit Francis Bacon, einer näheren Beleuchtung unterzogen.
Die Analyse des Textes folgt daraufhin einer systematischen Dreiteilung des Werkes: Zunächst wird auf Chandos’ Vergangenheit, sein Leben vor der Krise, einzugehen sein, wobei mittels einer Untersuchung seiner Frühwerke und literarischer Pläne der Frage nach seinem vorkrisenhaften Welt- und Sprachverständnis sowie nach seiner Erkenntnisweise nachzugehen sein wird. In der Betrachtung der Krise wird die Tragweite Chandos’ literarischer Pläne im Bezug auf seine Krisis analysiert und deren Ausmaß aufgezeigt.
Im dritten Teil wird anschließend Chandos gegenwärtiger Zustand, sein Leben mit der krisenhaften Erfahrung, unter die Lupe genommen, wobei mit Hilfe einer Gegenüberstellung der alten und neuen Erkenntnisweise, die sich in den guten Augenblicken manifestiert, untersucht wird, inwieweit es sich bei Chandos’ neuer Verfassung um einen beklagenswerten Zustand oder doch um eine Verfassung gesteigerten Glücks handelt.
Vor dem Hintergrund der mit „herkömmlicher Sprache“ unbeschreibbaren Momente wird außerdem der Versuch unternommen, den scheinbaren Widerspruch zwischen Chandos’ Schreibfähigkeit auf der einen und seiner schwerwiegenden Sprachkrise auf der anderen Seite zu erklären. In einer Schlussbetrachtung werden die gesammelten Ergebnisse schließlich zusammenzufassen sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 0. Der historische Hintergrund
- 0.1 Die Zeit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert
- 0.2 Francis Bacon
- 1. Chandos vor der Krise: Das ganze Dasein als eine große Einheit
- 1.1 Die Frühwerke
- 1.2 Die literarischen Pläne
- 2. Die Krise: Es zerfiel mir alles in Teile
- 2.1 Die Gründe der Krise
- 2.2 Das Ausmaß der Krise
- 3. Chandos' Leben mit der Krisenerfahrung
- 3.1 Die guten Augenblicke: Diese mich und die ganze Welt durchwebende Harmonie
- 3.2 Die ideale Sprache
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Hugo von Hofmannsthals „Ein Brief“, auch bekannt als Chandos-Brief, mit dem Ziel, eine textimmanente Deutung zu liefern, die sich von biographischen Interpretationen abgrenzt. Die Arbeit beleuchtet die Krise des fiktiven Briefschreibers Lord Chandos im Kontext seines Welt- und Sprachverständnisses.
- Chandos' Welt- und Sprachverständnis vor der Krise
- Die Ursachen und Auswirkungen von Chandos' Sprachkrise
- Chandos' Suche nach einer neuen Erkenntnisweise und einer idealen Sprache
- Die Beziehung zwischen Chandos' Krise und dem historischen Kontext der Zeit
- Der Einfluss von Francis Bacon auf Chandos' Gedankenwelt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den historischen Hintergrund des Textes, beleuchtet die Zeit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert und die Rolle von Francis Bacon. Kapitel 1 befasst sich mit Chandos' Leben vor der Krise und analysiert seine Frühwerke sowie seine literarischen Pläne. Kapitel 2 widmet sich der Sprachkrise Chandos', ihren Ursachen und ihrem Ausmaß. Kapitel 3 untersucht Chandos' gegenwärtigen Zustand, sein Leben mit der Krisenerfahrung, und erörtert die Suche nach einer neuen Erkenntnisweise und einer idealen Sprache.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Sprachkrise, Weltverständnis, Erkenntnisweise, ideale Sprache, historische Kontext, Francis Bacon, Empirismus, Induktion, Trugbilder (Idole), Chandos-Brief.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Chandos-Brief“ von Hugo von Hofmannsthal?
Es ist ein fiktiver Brief aus dem Jahr 1902, in dem Lord Chandos seinen Verzicht auf literarische Arbeit aufgrund einer tiefgreifenden Sprachkrise erklärt.
Wer ist der Adressat des Briefes?
Der Brief ist an den historischen Philosophen Francis Bacon gerichtet, der für Empirismus und wissenschaftliche Methodik steht.
Was sind die Ursachen für Chandos' Sprachkrise?
Chandos verliert die Fähigkeit, die Welt als Einheit wahrzunehmen; Begriffe zerfallen ihm im Mund, und er kann keine abstrakten Urteile mehr bilden.
Was versteht Chandos unter „guten Augenblicken“?
Es sind Momente gesteigerten Glücks, in denen er eine tiefe Harmonie mit alltäglichen Dingen empfindet, die sich jedoch nicht mit herkömmlicher Sprache beschreiben lassen.
Gibt es einen Widerspruch zwischen der Schreibfähigkeit und der Sprachkrise?
Die Arbeit untersucht, wie Chandos einen so eloquenten Brief über das Unvermögen zu schreiben verfassen konnte, was oft als Paradoxon der Moderne gedeutet wird.
- Arbeit zitieren
- B.A. Bastian Heger (Autor:in), 2008, Hugo von Hofmannsthals 'Ein Brief'. Lord Chandos’ krisenhafter Verlust der Einheit der Welt und deren punktueller Wiedergewinn, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155591