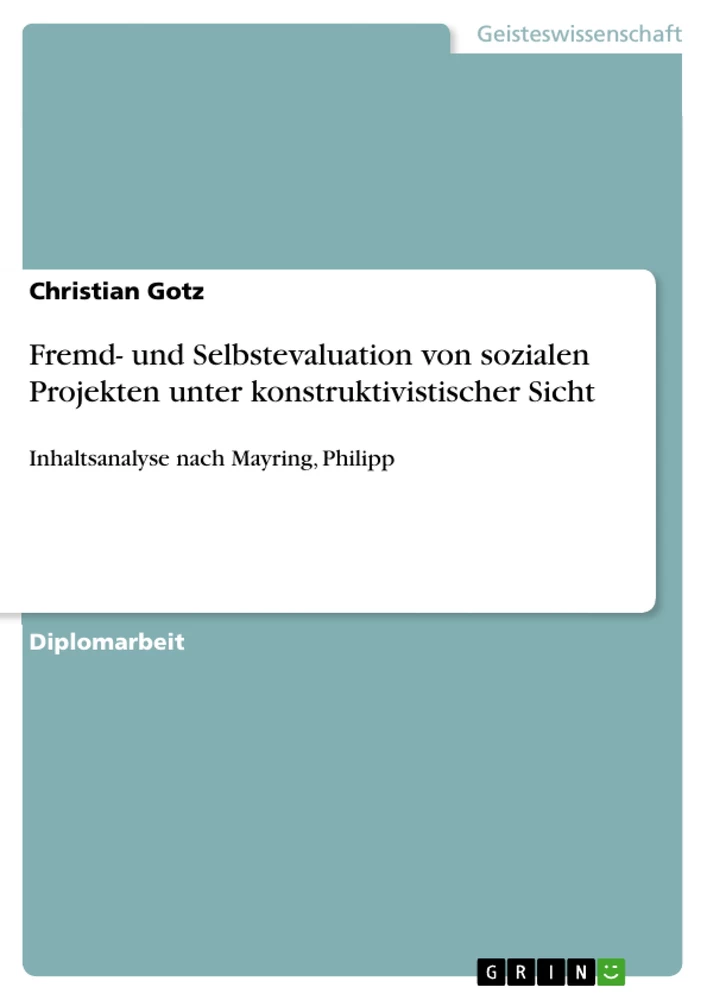[...] Nach einer ersten Annäherung an den Begriff Konstruktivismus, spüre ich
den philosophischen Wurzeln nach. Hier lassen sich einige Anfänge
späterer Erkenntnisse finden. Ziel meiner Betrachtungen im zweiten Kapitel ist es, Kriterien zu finden, die eine Auswertung von Projekten im sozialen
Bereich erfüllen muss.
Die neueren philosophischen Einsichten des Konstruktivismus stelle ich mit
Arbeiten von Helmut Willke, Heinz von Foerster, George Spencer Brown,
Gregory Bateson, Ernst von Glasersfeld und Niklas Luhmann dar.
In diesem Kapitel werde ich auch konstruktivistische Beiträge aus eher
naturwissenschaftlichen Betrachtungen anführen. Mit einem Modell der
Neurobiologen Humberto Maturana und Francisco Varela soll das
Gedankengebäude des Konstruktivismus für diese Arbeit vervollständigt
werden. Ihre Richtung nennt sich radikaler Konstruktivismus, weil sie die
Theorie am fundamentalsten herleitet und am weitesten denkt.
Neben dem radikalen Konstruktivismus fand ich auch im Sozialkonstruktivismus
und symbolischen Interaktionismus wichtige Bausteine für meine
Kriterienliste.
Mit der Auflistung von Kategorien befasse ich mich in Kapitel 3. Dort fasse
ich alle wichtigen Kriterien für die Untersuchung von sozialen Projekten
zusammen.
Die, in meinen Augen, dazu geeignete Auswertungstechnik stelle ich im
darauffolgenden Kapitel 4 vor. Hier leite ich mit einer kleinen Historie zum
Thema ein und stelle dann die wesentlichen Schritte dieses Auswertungsverfahrens
vor. Hierbei zeige ich, wo meine konstruktivistischen Kriterien in
den Auswertungsregeln erfüllt werden.
Eine spezielle Form qualitativer Auswertungsverfahren stellt die Evaluation
dar. Diese ist auf die Begleitung und Beurteilung von Projekten
spezialisiert. Deshalb wurde sie für mich zum Instrument der Wahl. Im
fünften Kapitel zeige ich die Entstehung und Entwicklung von Evaluation in
der Bundesrepublik auf.
Im nächsten, dem Kapitel 6, vertiefe und erläutere ich die verschiedenen
Aspekte von Evaluation heute. Mit dieser Struktur stelle ich auch das
Projekt help! vor.
Kapitel 7 skizziert die Planung von Evaluation und stellt parallel dazu das
Vorgehen meiner Projektbegleitung dar.
Schließlich stelle ich in Kapitel 8 die qualitative Auswertungstechnik vor, mit
der ich das konkrete Projekt evaluieren will. Auch hier bildet das konkrete
Projekt den Mittelpunkt der Darstellung – während die theoretischen
Überlegungen flankieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konstruktivismus als Grundlage der Evaluation
- 2.1 Überblick des zweiten Kapitels
- 2.2 Realität und Wirklichkeit
- 2.3 Philosophische Wurzeln
- 2.4 Codieren und Decodieren?
- 2.5 Naturwissenschaftliche Einsichten
- 2.5.1 Die Relativitätstheorie Einsteins
- 2.5.2 Die Autopoiesis nach Maturana und Varela
- 2.6 ,,Neuere\" philosophische Einsichten
- 2.6.1 Kybernetik und Konstruktivismus
- 2.6.2 Die nichttriviale Maschine
- 2.6.3 Unterscheiden und Benennen
- 2.6.4 Ernst von Glasersfeld und Viabilität
- 2.6.5 Sozialkonstruktivismus und symbolischer Inter-aktionismus
- 3. Kriterien für konstruktivistische Auswertungen
- 4. Qualitative Auswertungsmethoden
- 4.1 Geschichtliche Wurzeln
- 4.1.1 Aristotelisches Wissenschaftsverständnis
- 4.1.2 Descartes und Vico
- 4.1.3 Hermeneutik
- 4.2 Meinungen anderer Autoren zu qualitativer Auswertungsmethodik
- 4.3 Die klassischen Auswertungsschritte
- 4.3.1 Wahl des Materials
- 4.3.2 Güterkriterien für die qualitative Datenerhebung
- 4.3.3 Datenbewältigung
- 4.3.4 Kategoriesystem und Gegenstandserschließung
- 4.3.5 Kodierung
- 4.3.6 Reduktion und Vergleich
- 4.3.7 Darstellung der Ergebnisse
- 5. Einblick in die Geschichte der Evaluation in der Sozialen Arbeit in der Bundesrepublik
- 5.1 Vorgeschichte
- 5.2 Nachkriegsdeutschland und die Reformära
- 5.3 Nüchternheit der 80er Jahre
- 5.4 Heutige Situation
- 5.5 Konstruktivismus versus Positivismus in der Evaluationsforschung
- 5.6 Ein vielleicht hilfreicher Blick über den großen Teich
- 5.7 Versöhnung und Blick in die Zukunft
- 5.7.1 Zukunft der Evaluation in Institutionen der Sozialen Arbeit
- 5.7.2 Zukunft der Evaluation in den Tätigkeitsfelder sozialer Arbeit
- 5.7.3 Bedeutung der Evaluation für die Zukunft der Sozialen Arbeit
- 6. Evaluation: Definitionen und Umsetzung am help!-Projekt
- 6.1 Begriffsbestimmung Evaluation?
- 6.2 Auftraggeberfreundlichkeit
- 6.3 Unabhängigkeit des Evaluators
- 6.4 Formativ versus Summativ und Prospektiv versus Retrospektiv
- 6.5 Auswahlkriterien
- 6.6 Verallgemeinerung der Ergebnisse
- 6.7 Interne und externe Evaluation
- 6.8 Dimensionen der Evaluationsforschung
- 6.9 Die Rolle des Evaluators
- 7. Evaluation Planungsfragen
- 7.1 Literaturrecherche
- 7.2 Meine Vorannahmen
- 7.3 Erste Projektbeurteilung
- 7.4 Synchronisierung von Maßnahmeverlauf und Evaluationsverlauf
- 8. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 8.1 Zusammenfassende Inhaltsanalyse
- 8.2 Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
- 8.3 Gründe für die Wahl
- 8.4 Das Gruppeninterview
- 8.4.1 Festlegung des Auswertungsmaterials
- 8.4.2 Analyse der Entstehungssituation
- 8.4.3 Formale Charakteristika des Materials
- 8.4.4 Fragestellung der Analyse
- 8.4.5 Ablaufmodell der Analyse
- 8.5 Interpretation der Ergebnisse
- 9. Fazit meiner Diplomarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Evaluation im Sozialen Bereich, insbesondere mit der Frage, welche Evaluationsmethoden am besten geeignet sind, um Prozesse und Ergebnisse in sozialen Einrichtungen zu beurteilen. Die Arbeit argumentiert, dass eine begleitete Selbstevaluation gegenüber einer reinen Selbstevaluation oder einer ausschließlichen Fremderhebung Vorteile bietet.
- Das Konzept des Konstruktivismus als Grundlage für eine geeignete Evaluationsmethodik
- Die historische Entwicklung der Evaluation in der Sozialen Arbeit in Deutschland
- Die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring als Instrument der Evaluation
- Die Bedeutung von „help! Ihre Erfahrung zählt“ als Beispiel für eine begleitete Selbstevaluation im Sozialen Bereich
- Die Rolle des Evaluators und die Bedeutung der Unabhängigkeit und Auftraggeberfreundlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund der Untersuchung und die Forschungsfrage erläutert. Im zweiten Kapitel wird der Konstruktivismus als theoretischer Rahmen für die Evaluation vorgestellt. Dabei werden die philosophischen Wurzeln des Konstruktivismus beleuchtet sowie naturwissenschaftliche Einsichten wie die Relativitätstheorie Einsteins und die Autopoiesis nach Maturana und Varela.
Kapitel drei behandelt die Kriterien für konstruktivistische Auswertungen, während Kapitel vier die Geschichte und die verschiedenen Methoden der qualitativen Auswertungsforschung beleuchtet. Im fünften Kapitel wird die Geschichte der Evaluation in der Sozialen Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland betrachtet. Dabei wird die Entwicklung von der Vorgeschichte bis zur heutigen Situation beleuchtet.
Das sechste Kapitel stellt die Evaluation am Projekt „help! Ihre Erfahrung zählt“ vor und beschreibt die verschiedenen Aspekte der Evaluation, wie Definition, Umsetzung und die Rolle des Evaluators. Im siebten Kapitel werden die Planungsschritte der Evaluation beleuchtet.
Das achte Kapitel schließlich beschreibt die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring als Evaluationsmethode. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und die Bedeutung der begleiteten Selbstevaluation für die Evaluation im Sozialen Bereich betont.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Evaluation im Sozialen Bereich, insbesondere auf die Methode der begleiteten Selbstevaluation. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind Konstruktivismus, qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, „help! Ihre Erfahrung zählt“, Projektbegleitung, Generationen übergreifende Freiwilligendienste und Qualitätsmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der theoretische Kern dieser Diplomarbeit zur Evaluation?
Die Arbeit nutzt den Konstruktivismus als Grundlage, um soziale Projekte zu bewerten, wobei die Realitätskonstruktion der Beteiligten im Vordergrund steht.
Welche Evaluationsmethode wird in der Arbeit favorisiert?
Der Autor argumentiert für die "begleitete Selbstevaluation", da sie Vorteile gegenüber einer reinen Selbstevaluation oder einer rein externen Fremderhebung bietet.
Was verbirgt sich hinter dem Projekt "help!"?
Das Projekt "help! Ihre Erfahrung zählt" dient als praktisches Fallbeispiel für eine begleitete Selbstevaluation im Bereich generationenübergreifender Freiwilligendienste.
Welche wissenschaftliche Auswertungstechnik wird angewendet?
Es wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring verwendet, um die Daten aus Gruppeninterviews und Projektbegleitungen systematisch auszuwerten.
Welche Konstruktivisten werden in der Arbeit zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf Theoretiker wie Helmut Willke, Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld sowie die Neurobiologen Maturana und Varela.
- Citation du texte
- Christian Gotz (Auteur), 2007, Fremd- und Selbstevaluation von sozialen Projekten unter konstruktivistischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155604