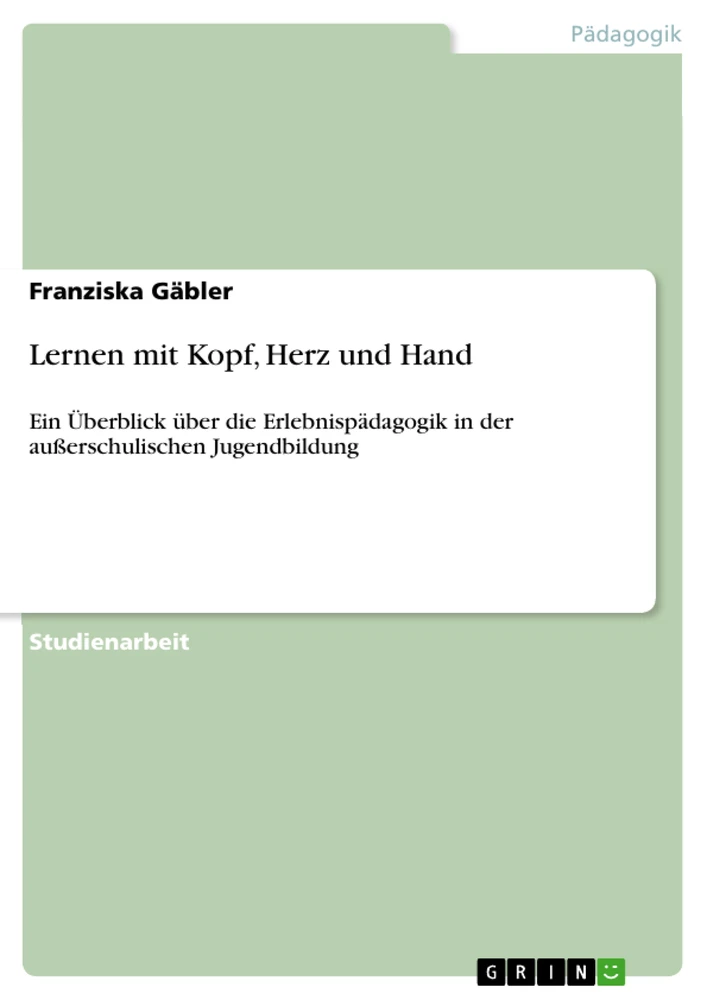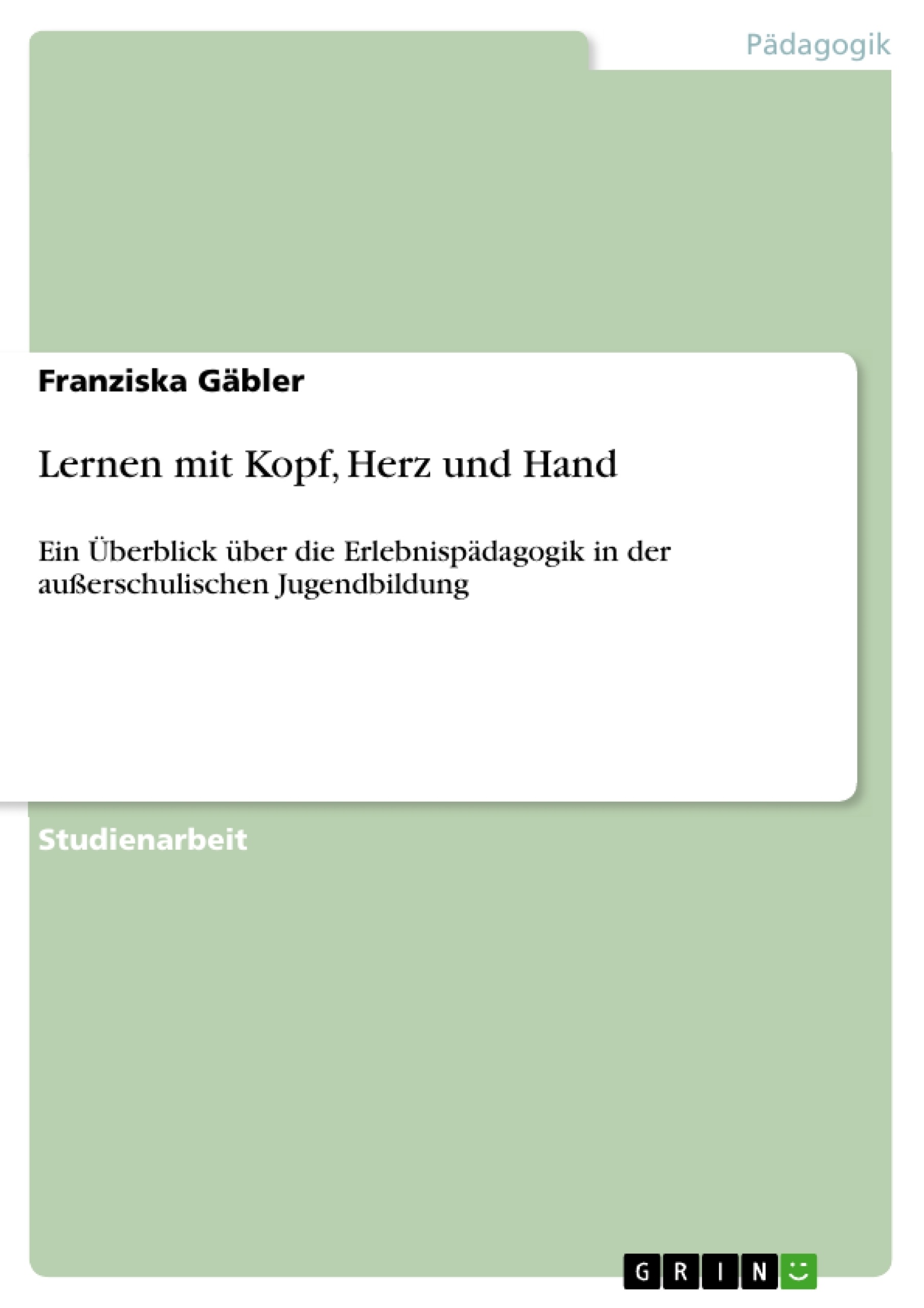Ein jeder kennt sie, die Träume, in denen man als selbstbewusster und vor Glück strotzender Abenteurer durch die Wälder zieht, reißende Flüsse überquert, Abhänge besiegt und selbsterlegtes Wild verzehrt. Wer träumt nicht von solch einem Abenteuer, raus aus dem Globalisierungs- und Konsumdschungel. Einfach nur man selbst sein, stark sein und sich austesten.
Auch in der Pädagogik findet man Action und Abenteuer als Ausdruck neuer Gegenwartsbezogenheit: Leben im Hier und Jetzt. Doch was hat Abenteuer mit Pädagogik zu tun?
Erziehung und Lernen, sei es im Kindergarten, in der Jugendarbeit, in der Jugendhilfe oder in der Erwachsenenbildung soll Spaß machen, soll spannend sein. Die Erlebnispädagogik greift dieses Wissen auf und will durch Erfahrungslernen unsere Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, soziale Kompetenz und Mündigkeit erweitern.
Doch man muss aufpassen, dass man seine Abenteuerträume nicht mit Erlebnispädagogischen Angeboten verwechselt, denn hier geht es nicht um ein Überlebenstraining, sondern um pädagogische Modelle. Eine weitere wichtige Frage, mit der ich mich beschäftigen möchte, ist: Kann Erfahrungslernen etwas zur Persönlichkeitsbildung beitragen und wenn ja, werden die dort gelernten Fähigkeiten in den Alltag umgesetzt?
Im zweiten Kapitel soll es mir darum gehen, inwiefern der Begriff „Erlebnispädagogik“ gerechtfertigt ist oder nicht, denn der Begründer der Erlebnispädagogik, Kurt Hahn, nannte es zu seiner Zeit „Erlebnistherapie“. Pädagogik und Therapie sind jedoch zwei unterschiedliche paar Schuhe. Mit den Vorreitern und dem Begründer Kurt Hahn soll es im dritten Kapitel weiter gehen. Ich möchte von der Epoche der Aufklärung über die Reformpädagogik bis in die heutige Zeit einen geschichtlichen Abriss geben, um die Entwicklung der Gedanken und Ziele im Zeitverlauf nachvollziehen zu können. Dieses Kapitel soll auch eine Antwort auf die Frage geben: Was hat Abenteuer mit Pädagogik zu tun? Ein weiterer wichtiger Punkt, um die Erlebnispädagogik als Wissenschaft anzuerkennen, ist die theoretische Fundierung, mit welcher ich mich in Kapitel vier beschäftigen werde. Die Artikel fünf und sechs sollen mehr Einblick in die Praxis geben. Was für Ziele werden verfolgt, wie werden diese Ziele umgesetzt und welchen Einfluss hat die Erlebnispädagogik in der außerschulischen Jugendbildung? Ein paar Beispiele des Vereins „Tigersprung e.V.“ aus Bamberg sollen einen kleinen Einblick über ausgewählte Angebote gewähren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung Erlebnispädagogik
- 3. Historische Entwicklung
- 3.1 Kurt Hahn als der Begründer
- 3.2 Die erlebnispädagogische Renaissance
- 4. Theoretische Fundierung
- 4.1 Erziehungswissenschaftliche Fundierung
- 4.2 Sozialwissenschaftliche Fundierung
- 4.3 Forschung
- 5. Lernen mit Kopf, Herz und Hand – Leitlinien und Ziele der Erlebnispädagogik
- 6. Die Relevanz der Erlebnispädagogik in der außerschulischen Jugendbildung
- 6.1 Erlebnispädagogik als Erfahrungsfeld für Jugendliche und Pädagogen
- 6.2 Erlebnispädagogische Angebote am Beispiel „Tigersprung e.V.“ Bamberg
- 6.2.1 Klettern
- 6.2.2 Kanu- und Kajakfahren
- 6.2.3 City Bound
- 7. Kritikpunkte - Grenzen der Erlebnispädagogik
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erlebnispädagogik im Kontext der außerschulischen Jugendbildung. Ziel ist es, den Begriff zu klären, die historische Entwicklung nachzuzeichnen, die theoretischen Grundlagen zu beleuchten und die Relevanz für die Jugendarbeit zu analysieren. Schließlich werden kritische Punkte und Grenzen der Erlebnispädagogik diskutiert.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung der Erlebnispädagogik
- Historische Entwicklung und die Rolle von Kurt Hahn
- Theoretische Fundierung in erziehungswissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Hinsicht
- Ziele und Methoden der Erlebnispädagogik
- Relevanz und Anwendung in der außerschulischen Jugendarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Erlebnispädagogik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Beitrag des Erfahrungslernens zur Persönlichkeitsbildung und der Umsetzung der gelernten Fähigkeiten im Alltag. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die einzelnen Kapitel und deren thematische Schwerpunkte.
2. Begriffsklärung Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, den vielschichtigen Begriff „Erlebnispädagogik“ präzise zu definieren. Es werden verschiedene Bezeichnungen wie Abenteuerpädagogik, Aktionspädagogik etc. genannt und die fehlende geschlossene Theorie thematisiert. Der Fokus liegt auf der Vielfältigkeit als Stärke und Chance dieses Ansatzes und dem zentralen Anliegen, Lernen durch Denken, Fühlen und Handeln zu fördern, um eine autonome und sozial kompetente Persönlichkeit zu entwickeln.
3. Historische Entwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Erlebnispädagogik, beginnend mit der Aufklärung und der Reformpädagogik bis zur Gegenwart. Es wird die Rolle von Kurt Hahn als Begründer hervorgehoben und die „erlebnispädagogische Renaissance“ beschrieben. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Gedanken und Ziele im Zeitverlauf und der Beantwortung der Frage nach dem Zusammenhang von Abenteuer und Pädagogik.
4. Theoretische Fundierung: Kapitel vier widmet sich den erziehungswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen der Erlebnispädagogik. Es analysiert die theoretischen Ansätze, die die Praxis der Erlebnispädagogik stützen und legitimieren. Der Abschnitt über Forschung verdeutlicht den wissenschaftlichen Anspruch des Feldes.
5. Lernen mit Kopf, Herz und Hand – Leitlinien und Ziele der Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel beschreibt die Leitlinien und Ziele der Erlebnispädagogik. Es betont die ganzheitliche Förderung der Persönlichkeit durch die Verbindung von Denken, Fühlen und Handeln. Die Wissensvermittlung tritt dabei in den Hintergrund, der Fokus liegt auf der Entwicklung von Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit und sozialer Kompetenz.
6. Die Relevanz der Erlebnispädagogik in der außerschulischen Jugendbildung: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Erlebnispädagogik in der außerschulischen Jugendarbeit. Es betrachtet die Erlebnispädagogik als Erfahrungsfeld für Jugendliche und Pädagogen und liefert konkrete Beispiele aus der Arbeit des Vereins „Tigersprung e.V.“ in Bamberg, wie Klettern, Kanu- und Kajakfahren und City Bound. Die verschiedenen Angebote werden hier exemplarisch beleuchtet, um die Vielfältigkeit der Möglichkeiten aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Erlebnispädagogik, Abenteuerpädagogik, Kurt Hahn, Erfahrungslernen, Persönlichkeitsbildung, Jugendbildung, außerschulische Bildung, soziale Kompetenz, Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, ganzheitliches Lernen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Erlebnispädagogik in der außerschulischen Jugendbildung"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Erlebnispädagogik im Kontext der außerschulischen Jugendbildung. Sie beleuchtet die Begriffsklärung, die historische Entwicklung, die theoretischen Grundlagen, die Relevanz für die Jugendarbeit und kritische Punkte. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den Begriff "Erlebnispädagogik" zu klären, die historische Entwicklung nachzuzeichnen, die theoretischen Grundlagen zu beleuchten und die Relevanz für die Jugendarbeit zu analysieren. Schließlich werden kritische Punkte und Grenzen der Erlebnispädagogik diskutiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsbestimmung und Abgrenzung der Erlebnispädagogik, die historische Entwicklung und die Rolle von Kurt Hahn, die theoretische Fundierung (erziehungswissenschaftlich und sozialwissenschaftlich), die Ziele und Methoden der Erlebnispädagogik sowie deren Relevanz und Anwendung in der außerschulischen Jugendarbeit.
Wer ist Kurt Hahn und welche Rolle spielt er?
Kurt Hahn wird als Begründer der Erlebnispädagogik hervorgehoben. Die Arbeit beleuchtet seine Rolle in der historischen Entwicklung dieses pädagogischen Ansatzes.
Welche theoretischen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die erziehungswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen der Erlebnispädagogik und die theoretischen Ansätze, die die Praxis stützen und legitimieren. Ein Abschnitt widmet sich der Forschung im Bereich der Erlebnispädagogik.
Welche Ziele verfolgt die Erlebnispädagogik?
Die Erlebnispädagogik zielt auf eine ganzheitliche Förderung der Persönlichkeit durch die Verbindung von Denken, Fühlen und Handeln ab. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit und sozialer Kompetenz. Wissensvermittlung tritt dabei in den Hintergrund.
Wie wird die Relevanz der Erlebnispädagogik in der außerschulischen Jugendbildung dargestellt?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Erlebnispädagogik als Erfahrungsfeld für Jugendliche und Pädagogen. Konkrete Beispiele aus der Arbeit des Vereins "Tigersprung e.V." in Bamberg (Klettern, Kanu/Kajakfahren, City Bound) veranschaulichen die Vielfältigkeit der Möglichkeiten.
Welche Kritikpunkte und Grenzen der Erlebnispädagogik werden diskutiert?
Die Arbeit widmet sich kritischen Punkten und Grenzen der Erlebnispädagogik, ohne diese explizit zu benennen. Der Fokus liegt auf einer umfassenden Darstellung des Ansatzes inklusive seiner Herausforderungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erlebnispädagogik, Abenteuerpädagogik, Kurt Hahn, Erfahrungslernen, Persönlichkeitsbildung, Jugendbildung, außerschulische Bildung, soziale Kompetenz, Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, ganzheitliches Lernen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von der Begriffsklärung, der historischen Entwicklung, der theoretischen Fundierung, den Leitlinien und Zielen, der Relevanz in der außerschulischen Jugendbildung und einem Fazit. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
- Arbeit zitieren
- Franziska Gäbler (Autor:in), 2009, Lernen mit Kopf, Herz und Hand , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155619