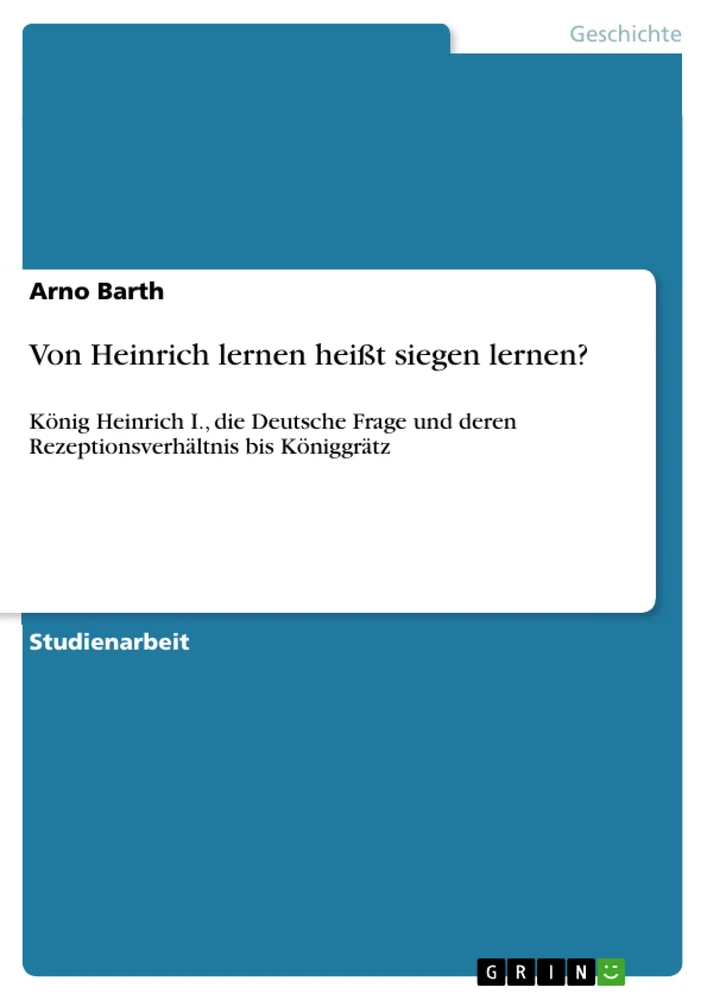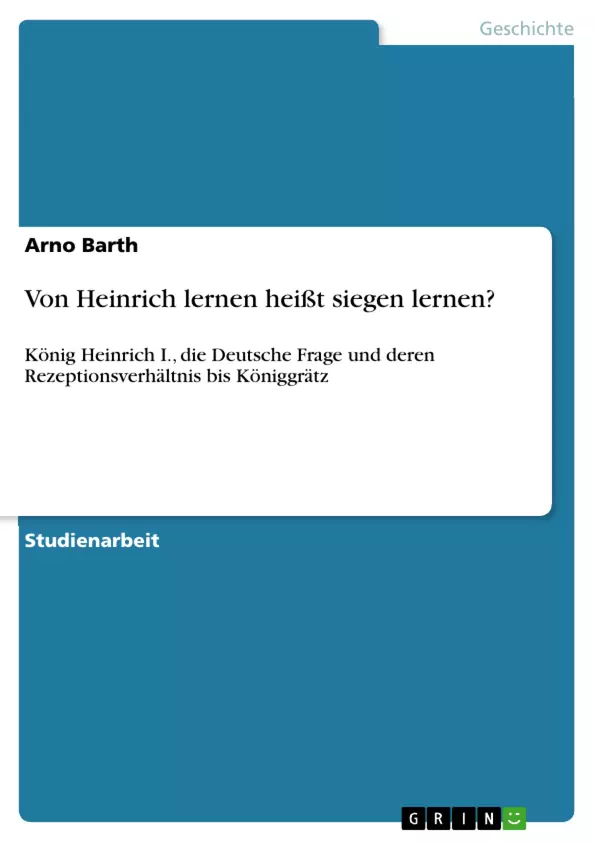[...] Diese Arbeit im Rahmen des Hauptseminars „Das Reich unter König Heinrich I.“ des
Sommersemesters 2009 an der Universität Duisburg-Essen versucht den Spagat zwischen
zwei offenkundig so verschiedenen, weil fast ein Jahrtausend auseinanderreichenden
Perioden. Sie will in zünächst das Werk des ersten König der Luidolfinger, eben jenes
Heinrich, nach dem derzeitigen Forschungsstand – der naturgemäß ein gegenüber der Mitte
des vorletzten Jahrhunderts fortgeschrittener ist – darstellen. Anschließend sollen die grob
umrissenen Entwicklungen der Reichsgeschichte von Heinrichs Tod bis zu dem des Reiches
uns zur neuzeitlichen deutschen Frage führen. Die beiden großen Lager der deutschen Frage
des 19. Jahrhunderts, die borussisch-kleindeutschen Vertreter und die kaiserlich-großdeutsche
Partei mitsamt ihren ideellen und materiellen Bezugspunkten Preußen und Österreich sollen
erfasst und die entscheidende Jahre vor der einstweiligen Beantwortung der deutschen Frage
zwischen der Revolution von 1848 und der „Revolution von oben“ von 1866 bzw. 1870/71 in
ihrer wegweisenden Bedeutung für den weiteren Verlauf der europäischen Geschichte
dargestellt werden.
Die anschließend zu leistende Untersuchung setzt in jenem als „Entscheidungsjahre“
definierten Zeitfenster an. Gegenstand ist eine Auswahl als repräsentativ für die
verschiedenen Lager erachteter geschichtswissenschaftlicher und –politischer Schriften.
Unsere Fragestellung lautet: Inwiefern hat der Rückblick auf Heinrich I. den Diskurs in der
deutschen Frage beeinflusst? Welche Rolle spielte die Zugehörigkeit zu einem der Lager für
die Bewertung seiner Regentschaft? Auf einer abstrakteren Ebene soll uns dies Rückschlüsse
auf die Funktion von Historie in politischen Prozessen geben. Die Rolle König Heinrichs als
nationale Integrationsfigur soll dabei zu seinen Anfängen verfolgt und mit dem derzeitigen
Forschungsstand über Heinrichs Regentschaft verglichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Reich unter Heinrich I.
- a. Voraussetzungen
- b. Herrschaftskonsolidierung
- c. Westpolitik
- d. Ostpolitik
- III. Die Deutsche Frage
- a. Das Erbe des Alten Reiches (Exkurs)
- b. Vom Ende des Reiches zur Paulskirche
- c. Großdeutsch und Kleindeutsch
- d. Entscheidungsjahre zwischen Olmütz und Königgrätz
- IV. Die Rezeption König Heinrichs im Spannungsfeld der deutschen Frage
- a. Die Rezeptoren und ihr Profil
- b. Chronologie der Quellen
- c. Heinrich in der Ranke-Schule
- d. Heinrich in der kleindeutschen Geschichtsschreibung
- e. Heinrich in der großdeutschen Geschichtsschreibung
- V. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption König Heinrichs I. im Kontext der deutschen Frage des 19. Jahrhunderts. Sie analysiert, wie die historische Figur Heinrichs I. von verschiedenen politischen Lagern interpretiert und instrumentalisiert wurde, um die eigene Position im Vereinigungsprozess zu stärken. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Interpretationen Heinrichs I. durch kleindeutsche und großdeutsche Historiographie.
- Die Herrschaftspolitik Heinrichs I. und deren Auswirkungen auf die Reichsbildung.
- Die Entwicklung der deutschen Frage vom Ende des mittelalterlichen Reiches bis zur Reichsgründung 1871.
- Die unterschiedlichen Interpretationen Heinrichs I. in der kleindeutschen und großdeutschen Geschichtsschreibung.
- Die Funktion von Historie in politischen Prozessen des 19. Jahrhunderts.
- Heinrich I. als nationale Integrationsfigur.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den historischen Kontext der Arbeit. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Rezeption König Heinrichs I. auf den Diskurs der deutschen Frage dar und skizziert den methodischen Ansatz der Untersuchung. Das Volkslied über Heinrich I. wird als Ausgangspunkt für die Betrachtung der anhaltenden Rezeption des Königs bis ins 20. Jahrhundert herangezogen, welche im 19. Jahrhundert besonders im Kontext des Nationalismus relevant war. Die Arbeit verfolgt den Spagat zwischen zwei weit auseinanderliegenden Epochen und untersucht die Interpretation König Heinrichs I. als einflussreiche Figur in der deutschen Reichsgeschichte und der damit einhergehenden Diskussion im 19. Jahrhundert.
II. Das Reich unter Heinrich I.: Dieses Kapitel beleuchtet die Herrschaft Heinrichs I. Es beschreibt zunächst die Voraussetzungen seiner Herrschaft, die durch die Auflösung des Ostfränkischen Reiches und die Stärkung regionaler Machthaber geprägt waren. Die Herrschaftskonsolidierung Heinrichs I., seine West- und Ostpolitik werden ausführlich dargelegt, wobei die Herausforderungen und Erfolge seiner Regierungszeit analysiert werden. Der Fokus liegt auf der Analyse der allmählichen Stärkung des Königtums unter Heinrich I. und den damit verbundenen Auswirkungen auf die politische Landschaft des Reiches.
III. Die Deutsche Frage: Dieses Kapitel skizziert die Entwicklung der "Deutschen Frage" vom Ende des mittelalterlichen Reiches bis zum Vorfeld der Reichsgründung 1871. Es beschreibt das Erbe des Alten Reiches, die verschiedenen Lösungsansätze (Großdeutsch vs. Kleindeutsch) und die entscheidenden Jahre zwischen der Revolution von 1848 und dem Krieg gegen Österreich 1866. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der unterschiedlichen politischen und ideologischen Strömungen, die in der Debatte um die deutsche Einheit eine Rolle spielten. Das Kapitel bildet den notwendigen historischen Kontext für die folgende Analyse der Rezeption Heinrichs I.
Schlüsselwörter
König Heinrich I., Deutsche Frage, Großdeutsch, Kleindeutsch, Geschichtsschreibung, Nationalismus, Reichsgründung, Historismus, Historiographie, mittelalterliches Königtum, politische Instrumentalisierung, Identitätsbildung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Rezeption König Heinrichs I. im Kontext der Deutschen Frage
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption König Heinrichs I. im 19. Jahrhundert im Kontext der „Deutschen Frage“. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Interpretationen Heinrichs I. durch kleindeutsche und großdeutsche Historiographie und wie diese Figur politisch instrumentalisiert wurde, um die jeweilige Position im Vereinigungsprozess zu stärken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Herrschaftspolitik Heinrichs I. und deren Auswirkungen auf die Reichsbildung, die Entwicklung der deutschen Frage vom Ende des mittelalterlichen Reiches bis 1871, die unterschiedlichen Interpretationen Heinrichs I. in der kleindeutschen und großdeutschen Geschichtsschreibung, die Funktion von Historie in politischen Prozessen des 19. Jahrhunderts und Heinrich I. als nationale Integrationsfigur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Das Reich unter Heinrich I., Die Deutsche Frage, Die Rezeption König Heinrichs im Spannungsfeld der deutschen Frage und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel untersucht einen Aspekt der Rezeption Heinrichs I. und dessen Kontext.
Wie wird die Herrschaftszeit Heinrichs I. dargestellt?
Kapitel II beleuchtet die Herrschaft Heinrichs I., beginnend mit den Voraussetzungen, seiner Herrschaftskonsolidierung und seiner Innen- und Außenpolitik (West- und Ostpolitik). Der Fokus liegt auf der allmählichen Stärkung des Königtums und den damit verbundenen Auswirkungen auf die politische Landschaft.
Wie wird die „Deutsche Frage“ dargestellt?
Kapitel III skizziert die Entwicklung der „Deutschen Frage“ vom Ende des mittelalterlichen Reiches bis zur Reichsgründung 1871. Es behandelt das Erbe des Alten Reiches, die verschiedenen Lösungsansätze (Großdeutsch vs. Kleindeutsch) und die entscheidenden Jahre zwischen der Revolution von 1848 und dem Krieg gegen Österreich 1866. Es werden die unterschiedlichen politischen und ideologischen Strömungen in der Debatte um die deutsche Einheit dargestellt.
Wie wird die Rezeption Heinrichs I. analysiert?
Kapitel IV analysiert die Rezeption Heinrichs I. durch verschiedene politische Lager und historiografische Schulen (Ranke-Schule, kleindeutsche und großdeutsche Geschichtsschreibung). Es untersucht, wie die historische Figur Heinrichs I. interpretiert und instrumentalisiert wurde, um die jeweilige Position in der deutschen Frage zu stärken. Die Chronologie der Quellen und die Profile der Rezeptoren werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: König Heinrich I., Deutsche Frage, Großdeutsch, Kleindeutsch, Geschichtsschreibung, Nationalismus, Reichsgründung, Historismus, Historiographie, mittelalterliches Königtum, politische Instrumentalisierung, Identitätsbildung.
Welche Methode wird angewendet?
Die Einleitung beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit, der einen Vergleich der Interpretationen Heinrichs I. in der kleindeutschen und großdeutschen Geschichtsschreibung vornimmt und die politische Instrumentalisierung der historischen Figur analysiert. Das Volkslied über Heinrich I. dient als Ausgangspunkt, um die anhaltende Rezeption bis ins 20. Jahrhundert zu betrachten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit und der Ausblick (Kapitel V) fassen die Ergebnisse zusammen und geben einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen. Der genaue Inhalt des Fazits wird im Text nicht explizit beschrieben.
- Quote paper
- Arno Barth (Author), 2010, Von Heinrich lernen heißt siegen lernen? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155647