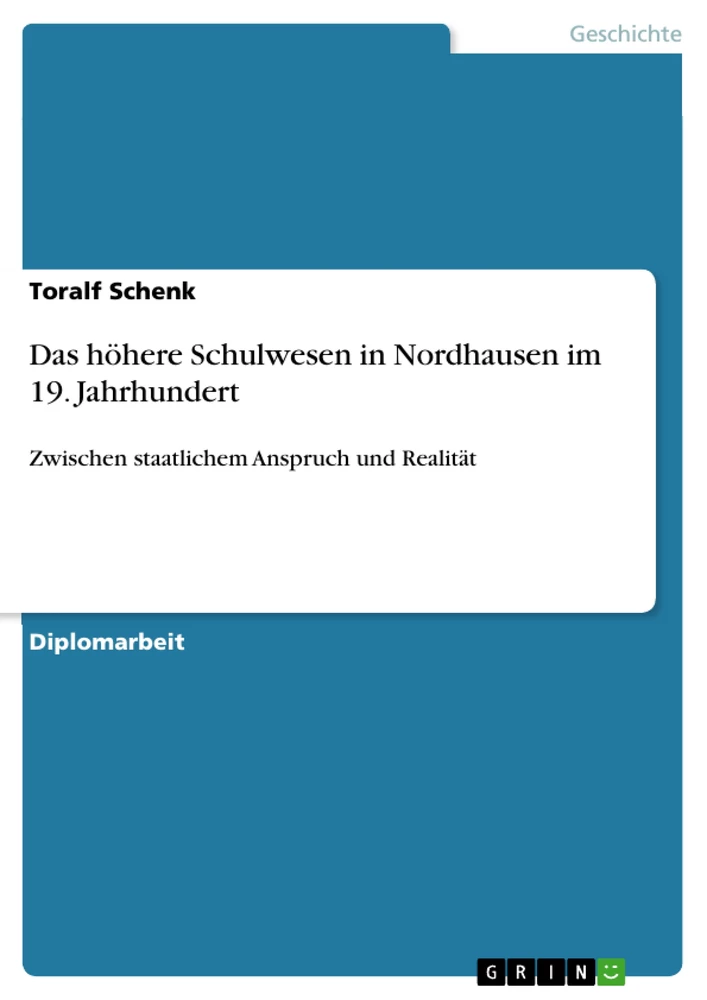Nicht nur die aktuelle Diskussion um die Institution Schule erweist sich als wichtig und interessant, sondern auch der historische Diskurs. Was Schule heute ist und wie sie zu dem geworden ist, lässt sich aus multiperspektivischer Sichtweise heraus ermitteln. Der historischen Perspektive kommt dabei ein besonderer Stellenwert zu. Sie leistet wertvolle Dienste, um Aufbau, Struktur und Wirkungsweise unseres heutigen Schul- und Bildungssystems zu verstehen.
Die Geschichte von Erziehung und Schule wird nicht um ihrer selbst willen betrieben. Es geht dabei auch nicht um eine Darstellung pädagogischer Ideen oder um die museale Aneinanderreihung zeitlich geordneter Faktoren. Vielmehr wird die Geschichte der Schule heute als Sozialgeschichte behandelt, d.h. es geht um das Verhältnis von Staat und Gesellschaft zu den erzieherischen Institutionen. „Erziehung und Unterricht haben Funktionen in einer jeweiligen politischen, gesellschaftlichen und sozialen Ordnung, sie sind auch Motor des sozialen, politischen und ökonomischen Wandels.“ Nicht zuletzt ist unser heutiges Bildungswesen das Ergebnis vergangener gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Prozesse und wird auch in Zukunft durch diese Bereiche bestimmt. Dies verbirgt sich letztendlich auch hinter dem Eingangszitat, durch das wir dazu angehalten werden, die in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen in unsere Handlungen der Gegenwart mit einzubeziehen. Auf diese Weise lassen sich gegenwärtige Probleme der Schule und des Unterrichts besser verstehen und Lösungsmöglichkeiten finden.
Nun ist es aber nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit, die historische Entwicklung unseres heutigen Schulsystems bis zur Gegenwart in seiner Gesamtheit darzustellen und nach Ursachen für die gegenwärtige Situation des Schul- und Bildungssystems in der Vergangenheit zu suchen. Überhaupt soll der Vergleich zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart ausgespart bleiben. Vielmehr soll das 19. Jahrhundert als wesentliche Entwicklungsetappe für unser heutiges Schulsystem untersucht werden. Jedoch ist es dabei nicht möglich, die gesamte Bandbreite der schulischen Bildung zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht exemplarisch die Entwicklung der höheren Knabenschulen in Preußen im 19. Jahrhundert anhand einer Fallstudie der Stadt Nordhausen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Thematik, Aufbau und Grundlagen der Untersuchung
- 1.1 Vorüberlegungen
- 1.2 Literatur- und Quellengrundlage sowie Forschungsergebnisse
- 1.2.1 Literaturgrundlage und Forschungsstand
- 1.2.2 Forschungsprobleme und -defizite
- 1.2.3 Quellengrundlage
- 1.3 Themenstellung und Untersuchungsgegenstand der Arbeit
- 1.3.1 Themenstellung
- 1.3.2 Untersuchungszeitraum
- 1.3.3 Untersuchungsgegenstand
- 1.4 Gliederung und Methodik
- 1.4.1 Methodisches Vorgehen
- 1.4.2 Gliederung der Arbeit
- 2. Konzeptionen und Realität des Gymnasialwesens im Zeitalter der großen Reformen
- 2.1 Die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts – Der Beginn des Jahrhunderts der Bildung
- 2.1.1 Die historischen Rahmenbedingungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- 2.1.2 Humboldts Pläne und Maßnahmen der preußischen Bildungsreform
- 2.2 Das humanistische Gymnasium in Nordhausen am Anfang des 19. Jahrhunderts
- 2.2.1 Die Entstehung des städtischen Gymnasiums und seine Situation zur Jahrhundertwende um 1800
- 2.2.2 Der Übergang Nordhausens von der Reichsfreiheit in preußischen Besitz
- 2.2.3 Nordhausen unter westfälischer Herrschaft
- 2.2.4 Das Gymnasium unter dem Direktor Johann Gottfried August Sparr und seine Reformmaßnahmen
- 2.3 Zwischenfazit
- 3. Das preußische Gymnasium im Zeitalter der Restauration
- 3.1 Die Auswirkungen der Humboldtschen Reformen zwischen Anspruch und Realität
- 3.1.1 Stellenwert der Humboldtschen Reformen
- 3.1.2 Umsetzung und Folgen der Humboldtschen Reformen
- 3.1.3 Kritikpunkte am Aufbau des preußischen Gymnasiums
- 3.2 Der Süvernsche Unterrichtsgesetzentwurf und sein Scheitern von 1819
- 3.2.1 Grundidee des Süvernschen Unterrichtsgesetzentwurfes
- 3.3.2 Ergebnisse und Folgen des Gesetzentwurfes
- 3.3 Der Ausbau des Gymnasiums zur Staatsschule
- 3.3.1 Das Abiturreglement von 1834
- 3.3.2 Der gymnasiale Lehrplan von 1837
- 3.4 Das Nordhäuser Gymnasium im Zeitalter der Restauration
- 3.4.1 Politische und gesellschaftliche Veränderungen in Nordhausen nach dem Übergang an Preußen 1816
- 3.4.2 Das Gymnasium unter Johann Gottfried Friedrich Straß und der Aufschwung im städtischen Turnwesen
- 3.4.3 Das Nordhäuser Gymnasium unter Friedrich Karl Kraft
- 3.5 Zwischenfazit
- 4. Das preußische Gymnasium in der Mitte des 19. Jahrhunderts
- 4.1 Das Zeitalter des Vormärz
- 4.1.1 Historische Rahmenbedingungen
- 4.1.2 Pädagogische Grundtendenzen
- 4.1.3 Christliche Erziehung als Kern des neuen Lehrplans von 1837
- 4.2 Das preußische Schulwesen zwischen Revolution und Reichsgründung
- 4.2.1 Historische Rahmenbedingungen
- 4.2.2 Schulpolitische Maßnahmen
- 4.2.3 Das preußische Gymnasium als staatliche Eliteschule
- 4.2.4 Schulstreit
- 4.3 Das Nordhäuser Gymnasium unter dem Direktorat von Schirlitz
- 4.3.1 Grundlagen der christlichen Erziehung
- 4.3.2 Die Gründung der Nordhäuser Realschule
- 4.3.3 Die Vorbereitungsklassen
- 4.3.4 Stadt und Gymnasium in der 48er Revolution
- 4.3.5 Stadt und Gymnasium in der nachrevolutionären Zeit
- 4.3.6 Politischer Richtungswechsel
- 4.4 Zwischenfazit
- 5. Das preußische Gymnasium in der Kaiserzeit
- 5.1 Charakteristik der Epoche
- 5.1.1 Historische Rahmenbedingungen
- 5.1.2 Das Bildungssystem im Kaiserreich
- 5.1.3 Bildungspolitische Kontroversen
- 5.2 Die Schulkonferenz von 1890
- 5.2.1 Ein „Neuer Kurs“ in der Bildungsdebatte
- 5.2.2 Bildungspolitische Ziele Kaiser Wilhelms II.
- 5.2.3 Reaktionen in Nordhausen auf die Rede des Kaisers
- 5.3 Das Nordhäuser Gymnasium zur Kaiserzeit
- 5.3.1 Das Gymnasium nach der Ära Schirlitz
- 5.3.2 Die Anstalt unter dem Direktor Grosch
- 5.4 Analyse zur Sozialstruktur der gymnasialen Schülerschaft
- 5.4.1 Sozialer Aufstieg durch höhere Schulbildung
- 5.4.2 Beruflicher Werdegang der Nordhäuser Abiturienten in der Ära Schirlitz
- 5.4.3 Soziale Herkunft und beruflicher Werdegang der Nordhäuser Abiturienten in der Kaiserzeit
- 5.5 Die letzten Jahre des städtischen Gymnasiums
- 5.5.1 Die Dienstverhältnisse der Direktoren
- 5.5.2 Der Übergang des Gymnasiums in staatliche Trägerschaft und der Umzug in das neue Schulgebäude
- 5.6 Zwischenfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des höheren Schulwesens in Nordhausen im 19. Jahrhundert. Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen staatlichen Ansprüchen an das Gymnasium und der tatsächlichen Umsetzung vor Ort zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet, wie sich konzeptionelle Überlegungen der Bildungspolitik in der Realität des Nordhäuser Gymnasiums widerspiegelten.
- Entwicklung des preußischen Gymnasialsystems im 19. Jahrhundert
- Einfluss der Humboldtschen Reformen auf das Nordhäuser Gymnasium
- Der Einfluss politischer und gesellschaftlicher Veränderungen auf das Gymnasium
- Die soziale Struktur der Schülerschaft des Nordhäuser Gymnasiums
- Der Übergang des Gymnasiums in staatliche Trägerschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thematik, Aufbau und Grundlagen der Untersuchung: Dieses einführende Kapitel legt die Forschungsfrage, den Untersuchungszeitraum und die Methodik der Arbeit dar. Es beschreibt den aktuellen Diskurs um das Schulwesen und betont die Bedeutung der historischen Perspektive für das Verständnis des heutigen Bildungssystems. Die Arbeit fokussiert sich auf die Entwicklung der höheren Knabenschulen in Preußen im 19. Jahrhundert, exemplarisch dargestellt am Beispiel Nordhausen.
2. Konzeptionen und Realität des Gymnasialwesens im Zeitalter der großen Reformen: Dieses Kapitel untersucht die Reformen des preußischen Bildungswesens zu Beginn des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Humboldtschen Reformen. Es analysiert die historischen Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die Entwicklung des humanistischen Gymnasiums in Nordhausen, inklusive des Übergangs der Stadt von der Reichsfreiheit in preußischen Besitz und die damit verbundenen Veränderungen im Schulsystem. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Wirken des Direktors Johann Gottfried August Sparr und seinen Reformbemühungen gewidmet.
3. Das preußische Gymnasium im Zeitalter der Restauration: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Humboldtschen Reformen während der Restauration. Es beleuchtet den Stellenwert der Reformen, ihre Umsetzung und die daraus resultierenden Folgen und Kritikpunkte. Der gescheiterte Süvernsche Unterrichtsgesetzentwurf von 1819 und der Ausbau des Gymnasiums zur Staatsschule werden eingehend untersucht. Die Entwicklung des Nordhäuser Gymnasiums in diesem Zeitraum und die Auswirkungen politischer und gesellschaftlicher Veränderungen werden im Detail beschrieben.
4. Das preußische Gymnasium in der Mitte des 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel betrachtet das preußische Schulwesen im Vormärz und zwischen Revolution und Reichsgründung. Es analysiert die historischen Rahmenbedingungen, pädagogischen Grundtendenzen und schulpolitischen Maßnahmen. Der Fokus liegt auf der Rolle des Gymnasiums als staatliche Eliteschule und den Auseinandersetzungen um das Schulsystem. Die Entwicklung des Nordhäuser Gymnasiums unter der Leitung von Schirlitz, einschließlich der Gründung der Realschule und der Ereignisse um die 48er Revolution, wird detailliert dargestellt.
5. Das preußische Gymnasium in der Kaiserzeit: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des preußischen Gymnasiums im Kaiserreich. Es analysiert die historischen Rahmenbedingungen, das Bildungssystem und die bildungspolitischen Kontroversen der Epoche, inklusive der Schulkonferenz von 1890 und der Reaktionen in Nordhausen auf die Rede Kaiser Wilhelms II. Die Entwicklung des Nordhäuser Gymnasiums unter verschiedenen Direktoren wird ebenso behandelt wie die soziale Struktur der Schülerschaft und der Übergang des Gymnasiums in staatliche Trägerschaft.
Schlüsselwörter
Preußisches Gymnasium, Nordhausen, 19. Jahrhundert, Humboldtsche Reformen, Restauration, Vormärz, Kaiserzeit, Bildungspolitik, Sozialstruktur, Staat und Gesellschaft, höhere Schulen, Schulgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entwicklung des preußischen Gymnasiums in Nordhausen im 19. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des höheren Schulwesens, insbesondere des Gymnasiums, in Nordhausen während des 19. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf den Wechselwirkungen zwischen staatlichen Bildungspolitiken und deren konkreter Umsetzung vor Ort. Analysiert werden die Auswirkungen von konzeptionellen Überlegungen der Bildungspolitik auf die Realität des Nordhäuser Gymnasiums.
Welche Zeitspanne wird untersucht?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung des Gymnasiums in Nordhausen über das gesamte 19. Jahrhundert, von den großen Reformen zu Beginn des Jahrhunderts bis in die Kaiserzeit.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet folgende Schwerpunkte: die Entwicklung des preußischen Gymnasialsystems im 19. Jahrhundert; den Einfluss der Humboldtschen Reformen auf das Nordhäuser Gymnasium; die Auswirkungen politischer und gesellschaftlicher Veränderungen auf das Gymnasium; die soziale Struktur der Schülerschaft des Nordhäuser Gymnasiums; und den Übergang des Gymnasiums in staatliche Trägerschaft.
Welche Rolle spielen die Humboldtschen Reformen?
Die Humboldtschen Reformen bilden einen zentralen Aspekt der Arbeit. Es wird analysiert, wie die konzeptionellen Ideen dieser Reformen in der Praxis des Nordhäuser Gymnasiums umgesetzt wurden und welche Auswirkungen dies hatte. Die Arbeit untersucht sowohl die beabsichtigten als auch die unbeabsichtigten Folgen der Reformen.
Wie wird der Einfluss politischer und gesellschaftlicher Veränderungen dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie politische und gesellschaftliche Veränderungen (z.B. die Restauration, der Vormärz, die Revolution von 1848, die Kaiserzeit) die Entwicklung des Gymnasiums in Nordhausen beeinflusst haben. Es werden die Zusammenhänge zwischen den jeweiligen historischen Kontexten und den Entwicklungen im Schulwesen aufgezeigt.
Welche Bedeutung hat die soziale Struktur der Schülerschaft?
Die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft des Nordhäuser Gymnasiums wird analysiert. Die Arbeit untersucht, inwieweit der soziale Aufstieg durch höhere Schulbildung möglich war und wie sich die soziale Herkunft der Schüler auf ihren späteren beruflichen Werdegang auswirkte.
Wie wird die Methodik der Arbeit beschrieben?
Das einführende Kapitel beschreibt detailliert die Forschungsfrage, den Untersuchungszeitraum und die Methodik der Arbeit. Es wird auf die verwendete Literatur und Quellen sowie auf den aktuellen Forschungsstand eingegangen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Thematik, Aufbau und Grundlagen der Untersuchung; 2. Konzeptionen und Realität des Gymnasialwesens im Zeitalter der großen Reformen; 3. Das preußische Gymnasium im Zeitalter der Restauration; 4. Das preußische Gymnasium in der Mitte des 19. Jahrhunderts; 5. Das preußische Gymnasium in der Kaiserzeit. Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung und Zwischenfazite.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Preußisches Gymnasium, Nordhausen, 19. Jahrhundert, Humboldtsche Reformen, Restauration, Vormärz, Kaiserzeit, Bildungspolitik, Sozialstruktur, Staat und Gesellschaft, höhere Schulen, Schulgeschichte.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel der Arbeit. Die Zusammenfassung der Kapitel liefert eine kurze Beschreibung des Inhalts jedes Kapitels.
- Citation du texte
- Toralf Schenk (Auteur), 2002, Das höhere Schulwesen in Nordhausen im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155659