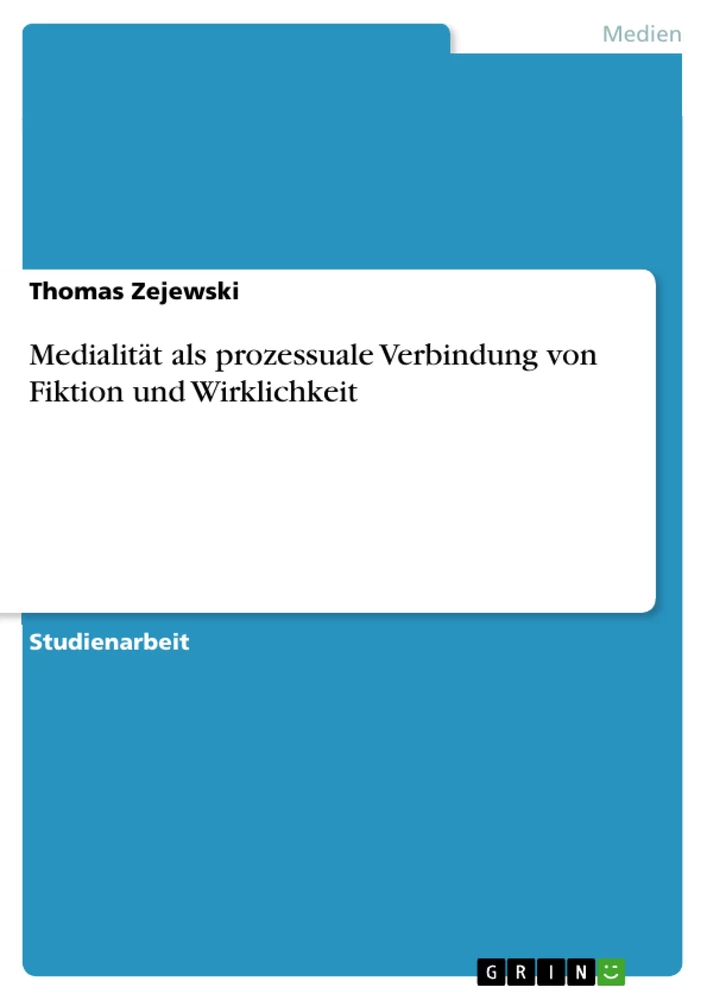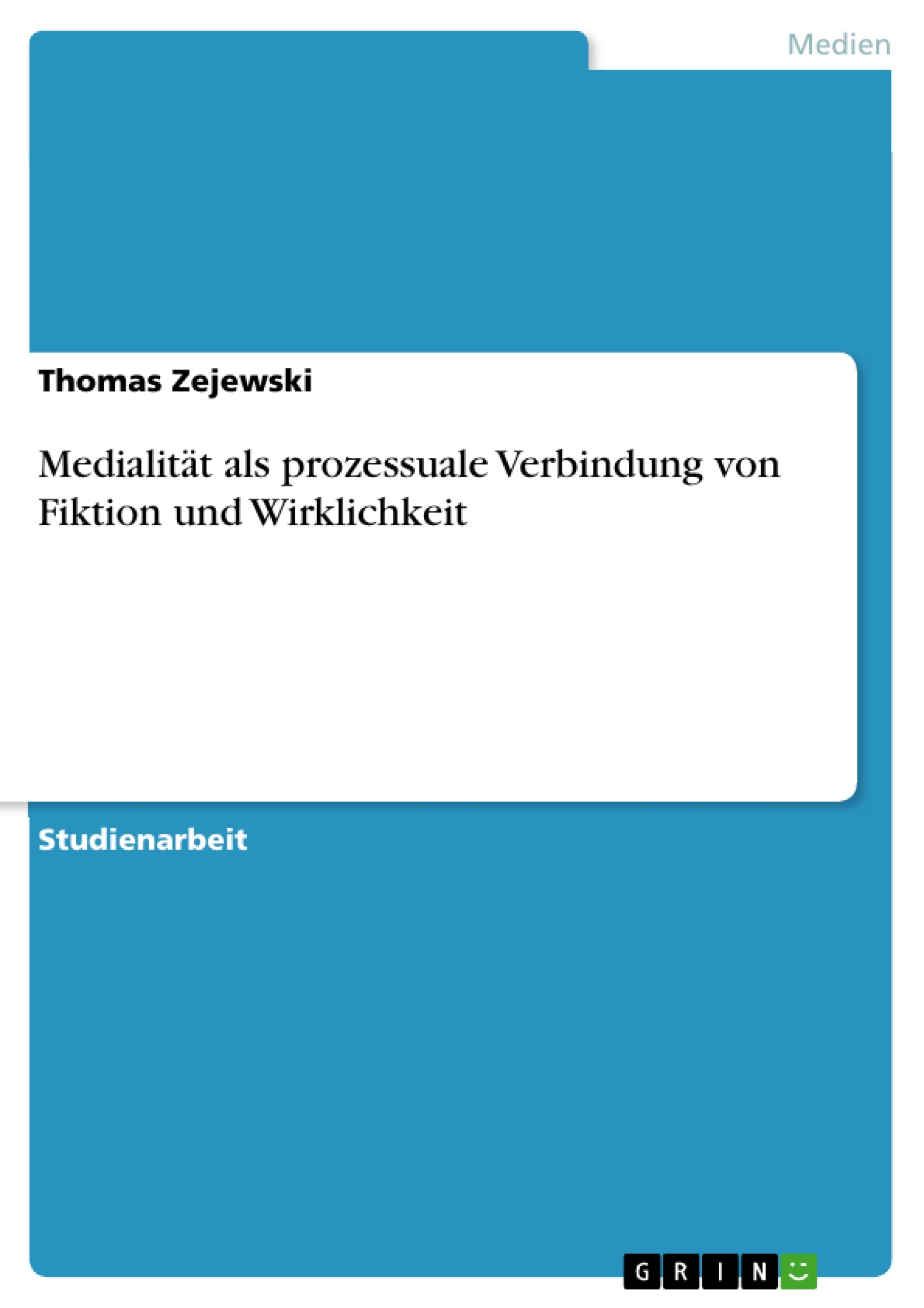Innerhalb der Linguistik, die im Zuge des linguistic turn eine basale Bedeutsamkeit für erkenntnistheoretische Positionen erlangte, bildeten sich verschiedene Akzentuierungen aus, deren erschöpfende Behandlung mir nicht möglich ist. Ich möchte mich im folgenden deswegen den erkenntnistheoretischen Ausführungen, die man unter dem Aristotelischen Paradigma zusammenfassen könnte, widmen, um danach die operative Logik von der Medialität zur Mentalität darzustellen. Dies führt uns zu einer oszillierenden Betrachtung von referentiellen und inferentiellen Momenten, welche im folgenden dank der peirceschen zeichentheoretischen Deutung durch Ludwig Jäger eine interessante Wendung nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Medialität als prozessuale Verbindung von Fiktion und Wirklichkeit.
- 1.1 Eine erste Lokalisierung.
- 1.2 Die Tücke des Aristotelischen Paradigmas.
- 2.1 Zwischen Medialität und Mentalität.
- 2.2 Der indexikalische Anteil des Zeichens als Verbindung zur Welt?...
- 2.3 Der degenerierten Indexikalität auf der Spur
- 3.1 Spurenlesen als metaleptisches Prinzip......
- 4 Literaturverzeichnis.........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich Medialität als prozessuale Verbindung von Fiktion und Wirklichkeit darstellt. Die Analyse untersucht, wie Sprache und Wirklichkeit zueinander in Beziehung stehen und welche Rolle Zeichen und Wahrnehmung in dieser Beziehung spielen. Der Fokus liegt insbesondere auf der Frage, ob ein direkter Wahrnehmungszugang zur Welt besteht oder ob dieser durch Sprache und mediale Repräsentationen vermittelt ist.
- Das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit
- Der indexikalische Anteil des Zeichens und seine Verbindung zur Welt
- Die Rolle von Medialität und Mentalität in der Konstruktion von Wirklichkeit
- Das Konzept des Spurenlesens als metaleptisches Prinzip
- Die problematische Natur des Aristotelischen Paradigmas in Bezug auf die Beziehung zwischen Zeichen und Realität
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1.1 beginnt mit einer grundlegenden Lokalisierung des Themas und stellt die Relevanz der Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit dar. Es wird auf die skeptischen Angriffe von Descartes und die daraus resultierenden epistemologischen Fragestellungen eingegangen. Kapitel 1.2 widmet sich der Kritik am Aristotelischen Paradigma, das ein direktes, evidentes Verhältnis zwischen Zeichen und Realität annimmt. Kapitel 2.1 untersucht die Rolle von Medialität und Mentalität bei der Konstruktion von Wirklichkeit und erörtert die Grenzen des naiven Realismus. Kapitel 2.2 behandelt die Bedeutung des indexikalischen Anteils des Zeichens als Verbindung zur Welt und die Problematik der Degeneration des Indexikalitätsbegriffs. Kapitel 2.3 schließlich beleuchtet das Spurenlesen als metaleptisches Prinzip, das die komplexe Beziehung zwischen Fiktion und Wirklichkeit aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind Medialität, Fiktion, Wirklichkeit, Zeichen, Indexikalität, Spurenlesen, Mentalität, Aristotelisches Paradigma, Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie. Die Arbeit beschäftigt sich mit den komplexen Interaktionen zwischen Sprache, Wahrnehmung und Realität und untersucht, wie diese durch mediale Prozesse und die Konstruktionen von Zeichen beeinflusst werden.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Medialität und Wirklichkeit zusammen?
Medialität wird als prozessuale Verbindung verstanden, die zeigt, dass unser Zugang zur Wirklichkeit immer durch mediale und sprachliche Repräsentationen vermittelt ist.
Was wird am "Aristotelischen Paradigma" kritisiert?
Kritisiert wird die Annahme eines direkten, evidenten Verhältnisses zwischen Zeichen und Realität, das die vermittelnde Rolle der Sprache ignoriert.
Was bedeutet "Spurenlesen" als metaleptisches Prinzip?
Es beschreibt die Deutung von Zeichen als Spuren einer Wirklichkeit, wobei die Grenze zwischen Fiktion (dem Zeichen) und Realität (dem Bezeichneten) verschwimmt.
Welche Rolle spielt die Indexikalität in der Zeichentheorie?
Indexikalität stellt die Verbindung zur Welt her. Die Arbeit untersucht nach Ludwig Jäger, wie Zeichen auf reale Objekte verweisen und wo diese Verbindung problematisch wird.
Was ist der "Linguistic Turn"?
Dies bezeichnet die Wende in der Philosophie, bei der Sprache als das grundlegende Instrument der Erkenntnis und Konstruktion von Wirklichkeit anerkannt wurde.
- Citation du texte
- Thomas Zejewski (Auteur), 2009, Medialität als prozessuale Verbindung von Fiktion und Wirklichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155674