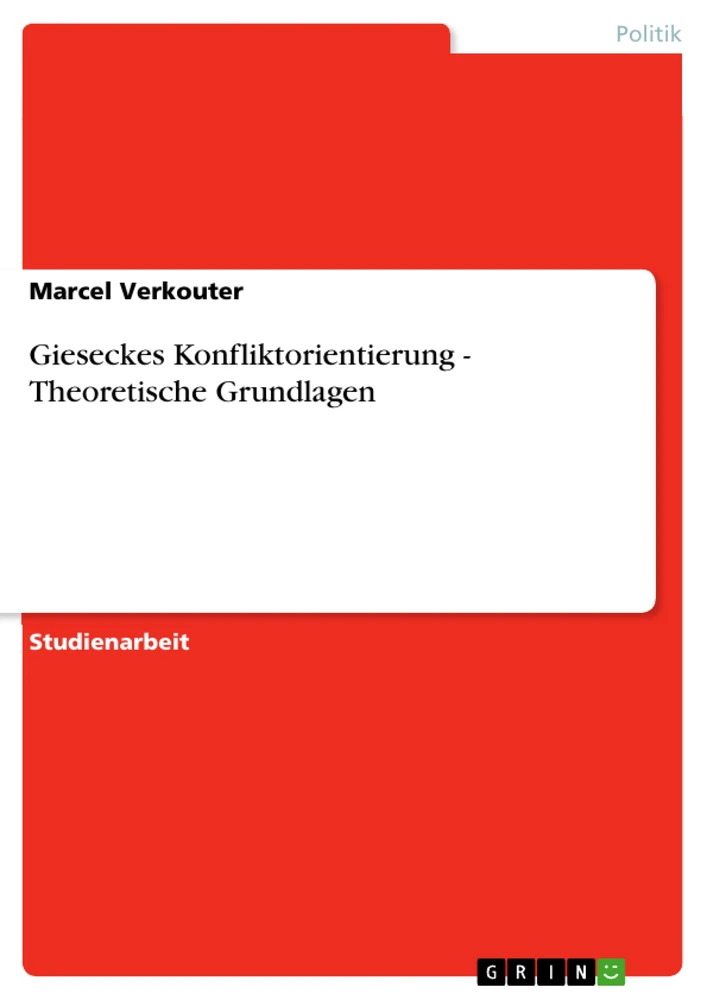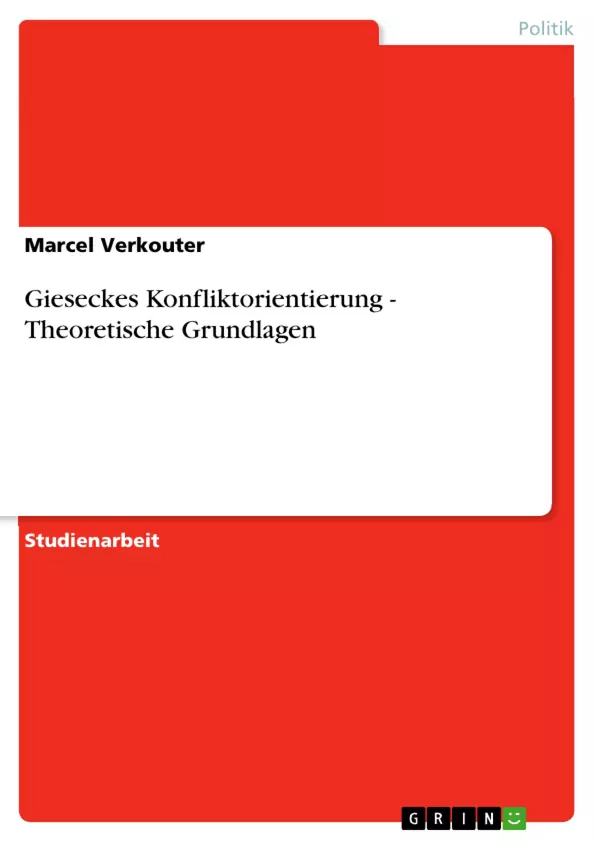1. Einleitung
Hermann Giesecke hat als erster den politischen Konflikt, als zentralen Lerngegenstand im politischen Unterricht, in den Mittelpunkt gerückt. Als er diese Theorie des politischen Unterrichts erstmalig 1965 publizierte, befand sich die politische Bildung in Deutschland in einem weitreichenden Wandel bzw. Veränderungsprozess. Gekennzeichnet war diese Umstrukturierung dadurch, dass man erstmalig eine Beziehung zwischen Fortschritt und Investitionen der Technologie und Wirtschaft und dem Bildungssystem herstellte. Zu dieser Zeit wurde die Formel „Wachstum durch Bildung“ voll und ganz anerkannt.1
„Gieseckes Didaktik ist das Ergebnis seiner dreijährigen Tätigkeit in der freien Jugendarbeit Anfang der 60er Jahre. Er leitete dort als gerade Dreißigjähriger (1928) Lehrgänge/Tagungen zur politischen Bildung im Jugendhof Steinkimmen bei Delmenhorst in Niedersachsen. Es waren 10-14tägige Tagungen für Schüler der gymnasialen Oberstufe, für Schulklassen und für geschlossene Lehrlingsgruppen – Veranstaltungen auf freiwilliger Basis, die trotz Anwesenheit von Lehrern und Ausbildern von den Jugendlichen als Freizeit verstanden wurden; es gab keine Leistungsbenotung. Verständlich ist, dass Leiter und Mitarbeiter in derartigen Veranstaltungen mit einer Didaktik der Lernschule bei den Jugendlichen nicht landen konnten.“2
Die Veranstaltungen waren aus diesem Grund mehr auf die Teilnehmer zentriert. Ziel dieser Veranstaltungen war es, die jungen Menschen zur freiwilligen Teilnahme zu motivieren. Dazu stellte Giesecke die Schaffung und Nutzung erzieherisch- produktiver Konfliktsituationen. Ebenso wollte er erreichen, dass das politische Lernen nicht als Belehrung, sondern vielmehr als Normalfall politischer Meinungsbildung verstanden wird.
Die Konfliktdidaktik wurde beeinflusst durch die Konfliktsoziologie und Zeitdiagnosen des Soziologen Ralf Dahrendorfs, welcher in den 50er Jahren in Hamburg an der Hochschule für Wirtschaft und Politik gelehrt hat. Die Konfliktsoziologie stellt den allgemein- soziologischen Theorieansatz dar, der alles soziale Handeln als Streit sozialer Akteure versteht.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Hauptziel des politischen Unterrichts
- Didaktische Begründung
- Teilziele des politischen Unterrichts
- Die Methode „Konfliktanalyse“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die Prinzipien der Konfliktdidaktik nach Hermann Giesecke und deren Umsetzung im politischen Unterricht. Der Fokus liegt auf den theoretischen Grundlagen und der Methode der Konfliktanalyse. Die Arbeit zielt darauf ab, die Konzepte Gieseckes im Kontext der politischen Bildung zu erläutern und deren Relevanz für den heutigen politischen Unterricht aufzuzeigen.
- Die Bedeutung des Konflikts als zentraler Lerngegenstand im politischen Unterricht
- Die Rolle der Mitbestimmung als oberstes Lernziel und Gegenstand des Unterrichts
- Die didaktischen Prinzipien des konfliktorientierten Unterrichts, insbesondere die Förderung von Konfliktfähigkeit und der Abbau ideologischen Denkens
- Die Methode der Konfliktanalyse als Instrument zur Bewältigung von Konflikten im politischen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Konfliktdidaktik nach Hermann Giesecke vor und beleuchtet den historischen Kontext ihrer Entstehung.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt das Hauptziel des politischen Unterrichts nach Giesecke, die Mitbestimmung, sowie die didaktische Begründung für die Verwendung von Konflikten als Lerngegenstand.
Schlüsselwörter
Konfliktdidaktik, politische Bildung, Hermann Giesecke, Mitbestimmung, Konfliktanalyse, Konfliktfähigkeit, Ideologisches Denken, Politischer Unterricht, Zeitdiagnosen, Konfliktsoziologie.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Hermann Giesecke und was ist sein Beitrag zur politischen Bildung?
Hermann Giesecke war ein Pädagoge, der 1965 den politischen Konflikt als zentralen Lerngegenstand des politischen Unterrichts etablierte.
Was ist das Hauptziel des politischen Unterrichts nach Giesecke?
Das oberste Lernziel ist die Mitbestimmung der jungen Menschen in der Gesellschaft.
Was versteht man unter Konfliktdidaktik?
Es ist ein Ansatz, der politisches Lernen nicht als Belehrung, sondern als Prozess der Meinungsbildung anhand von realen oder erzieherisch-produktiven Konfliktsituationen versteht.
Welchen Einfluss hatte Ralf Dahrendorf auf Gieseckes Theorie?
Dahrendorfs Konfliktsoziologie, die soziales Handeln als Streit sozialer Akteure versteht, beeinflusste maßgeblich Gieseckes didaktische Ansätze.
Was ist die Methode der „Konfliktanalyse“?
Es ist ein Instrument zur methodischen Untersuchung politischer Konflikte im Unterricht, um Konfliktfähigkeit zu fördern und ideologisches Denken abzubauen.
Warum war Gieseckes Ansatz in der Jugendarbeit so erfolgreich?
Da die Teilnahme an seinen Lehrgängen freiwillig war und keine Benotung stattfand, motivierte er Jugendliche durch Teilnehmerzentrierung und die Arbeit an lebensnahen Konflikten.
- Citar trabajo
- Marcel Verkouter (Autor), 2010, Gieseckes Konfliktorientierung - Theoretische Grundlagen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155729