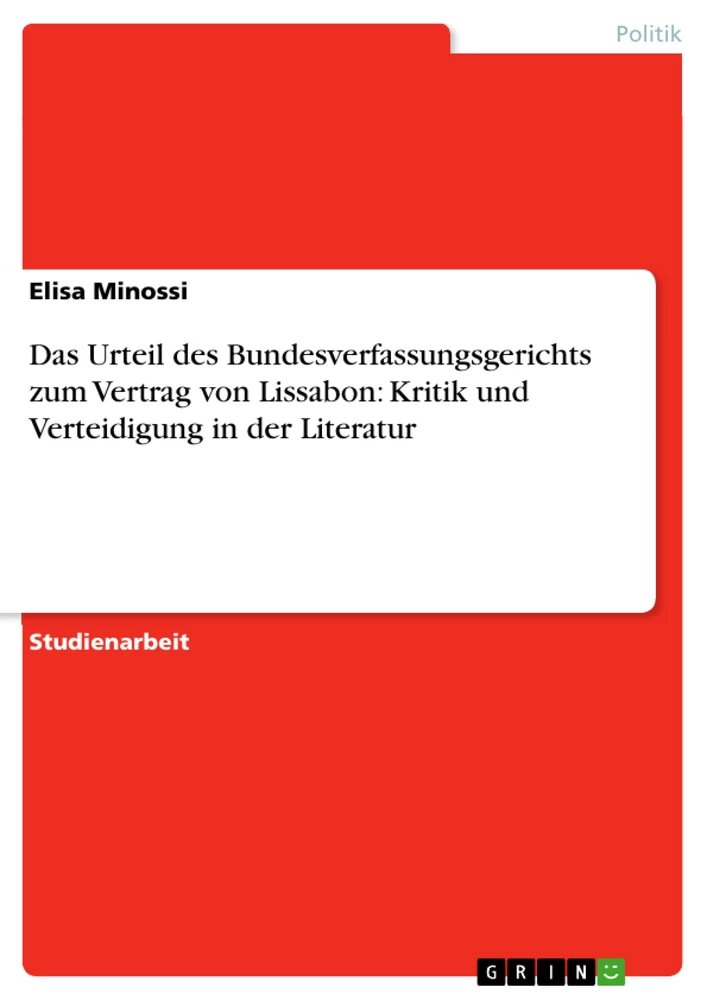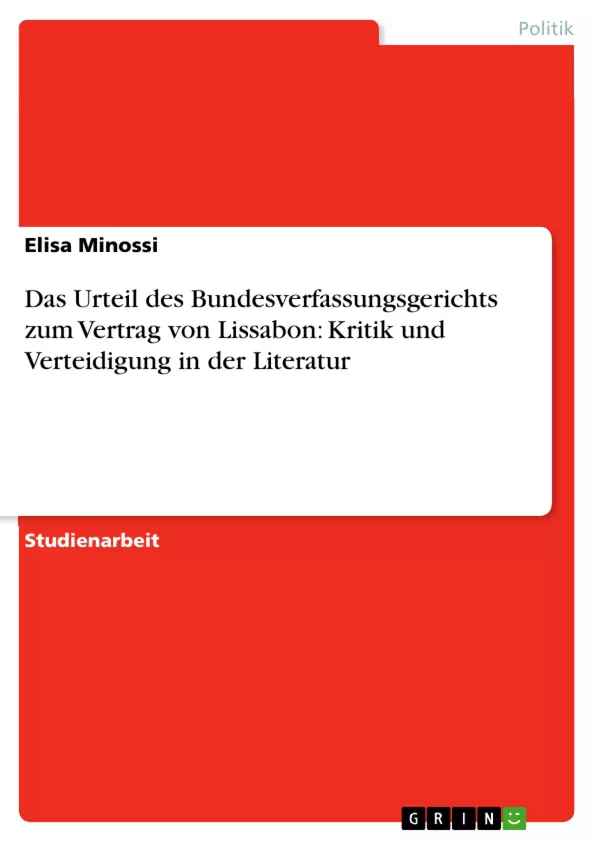Der Vertag von Lissabon ist am 01. Dezember 2009 in Kraft getreten. Er war das Ergebnis eines langen Prozesses, einer Reflexionsphase, in welchem der ursprünglich geplante Vertrag über eine Verfassung für Europa (Verfassungsvertrag) vom 29. Oktober 2004 scheiterte, da unter anderem Frankreich und die Niederlande den Vertrag in Referenden ablehnten. Der Vertrag von Lissabon begreift sich nun als die Änderung des Unionsvertrages und des EG-Vertrages, welcher in den „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ umbenannt wurde. Doch auch bevor der Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 2007 in Kraft treten konnte, galt es einige Hürden zu bewältigen.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hatte nach eingegangenen Klagen die Aufgabe, diese zu prüfen und ein Urteil über das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zu fällen. Am 30. Juni 2009 war es soweit. Das Urteil des BVerfG zum Vertrag von Lissabon wurde veröffentlicht. Das Ergebnis war ein „Ja“ zum Reformvertrag, jedoch mit Einschränkungen.
In der folgenden Arbeit soll eine Rezeption der Literatur über das Urteil vorgenommen werden. Dabei werden neun Zeitschriftenaufsätze untersucht, welche sich mit dem Urteil auseinandersetzen. Diese stammen aus der „Juristen Zeitung“, der Zeitschrift „Neue Juristische Wochenschrift“, der „Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft“, der „Stiftung Wissenschaft und Politik“, der Zeitschrift „Deutsches Verwaltungsblatt“ und dem Journal „integration“.
Da aufgrund des angesetzten Umfangs dieser Arbeit nicht auf alle Aspekte zur Beurteilung des Urteil eingegangen werden kann, beschränkt sich die Rezeptur besonders auf zwei Aspekte: der erste Aspekt bezieht sich das Demokratiedefizit und dem selbst gefordertem Recht zur Überprüfung weiterer europäischer Integration. Der zweite Aspekt behandelt die Kompetenzübertragung von nationalen Kompetenzen auf EU-Ebene und dessen Überprüfung durch deutsche Organe. Beide Aspekte sind jedoch nicht ganz klar voneinander zu trennen, sondern auch immer wieder ineinander verwoben. In Unterkapiteln werden auch kurze Gesamtresümees der Autoren der Aufsätze gegeben. Der letzte Punkt im Hauptteil dieser Arbeit fasst kurz die neue Gesetzgebung zusammen, welche die Bundesregierung nach dem Urteil erlassen hat um den Forderungen des BVerfG (zumindest teilweise) gerecht zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Das Demokratieprinzip
- Die Kompetenzübertragung und Überprüfung durch deutsche Organe
- Die neue Begleitgesetzgebung zum Lissabon Vertrag
- Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon. Ziel ist es, die verschiedenen Reaktionen und Analysen der Literatur zum Urteil zu beleuchten und die wichtigsten Kritik- und Verteidigungspunkte herauszuarbeiten.
- Die Auswirkungen des Lissabon-Vertrags auf das Demokratieprinzip
- Die Kompetenzübertragung und die Rolle deutscher Organe bei der Überprüfung von EU-Kompetenzen
- Die Bedeutung der neuen Begleitgesetzgebung für die Umsetzung des Vertrags
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem Urteil und dessen Folgen für die deutsche Verfassung
- Die Analyse verschiedener Argumentationslinien in der Literatur zum Thema Lissabon-Vertrag und Bundesverfassungsgericht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Vertrag von Lissabon und dessen Entstehungsgeschichte vor. Sie beschreibt die Ablehnung des Verfassungsvertrags und die anschließenden Klagen gegen den Lissabon-Vertrag vor dem Bundesverfassungsgericht.
Hauptteil
Das Demokratieprinzip
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Kritik am Demokratiedefizit der Europäischen Union und der Argumentation des BVerfG, dass der Lissabon-Vertrag die demokratische Legitimation der EU zwar stärkt, aber nicht ausreichend gewährleistet. Es werden verschiedene Perspektiven auf dieses Thema aus der Literatur vorgestellt.
Die Kompetenzübertragung und Überprüfung durch deutsche Organe
Dieser Abschnitt analysiert die Kompetenzübertragung von nationalen Kompetenzen auf EU-Ebene und die damit einhergehenden Kontrollmöglichkeiten deutscher Organe. Es werden die Argumente der Literatur zum Thema Kompetenzübertragung und demokratische Kontrolle diskutiert.
Die neue Begleitgesetzgebung zum Lissabon Vertrag
Dieser Abschnitt fasst die neue Gesetzgebung zusammen, die die Bundesregierung nach dem Urteil erlassen hat, um den Forderungen des BVerfG (zumindest teilweise) gerecht zu werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselthemen Demokratieprinzip, Kompetenzübertragung, Bundesverfassungsgericht, Lissabon-Vertrag, Europäische Union, deutsche Organe, Begleitgesetzgebung, Kritik, Verteidigung, und Rechtsstaatlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass für das Lissabon-Urteil des BVerfG?
Nach der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon gingen mehrere Klagen beim Bundesverfassungsgericht ein, die die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz prüfen ließen.
Wie lautet das Kernergebnis des Urteils vom 30. Juni 2009?
Das Gericht sagte „Ja“ zum Reformvertrag, forderte jedoch Einschränkungen und eine stärkere parlamentarische Mitwirkung in Deutschland.
Was wird unter dem „Demokratiedefizit“ der EU verstanden?
Das BVerfG kritisierte, dass die demokratische Legitimation auf EU-Ebene nicht der eines Nationalstaates entspricht und die Souveränität des Bundestages gewahrt bleiben muss.
Was ist die Begleitgesetzgebung zum Lissabon-Vertrag?
Es handelt sich um Gesetze, die die Bundesregierung erlassen musste, um die vom BVerfG geforderten Beteiligungsrechte von Bundestag und Bundesrat sicherzustellen.
Darf Deutschland Kompetenzen unbegrenzt auf die EU übertragen?
Nein, das Urteil betont, dass der Kern der staatlichen Souveränität unantastbar ist und deutsche Organe die Kompetenzübertragung ständig überprüfen müssen.
- Quote paper
- Elisa Minossi (Author), 2010, Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon: Kritik und Verteidigung in der Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155748