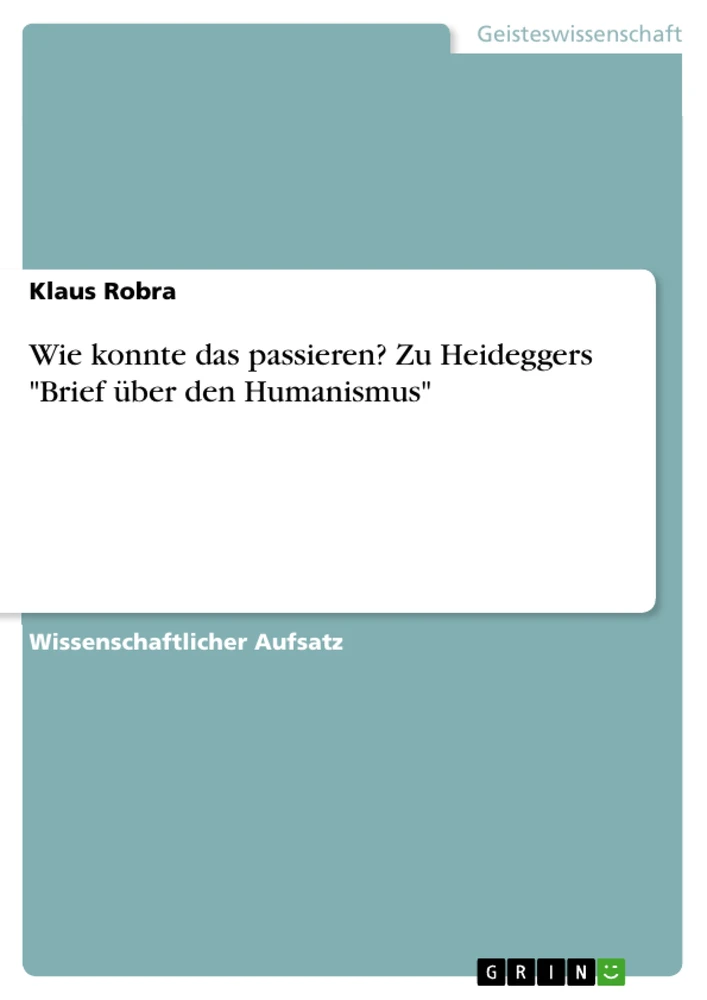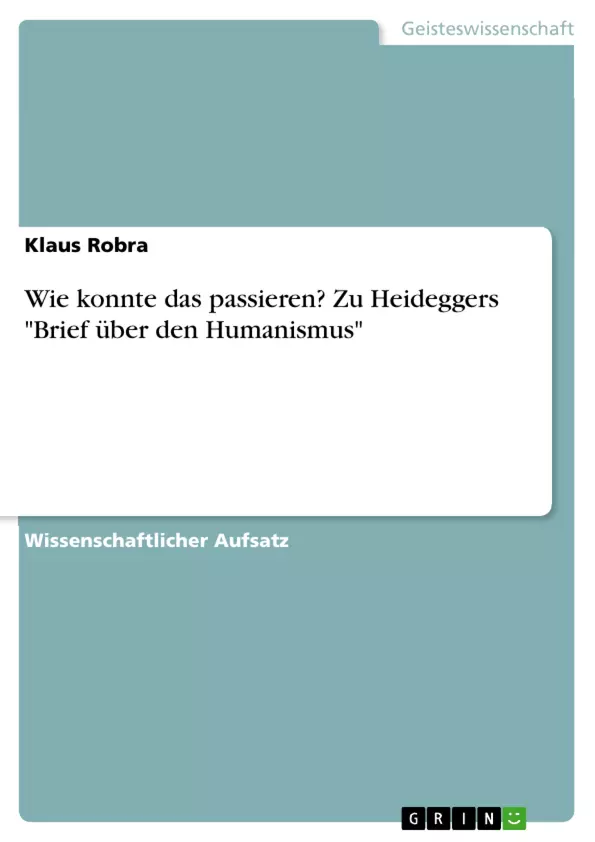In seinem Humanismus-Brief aus dem Jahr 1947 verwendet Martin Heidegger (1889-1976) immer wieder den Begriff "Sein", d.h. auf fast jeder der 54 Seiten des Textes. Das ist bemerkenswert, zumal keineswegs klar ist, was der Autor unter dem Begriff Sein versteht. In "Sein und Zeit" (1927) hatte er das Sein strikt von allem Seienden getrennt und dennoch versucht, den Begriff Sein vom Dasein des Menschen her zu interpretieren, wobei er dieses Dasein auch als "In-der-Welt-sein" bezeichnete. Auch dies jedoch ohne den wünschenswerten Klärungserfolg. Wozu Nicolai Hartmann im Jahre 1934 in seiner Grundlegung der Ontologie (also der Lehre vom Sein) erklärt, mit dem subjektivistischen Ansatz beim Dasein des Menschen sei Heidegger hinter die Objekt-Begriffe Kants und des Deutschen Idealismus zurückgefallen. Heidegger sei daher nicht in der Lage gewesen, den Objekt-Charakter des Seins zu würdigen, eines Seins, das bekanntlich sehr lange vor dem evolutionsgeschichtlichen Auftreten des Menschen existiert hat und diesem zu Grunde liegt.
Wie konnte das passieren?
Zu Heideggers Brief über den Humanismus
In diesem Brief aus dem Jahr 1947 verwendet Martin Heidegger (1889-1976) immer wieder den Begriff ,Sein‘, d.h. auf fast jeder der 54 Seiten des Textes. Das ist bemerkenswert, zumal keineswegs klar ist, was der Autor unter dem Begriff Sein versteht. In Sein und Zeit (1927) hatte er das Sein strikt von allem Seienden getrennt und dennoch versucht, den Begriff Sein vom Dasein des Menschen her zu interpretieren, wobei er dieses Dasein auch als „In-der-Welt- sein“ bezeichnete. Auch dies jedoch ohne den wünschenswerten Klärungserfolg. Wozu Nicolai Hartmann im Jahre 1934 in seiner Grundlegung der Ontologie (also der Lehre vom Sein) erklärt, mit dem subjektivistischen Ansatz beim Dasein des Menschen sei Heidegger hinter die Objekt -Begriffe Kants und des Deutschen Idealismus zurückgefallen.1 Heidegger sei daher nicht in der Lage gewesen, den Objekt -Charakter des Seins zu würdigen, eines Seins, das bekanntlich sehr lange vor dem evolutionsgeschichtlichen Auftreten des Menschen existiert hat und diesem zu Grunde liegt. - Auch Ernst Bloch kritisiert - in Erbschaft dieser Zeit (1935, Frankfurt a.M. 1977, S. 306 ff.) - ausführlich Heideggers Seinsbegriff. Was Heidegger als „das Sein“ ausgebe, sei nichts anderes als die bürgerliche Subjektivität in ihrer verkorksten Innerlichkeit - mit dem Gegenpol des „Nichts“, in das speziell der Großbürger „hinaus gehalten“ sei. Das „Sein der Angst“ habe Heidegger selbst produziert und zu verallgemeinern versucht. Angst und Sorge seien aber eher Chiffren bürgerlicher Befindlichkeit.
Wohl auch als Reaktion auf diese und andere Kritiken verkündet Heidegger in den 1930er Jahren „die Kehre“, in der er das Sein anders, d.h. vor allem auf Grund dichterisch-fiktionaler Texte, zu ergründen sucht; allerdings erneut ohne Erfolg, wozu Walter Schulz bemerkt:
„Fragen wir nun, ob und wie die beim frühen Heidegger herausgestellten philosophischen Grundsätze beim späten Heidegger aufgenommen werden, so zeigt sich, daß sie weitergedacht werden in Richtung auf eine » Übermetaphysik «. Die Seinsfrage wird nicht mehr als ein auf das Subjekt und sein Selbstverständnis bezogenes Grundpro-blem angesehen. Das Sein ist zu einer nicht faßbaren Größe erhoben worden, die es in ihren Entscheidungen anzuerkennen gilt. Eine vom Menschen ausgehende Einstellung auf es ist nicht möglich. Das besagt: ebensowenig wie es eine philosophische Onto-logie geben kann, kann es eine metaphysische Seinslehre geben. Philosophie als be-gründendes Denken ist am Ende. “2
Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass Heidegger sich im ,Brief über den Humanismus’ unablässig auf „das Sein“ beruft, ohne den Bedeutungs-Inhalt des Begriffs zufriedenstellend beschreiben zu können. Einige Beispiele:
„Das Denken wird nicht erst dadurch zur Aktion, daß von ihm eine Wirkung ausgeht oder daß es angewendet wird. Das Denken handelt, indem es denkt. Dieses Handeln ist vermutlich das Einfachste und zugleich das Höchste, weile es den Bezug des Seins zum Menschen angeht. Alles Wirken aber beruht im Sein und geht auf das Seiende aus. Das Denken dagegen läßt sich vom Sein in den Anspruch nehmen, um die Wahrheit des Seins zu sagen. Das Denken vollbringt dieses Lassen.“3
Schreibt Heidegger auf der ersten Seite des Briefes, wobei er - scheinbar - plötzlich wieder Sein und Seiendes miteinander verbindet, und zwar in dem „Wirken“, das im Sein beruhe und „auf das Seiende aus“ gehe. Demgegenüber solle das Denken „sich vom Sein in den Anspruch nehmen, um die Wahrheit des Seins zu sagen“. (Ein ehrgeiziges Vorhaben, zumal dann, wenn der Seins-Begriff gar nicht geklärt ist!)
Nichtsdestoweniger redet Heidegger im Folgenden von der „Geschichte des Seins“, wobei dessen Sagen „rein im Element des Seins“ bleibe (S. 6 f.). (Also im Nirgendwo?) Immerhin solle das dem Sein angehörende Denken auf das Sein hören. Denn das Sein sei nicht nur „das Mögliche“ als das „Vermögend-Mögende“, sondern auch maßgebend für das Wesen des Menschen. Will sagen: Mit dem Unbestimmten des Seins will Heidegger das Wesen des Menschen bestimmen! Im Originalton Heidegger:
„Soll aber der Mensch noch einmal in die Nähe des Seins finden, dann muß er zuvor lernen, im Namenlosen zu existieren. ... Der Mensch muß, bevor er spricht, erst vom Sein sich wieder ansprechen lassen auf die Gefahr, daß er unter diesem Anspruch wenig oder selten etwas zu sagen hat. Nur so wird dem Wort die Kostbarkeit seines Wesens, dem Menschen aber die Behausung für das Wohnen in der Wahrheit des Seins wiedergeschenkt.“ (S. 10 f.)
Und er scheut sich nicht, mit solchem Nicht-Sinn (bzw. Unsinn) den herkömmlichen Humanismus in Grund und Boden zu verdammen, wobei er dessen griechische und römische Vorgeschichte - und auch den klassischen Humanismus seit der Renaissance - mehr oder weniger kursorisch abhandelt.
Den klassischen Humanismus lehnt er ab, weil dieser in Meta-physik erstarrt sei. Daher gelte es, den Humanismus neu zu begründen, und zwar aus der „Wahrheit des Seins“ bzw.:
„Die Wahrheit des Seins denken, heißt zugleich: die humanitas des homo humanus denken. Es gilt die Humanitas zu Diensten der Wahrheit des Seins, aber ohne den Humanismus im metaphysischen Sinne.“ (S. 43)
Auch hier kümmert den Autor nicht der Unsinn, der darin besteht, die „Wahrheit des Seins“ zu beschwören - und gegen den herkömmlichen Humanismus ins Feld zu führen! -, ohne zu wissen, wovon die Rede ist, weil er das dauernd beschworene Sein nicht erklären kann.
Ähnlich widersprüchlich äußert Heidegger sich zur Sprache und zur „Ek-sistenz des Menschen“ als dessen eigentlicher, „wahrer“ Seinsform. Zur „Ek-sistenz“, d.h. zu der These, der Mensch sei das aus allem Seienden „herausgehobene“ Wesen (was Sartre in seinem Ver-harren bei der ,existence‘ nicht erkannt habe), erklärt Heidegger:
„ ... der Mensch west so, daß er das »Da«, das heißt: die Lichtung des Seins, ist. Dieses »Sein« des Da, und nur dieses, hat den Grundzug der Ek-sistenz, das heißt des ekstatischen Innestehens in der Wahrheit des Seins. Das ekstatische Wesen des Menschen beruht in der Ek-sistenz, die von der metaphysisch gedachten existentia verschieden bleibt.“ (S. 17)
Nunmehr soll also der Mensch in die „Lichtung des Seins“ eintreten können, und zwar auf Grund seines „ekstatischen Innestehens in der Wahrheit des Seins“. Plötzlich vermeint Heidegger also - trotz des Scheiterns der Seins-Analyse als Daseins-Analyse in Sein und Zeit - das „Da“ des Menschen - auch aller Evidenz zum Trotz - mit der „Wahrheit des Seins“ ver-knüpfen zu können. Mehr noch:
„Gesetzt daß der Mensch inskünftig die Wahrheit des Seins zu denken vermag, dann denkt er es aus der Ek-sistenz. Ek-sistierend steht er im Geschick des Seins. Die Ek-si- stenz des Menschen ist als Ek-sistenz geschichtlich, nicht aber erst deshalb, oder gar nur deshalb, weil mit dem Menschen und den menschlichen Dingen mancherlei im Verlauf der Zeit geschieht. Weil es gilt, die Ek-sistenz des Da-seins zu denken, des-halb liegt dem Denken in »S. u. Z.« so wesentlich daran, daß die Geschichtlichkeit des Daseins erfahren wird.“ (S. 27)
Und Heidegger fügt hinzu, im „Da“ ereigne sich „die Lichtung als Wahrheit des Seins selbst“, nämlich als „Schickung des Seins“ und „Geschick der Lichtung“. (Erneut also in der apodiktischen Setzung angeblich „wahrer“ Leerformeln ! Abgesehen davon, dass Heidegger hier offenbar verzweifelt versucht, den verfehlten Anspruch von ,Sein und Zeit’ zu erneuern.)
Zum Phänomen Sprache. Diese ist laut Sein und Zeit das „Haus des Seins“. Und auch an diesem Widersinn hält Heidegger im ,Brief über den Humanismus’ fest, indem er schreibt:
„Der Mensch muß, bevor er spricht, erst vom Sein sich wieder ansprechen lassen auf die Gefahr, daß er unter diesem Anspruch wenig oder selten etwas zu sagen hat,...“ (s.o. S. 2)
Will sagen: Das Sein (die große Unbekannte!) ermöglicht erst die Sprache des Menschen, aber nicht vollumfänglich, denn vom Sein her habe der Mensch „wenig oder selten etwas zu sagen“. Und in solcher Kümmerlichkeit bestehe sogar die „Kostbarkeit“ des Mensch-Seins. Wobei das Sein selbst nunmehr als „Behausung“ des Menschen und seiner Sprache diene. Womit Heidegger schließlich das genaue Gegenteil dessen aussagt, was er in ,Sein und Zeit’ über die Sprache als „Haus des Seins“ behauptet hat. Und er bekräftigt diesen widersinnigen Standpunkt gegen Ende des ,Briefes‘, wo er konstatiert:
„Das Sein kommt, sich lichtend, zur Sprache. Es ist stets unterwegs zur ihr. Dieses Ankommende bringt das ek-sistierende Denken seinerseits in seinem Sagen zur Sprache. Diese wird so selbst in die Lichtung des Seins gehoben. Erst so ist die Sprache in jener geheimnisvollen und uns doch stets durchwaltenden Weise. Indem die also voll ins Wesen gebrachte Sprache geschichtlich ist, ist das Sein in das Andenken verwahrt. Die Ek-sistenz bewohnt denkend das Haus des Seins. In all dem ist es so, als sei durch das denkende Sagen gar nichts geschehen.“ (S. 52)
Womit Heidegger einräumt:
1. Die „Lichtung des Seins“ kommt zur Sprache.
2. Dabei kommt auch das „ek-sistierende Denken“ zur Sprache.
3. Sprache wird so der „Lichtung des Seins“ teilhaftig.
4. All dies, obwohl anscheinend durch dieses „denkende Sagen gar nichts geschehen“ ist.
Und warum dann das Ganze?, fragt man sich, verdutzt und bass erstaunt.
Einen Erklärungsversuch findet man in der Abhandlung , Humanismus‘ von Hans G. Müsse, in der es am Ende des Kapitels zu „Martin Heideggers Humanismusbrief“ heißt:
„Das Sein selbst habe den Menschen „in die Wahrheit des Seins »geworfen«, daß er, dergestalt ek-sistierend, die Wahrheit des Seins hüte“ (Martin Heidegger: Über den Humanismus, 10. Aufl., 2000, S. 22). Heidegger bezeichnet den Menschen deshalb als Hirten des Seins. Das Denken vollbringe zugleich das Wesen des Menschen. Darum ruhe im Denken die Menschlichkeit. Das Denken des Seins ereigne sich noch vor der Unterscheidung von Theorie und Praxis. Es habe weder Ergebnis noch Wirkung. Es sei ein Tun, das alle Praxis übertreffe. Die Philosophie habe dagegen aus der Sprache ein Herrschaftsinstrument über das Seiende gemacht und das Denken damit falsch interpretiert. Das /animal rationale/ gebärde sich als Herr des Seienden und kreise heimatlos um sich selbst. Es sei ausgestoßen aus der Wahrheit des Seins.“ (a.a.O. S. 27)
Wobei Müsse leider den Umstand ignoriert, dass Heidegger gar nicht weiß, wovon er redet, wenn er „die Wahrheit des Seins“ beschwört. Tatsächlich ist Heideggers Argumentation - und insbesondere seine Kritik am Humanismus - im Ganzen hinfällig, weil er nicht in der Lage ist, seine Prämisse, das Sein, zu erklären. Dies auch dann nicht, wenn er behauptet, die Technik (die er auch als „das Ge-Stell“ bezeichnet) sei „mit dem Sein im Sinne des Willens zur Macht identisch“. Und auch nicht, wenn er das Graphem ,Sein‘ mit seinem dicken, querliegenden Kreuz durchstreicht4, wodurch sich das Sein tatsächlich als letztlich „un-fassbare Größe“ erweist, wie Walter Schulz es ausdrückt (s.o.).
Unverständlich bleibt ohnehin, warum ein Philosoph vom Format Heideggers den relativ einfachen, aber engen Zusammenhang von Sein und Seiendem leugnet (oder übersieht) und sich dadurch zu widersinnigen „Erklärungsversuchen“ (um nicht zu sagen: Phantastereien) verleiten lässt. Das Sein - ursprünglich eine Substantivierung des Verbs ,sein‘ - offenbart sich doch u.a. immer dann, wenn man das Wort ,sein‘ verwendet. Wenn ich z.B. frage: „Bist du traurig?“, impliziert diese Frage das Sein eines Du und eines Ichs. Sage ich: „Das ist ein Krückstock und kein Schlagstock“, weise ich auf das tatsächlich seiende Sein des Krück-stocks und des Schlagstocks hin. Oder wenn ich sage: „Wir sind hier vielleicht nicht im Recht“, setze ich sowohl unser eigenes seiendes Sein als auch das seiende Sein des Rechts voraus. Wir sind, das heißt: wir sind im Sein selbst. Sein können wir nur im Sein selbst. Und es gilt auch: „Wir sind, aber wir haben uns nicht, darum werden wir erst.“ (Ernst Bloch). Sein manifestiert sich u.a. im Werden, was schon Hegel in seiner Wissenschaft der Logik ausführlich thematisierte. Insofern hat es die von Heidegger angeprangerte „Seins-vergessenheit“ nie gegeben. Nie wurde das Sein des Seienden geleugnet oder vergessen.
Es sind Wahrheiten, auf denen Wissenschaft und Philosophie nach wie vor aufbauen können; was auch Herbert Cysarz in seinem im Jahre 1948 erschienenen Buch ,Das seiende Sein’ gewürdigt und thematisiert hat. In dessen Vorwort schreibt er:
„Nur dieses größte Ganze, rätselhaft und täglich offenbar, darf das S e i n heißen: kein diesseitiges Sein im Sinn der pantheistischen Ästhetik oder der positivistischen Gleichsetzungen von Sein und Wirklichkeit; kein jenseitiges Sein wie viele Scholastiker und Neuscholastiker es unterstellen, kein introvertiertes Sein wie die meisten Existenzialphilosophen es auslegen; sondern ein ebenso unermeßliches wie bestimmtes, ebenso transzendierendes wie reelles Sein. Und nur das konkret ineinsgefaßte, je und je als ganzes sich verwirklichende nennen wir das seiende Sein. Es ist nicht Realisation eines Begriffs, eines geistigen Vorentwurfs; es ist die Welt in der Wirklichkeit, das All in jeder schöpferisch erfüllten Gegenwart, es ist der durchgängigste Schaffensgang und -fug der Dinge. Gewißheit und Geheimnis ineins, will es gedacht und geschaut, geglaubt und erlebt und verkörpert sein.“ (a.a.O. S. XIII)
Was er damit meint, verdeutlicht Cysarz auf insgesamt 338 Seiten in fünf Kapiteln mit den Titeln: „I. Die Welt in den Wirklichkeiten ... II. Natur und Geschichte ... III. Menschliche Wesenheit ... IV. Gemeinschaft und Inswerksetzung ... V. Sein und Geist“. - Auch dies ist Heideggers Phantasmen entgegenzusetzen, neben den bekannten Seinslehren, zu denen sicherlich auch Hegels Wissenschaft der Logik und Nicolai Hartmanns Grundlegung der Ontologie gehören. Und last not least: Von allen zutreffenden Seinsbestimmungen - überprüfbar durch die Korrespondenz-, Kohärenz- und Konsens-Theorien der Wahrheit und neuerdings auch durch KI-Suchmaschinen - profitiert immer auch der Humanismus.
Offen bleibt die Frage, warum Heidegger mit solcher Akribie und Hartnäckigkeit immer wieder versucht, das Sein als solches bzw. das Sein an sich - und nicht etwa das seiende Sein - zu ergründen. Vermuten lässt sich, dass hierbei eine These von Karl Marx eine Rolle gespielt hat, nämlich die These, wonach das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimme. Wenn dem so ist, bestünde ein erster Fehler Heideggers darin, in dem Marxschen Satz das Adjektiv ggesellschafhch ‘ zu ignorieren und das Sein zu verabsolutieren; wozu allenfalls dann ein Grund bestehen kann, wenn „das Sein“ tatsächlich jeglichem Bewusstseinsinhalt als bestimmende Größe und Substanz zu Grunde läge - wovon Heidegger überzeugt und faszi-niert ist. - Aber was heißt ,bestimmen’? Kant versteht darunter das synthetische Urteilen, das „reine oder empirische Anschauung“ erfordert. Erkenntnis ist für ihn „die Beziehung eines Bestimmbaren, zu Bestimmenden auf ein Bestimmendes, eine bestimmende Form des Denkens; das Bestimmende ist das Denken; bestimmen = bloße Form der Erkenntnis“.5 Marx deutet diese Auffassung materialistisch um. Auch das Denken und erst recht die „empirische Anschauung“ gibt es für ihn nicht ohne materielle, u.a. neuronale Grundlage - und nicht ohne die gesamten gesellschaftlichen Aktivitäten, einschließlich der Interdisziplinarität. Wenn nun aber, wie Marx lehrt, das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein „bestimmt“, bleiben Denken und Erkennen durchaus in ihren Funktionen des Bestimmens erhalten, zumal die Gesellschaft aus denkenden und erkennenden Individuen besteht, wenn auch mit speziellen körperlichen und geistigseelischen Bedürfnissen. - Heidegger lässt dies anscheinend außer Acht, zumal er letztendlich auch das Denken dem Sein unterstellt, wobei er das Sein verabsolutiert und dann nicht mehr zu erklären vermag.
Literaturhinweise:
Bloch, Ernst 1977 (1935): Erbschaft dieser Zeit, Frankfurt a.M.
Cysarz, Herbert 1948: Das seiende Sein. Geistes- und gesamtwissenschaftliche Letztfragen, Wien
Hartmann, Nicolai 1965 (1934): Grundlegung der Ontologie, Berlin
Heidegger, Martin 1981 (1947): Über den Humanismus, Frankfurt a.M.
Müsse, Hans G.: Humanismus, in: Platon heute, https://platon-heute.de/index.html
Robra, Klaus 2022: Das „verkommene“ Subjekt. Hypokeimenon, Cogito, Übermensch? Grundlegung einer Subjekt-Objekt-Philosophie, München, https://www.grin.com/document/1183185
Schulz, Walter 1992: Subjektivität im nachmetaphysischen Zeitalter. Aufsätze, Pfullingen
[...]
1 Vgl. N. Hartmann 1965, S. 40 f. , s. auch Robra 2022, S. 143 f.
2 Schulz 1992, S. 229 f. (Hervorhebungen KR.)
3 Heidegger 1981 (1947), S. 5 (Hervorhebungen KR)
4 Vgl. Heidegger 1977, S. 19, 31; s. auch K. Robra: ,Martin Heidegger und die Technik’, München 2021, https://www.grin.com/document/1038195
5 Vgl. Heinrich Ratke: Systematisches Handlexikon zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1991, S. 30 f.
- Citar trabajo
- Dr. Klaus Robra (Autor), 2025, Wie konnte das passieren? Zu Heideggers "Brief über den Humanismus", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1557656