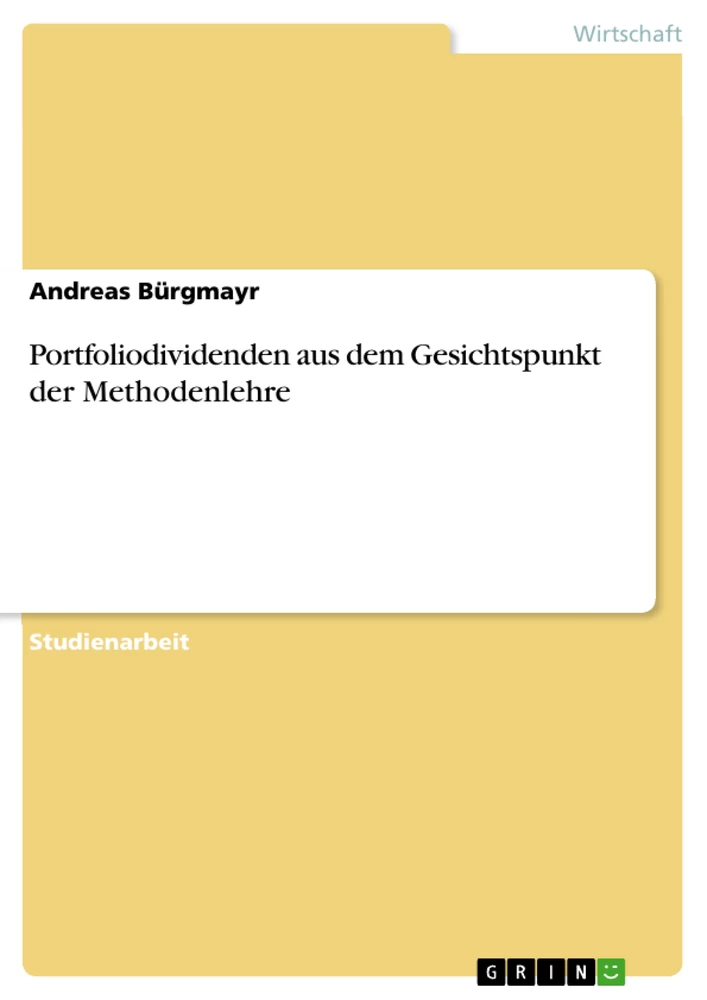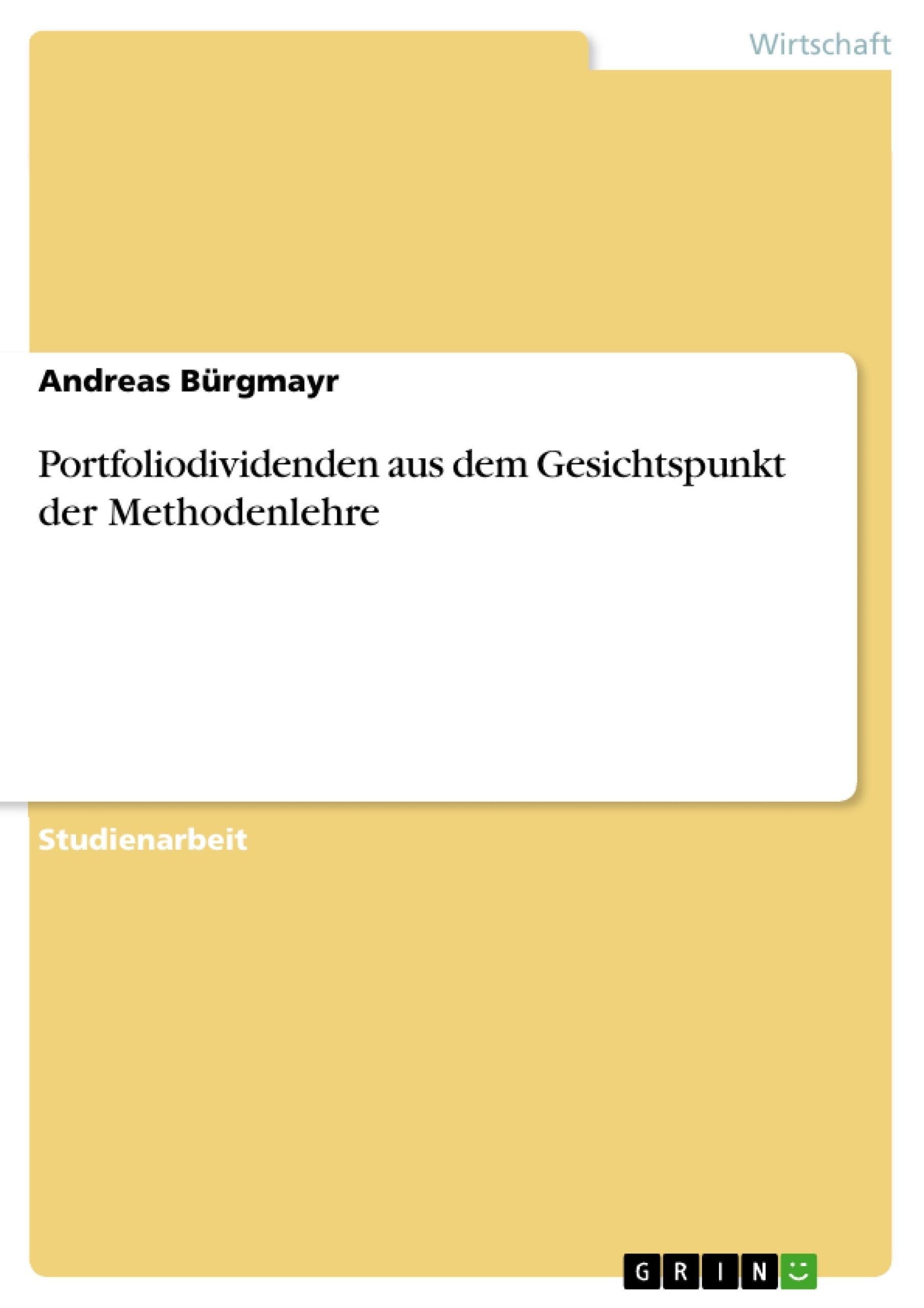Der VwGH hat im Erkenntnis vom 17.4.2008, 2008/15/0064 festgestellt, dass die Kapitalverkehrsfreiheit des Art 56 der Regelung des § 10 Abs 2 KStG, nach welcher die Dividenden aus den ausländischen Minderheitsbeteiligungen der Mitbeteiligten uneingeschränkt besteuert werden, (jedenfalls in Bezug auf Beteiligungen aus anderen Mitgliedstaaten) entgegen steht. Im Schrifttum werden die Ausführungen des VwGH zur Verdrängung von nationalem Recht durch das Gemeinschaftsrecht mittels Anwendung der Anrechnungsmethode als geringstmöglicher Eingriff in das nationale Recht kritisiert und neue praktische Probleme aufgezeigt.
Der Gesetzgeber entschied sich mit der Anpassung des § 10 KStG idF AbgÄG 2009 (RV) gegen die Anrechnungsmethode und für die Befreiungsmethode bei EU- und EWR-Minderheitsbeteiligungen, wenn die Voraussetzungen des internationalen Schachtelprivilegs nicht vorliegen. Die Befreiungsmethode kommt auch bei nationalen Beteiligungen zur Anwendung.
Der VfGH und der VwGH haben komplexe Entscheidungen zu treffen, die oft nicht unumstritten sind. Es gibt heftigste Diskussionen, ob das Erkenntnis vom 17.4.2008, 2008/15/0064 des VwGH dem Gemeinschaftsrecht entspricht, die Absicht des historischen Gesetzgebers wiedergibt, die Auslegung durch richterliche Rechtsfortbildung anstatt der Analogie zulässig ist und tatsächlich dem geringsten Eingriff entspricht.
Um diese Rechtsunsicherheit zu vermeiden wäre es primär wünschenswert, dass der Gesetzgeber seiner Verpflichtung nachkommt, gemeinschaftswidriges nationales Recht zu korrigieren und eine klare und eindeutige innerstaatliche Rechtslage zu schaffen. Dies gelingt dem Gesetzgeber nicht immer und daher ist es umso wichtiger, dass die Interpreten bei komplexen Interpretationen ihre Methoden und Wertungen transparent darlegen, um zu ermöglichen, dass darüber ein vernünftiger Diskurs geführt bzw. Kritik geübt wird, um sich der Antwort nach der Frage „wie ist bzw. war Recht wirklich“ weiter anzunähern.
Inhaltsverzeichnis
- Portfoliodividenden aus dem Gesichtspunkt der Methodenlehre.
- Gesetzeslücke
- Verhältnis Gemeinschaftsrecht zu nationalem Recht
- Verdrängung von nationalem Recht durch Gemeinschaftsrecht
- Anrechnungs- und Befreiungsmethode
- Geringster Eingriff
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Sonstige Quellen
- Verzeichnis der Internetquellen
- Entscheidungen durch Gerichte
- Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes
- Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes
- Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes
- Entscheidungen des Unabhängigen Finanzsenats
- Entscheidungen der britischen Gerichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Portfoliodividenden aus der Sicht der Methodenlehre. Sie untersucht die rechtliche Problematik der Besteuerung von Portfoliodividenden ausländischer Unternehmen im Kontext der Kapitalverkehrsfreiheit des EU-Rechts. Dabei wird der Fokus auf die Verdrängung von nationalem Recht durch das Gemeinschaftsrecht sowie auf die Anwendung der Anrechnungs- und Befreiungsmethode gelegt.
- Verdrängung des nationalen Rechts durch Gemeinschaftsrecht
- Anwendung der Anrechnungs- und Befreiungsmethode
- Der Grundsatz des geringsten Eingriffs
- Steuerechtliche Gesetzeslücken und ihre Behebung
- Aktuelle Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit behandelt die Gesetzeslücke im Zusammenhang mit der Besteuerung von Portfoliodividenden ausländischer Unternehmen. Es wird beleuchtet, wie das nationale Steuerrecht im Konflikt mit der EU-rechtlichen Kapitalverkehrsfreiheit steht und welche Methoden zur Schließung der Gesetzeslücke zur Anwendung kommen.
Im zweiten Abschnitt wird das Verhältnis von Gemeinschaftsrecht zu nationalem Recht genauer betrachtet. Die Verdrängung von nationalem Recht durch Gemeinschaftsrecht wird erläutert, und es werden die Methoden der Anrechnung und Befreiung im Kontext der Portfoliodividenden dargestellt.
Der dritte Abschnitt befasst sich mit der aktuellen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum Thema Portfoliodividenden. Die Entscheidungen des VwGH werden analysiert und in den Kontext der EU-rechtlichen Vorgaben und der Methodenlehre eingeordnet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Portfoliodividenden, Kapitalverkehrsfreiheit, Gemeinschaftsrecht, nationales Recht, Anrechnungsmethode, Befreiungsmethode, Gesetzeslücke, Rechtsfortbildung, Verwaltungsgerichtshof, VwGH, EU-Recht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Problem bei der Besteuerung von Portfoliodividenden?
Der VwGH stellte fest, dass die uneingeschränkte Besteuerung ausländischer Minderheitsbeteiligungen gegen die EU-Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen kann, wenn inländische Dividenden anders behandelt werden.
Was unterscheidet die Anrechnungs- von der Befreiungsmethode?
Bei der Anrechnungsmethode wird die ausländische Steuer auf die inländische angerechnet. Die Befreiungsmethode stellt die ausländischen Einkünfte im Inland komplett steuerfrei.
Was bedeutet „geringstmöglicher Eingriff“ in das nationale Recht?
Es beschreibt den richterlichen Grundsatz, bei der Korrektur gemeinschaftswidriger Gesetze nur so viel zu ändern, wie zur Herstellung der EU-Konformität unbedingt nötig ist.
Wie reagierte der Gesetzgeber mit dem AbgÄG 2009?
Der Gesetzgeber entschied sich gegen die vom VwGH favorisierte Anrechnungsmethode und führte die Befreiungsmethode für EU- und EWR-Minderheitsbeteiligungen ein.
Warum ist die Methodenlehre hier so wichtig?
Da Gesetzgeber und Gerichte oft unterschiedliche Wege zur Lückenschließung wählen, ist eine transparente Darlegung der Auslegungsmethoden (Analogie vs. Rechtsfortbildung) für die Rechtssicherheit entscheidend.
- Quote paper
- Mag. (FH) Andreas Bürgmayr (Author), 2009, Portfoliodividenden aus dem Gesichtspunkt der Methodenlehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155774