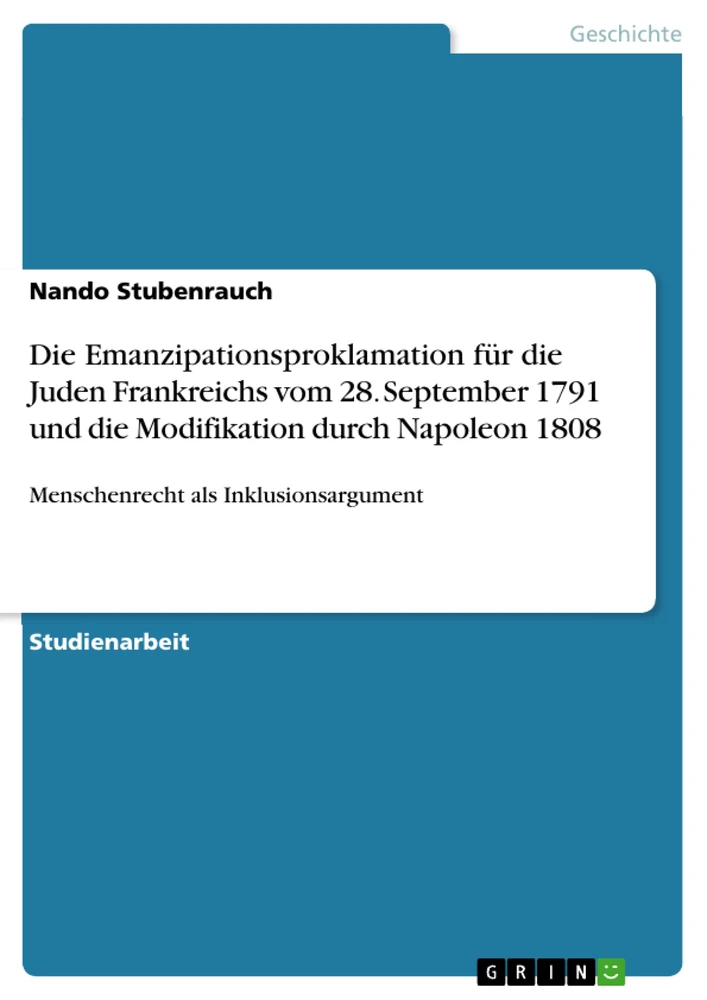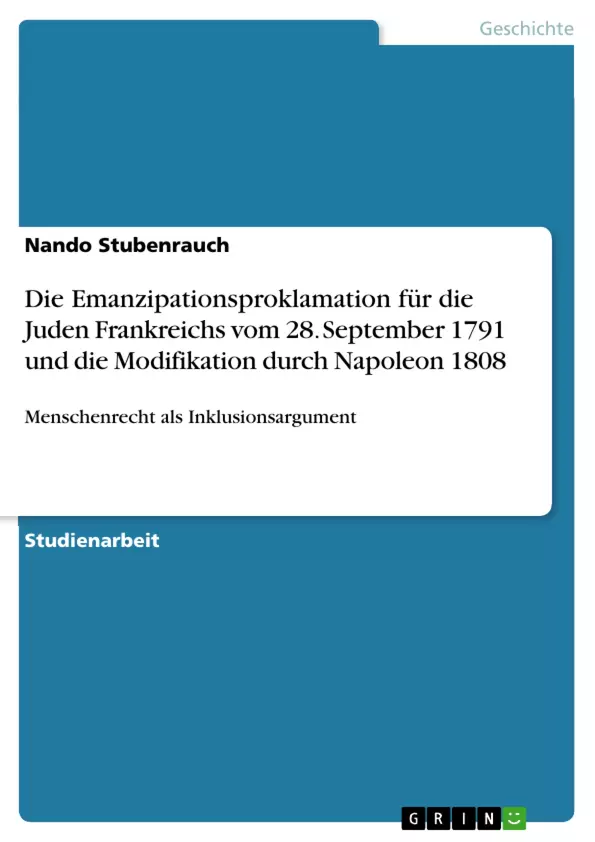Die Emanzipation der Juden in Frankreich war ein Meilenstein in der europäischen Geschichte – doch wie frei waren sie wirklich? Diese Arbeit beleuchtet die Proklamation der jüdischen Gleichstellung von 1791 und die darauf folgenden Restriktionen durch Napoleon Bonaparte. Im Zentrum steht das „décret infame“ von 1808, ein Gesetz, das jüdische wirtschaftliche Aktivitäten einschränkte und die Assimilation forcierte.
Anhand historischer Quellen und aktueller Forschungsdebatten wird kritisch hinterfragt, ob die jüdische Emanzipation in Frankreich eine Befreiung oder vielmehr eine Anpassung unter Zwang war. Dabei werden Themen wie Antisemitismus in der Aufklärung, wirtschaftliche Marginalisierung und die Rolle jüdischer Gemeinden in der napoleonischen Ära diskutiert.
Diese Arbeit stellt nicht nur die zentralen historischen Entwicklungen dar, sondern liefert auch einen Beitrag zur laufenden wissenschaftlichen Debatte: War die rechtliche Gleichstellung der Juden eine echte Emanzipation – oder doch nur eine andere Form der Kontrolle?
Inhalt
1. Einleitung
2. Décret infame - das „schändliche“ Dekret
3. Die Revolution und die napoleonischen Jahre
3.1. Revolution und Emanzipation 1789-1791
3.2. 1806 - Die Notablenversammlung
3.3. 1807-1808 - Der Grand Sanhedrin und das „infame Dekret“
3.4. Nach 1808 - Die Konsequenzen
4. Ein Grundproblem der europäisch-jüdischen Geschichte?
5. Forschungsstand und -debatten
6. Fazit
7. Quellen- & Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Zur Zeit der französischen Revolution lebten um die 40 tausend jüdische Menschen in Frankreich1, welche sich in vier Gruppen einteilen ließen. Zum einen waren dort die mehreren hundert in Paris lebenden Juden, die portugiesisch-spanischen sephardischen Juden im Südwesten Frankreichs, einige Bewohner der Provence und Papal Avignon und zum anderen die osteuropäisch-abstammenden aschkenasischen Juden in Elsaß-Lothringen.2 Die mehreren tausend Juden im Südwesten waren aufgrund ihres Wohlstands3 und ihren „gehobenen“ kommerziellen Aktivitäten als Bankiers4 von der Allgemeinheit und dem prä-revolutionären ancien régime besonders angesehen.5 Im Gegensatz dazu waren die Aschkenasim, welche vor allem in Metz, Toulouse und Verdun angesiedelt waren und den Großteil der jüdischen Bevölkerung Frankreichs ausmachten, von Armut geplagt. Sie wurden durch ghettoähnliche „Judenviertel“6 isoliert, sprachen hauptsächlich Jiddisch und waren hauptsächlich im Viehhandel, dem Feilbieten von Waren oder dem Verleihen von Krediten tätig.7 Die elsässischen Bauern stellten ihr größte Klientel dar, um sich mit dem geliehenen Geld das Land zu erwerben, welches im Zuge der anti-religiösen Revolution aus den Händen der Kirche in die Hände der Regierung gelang.8 Dies sorgte für allgemeinen Unmut und Frustration, welche in Anschuldigungen des „Wuchers“ und generellem antijüdischen Ansichten Ausdruck fand. Die darauffolgenden Unruhen und Aufstände waren wohl ein zentraler Faktor für den Erlass einiger Gesetze Napoleons, welche genau diesen „Wucher“ und die Ressentiments der elsässischen Bevölkerung versuchten einzudämmen. Eben jene Gesetze, welche besser unter dem Namen „ décret infame “ bekannt sind, bieten die grundlegende Quelle für diese Arbeit und sollen im Folgenden näher beschrieben und betrachtet werden.
2. Décret infame - das „schändliche“ Dekret
Um sich der Thematik der Emanzipation der Juden im revolutionären und napoleonischen Frankreich anzunähern, eignen sich 3 (bzw. 4) Gesetzbeschlüsse, oder Dekrete, welche am 17. März 1808 erlassen wurden. Das Vierte folgte vier Monate später im Juli. Bei der benutzten Quelle handelt es sich um einen Auszug aus einer belgischen Gesetzessammlung.9 Das ist dem Umstand zuzuschreiben, dass Belgien Teil des napoleonischen Reiches war und somit denselben Gesetzen unterstellt war, welche in Paris beschlossen wurden. Die Herkunft der Quelle deutet eine der wichtigsten Ambitionen Napoleons an, ein kohärenter, zentralisierter und rechtlich legitimierte und verfestigte Herrschaft über das gesamte französische Reich.
Diese Dekrete, welche unter der Herrschaft des französischen Kaisers Napoleon Bonaparte erhoben wurden, hatten ein zentrales Ziel, die Reorganisation der jüdischen Gemeinden Frankreichs und der Einschränkung ihrer wirtschaftlichen und kommerziellen Tätigkeiten.10 Dekret 1 & 2 etablierten die Ordnung der Konsistorien11, also religiöse und amtliche Verwaltungsgremien, bestehend aus einem Vorstand mit vier Mitgliedern und einem Komitee mit 25 Mitgliedern.12 Die Struktur der Konsistorien war hierarchisch geordnet, demnach existierte ein übergeordnetes Zentralorgan, das consistoire central israélite. 13 Die fünf Mitglieder14 des Zentralkonsistoriums wurden von Napoleon höchstpersönlich aus den Teilnehmenden der Notablenversammlung erlesen. Diese Versammlung wurde zwei Jahre zuvor, am 26. Juli 1806, einberufen, um von 111 jüdischen Notablen und Adligen aus Frankreich und Italien Auskunft über verschiedene Ansichten auf unterschiedliche Fragen zu erlangen. Die Aufgaben dieses Organs umfassten die Koordination der Aktivitäten der untergeordneten regionalen Konsistorien, das Durchsetzen der Regulationen und der Kontakt zu staatlichen Behörden. Ebenso besaßen sie die Autorität Rabbiner für die Leitung der Konsistorien zuzulassen oder abzulehnen.15 Die besagten regionale Konsistorien verwalteten jüdische Gemeinden in einem Gebiet mit mindestens 2000 Angehörigen16 und standen unter der Leitung von einem Rabbiner und drei Leihen, welche keine vergangene Verwicklung in Geldleihe aufweisen durften. Kleinere Gemeinden wurden einem einzelnen Rabbiner unterworfen, der neben seiner religiösen und spirituellen Rolle nun auch die eines Amts- und Staatsmannes17 erfüllte. Dies ist eines der Indizien für die erzwungene Säkularisierung des Judentums durch die Beschlüsse der französischen Führungsschicht. Aufgabe dieser Gremien waren die Verwaltung der Synagogen und deren Bau, die Verwahrung der religiösen Finanzen und die wohl signifikanteste Aufgabe, die „Regenerierung“ der Juden.
Die „Regenerierung“ war eine zentrale Idee der zeitgenössischen aufklärerischen Bewegung18, die von Denkern wie Christian Wilhelm Dohm19 oder Abbé Grégoire20 popularisiert wurde. Der Kern dieser Idee war es, staatliche Oberhäupter davon zu überzeugen, dass ihre jüdischen Untertanen ihnen von Nutzen sein konnten. Diese Formulierung der Nützlichkeit sprach den Aktivitäten der Juden sämtlichen Wert ab, was mit der zeitgenössischen Sicht korrespondierte, dass Geldgeschäfte kein produktives Unterfangen waren. Doch diese Sicht ignorierte nicht nur den Fakt, dass nicht die Gesamtheit der jüdischen Bevölkerung Kredite verliehen21, sondern fundierte sie auch auf einer arbiträren, willkürlich gewählten Definition von „Produktivität“. Produktiv und nützlich waren in diesem Kontext nur, was dem Herrscher und seinem Regime am meisten Nutzen verschaffte und am wenigsten Schaden verursachte. Auch ist es erwähnenswert, dass Kredite essenziell für Investitionen und wirtschaftlichen Fortschritt waren, die Kritik an jüdischen Kreditgebern war also nur in dem Maße gerechtfertigt, dass Manche exorbitante Zinsen verlangten. Jedoch widerlegt diese Kritik nicht die Tatsache, dass die jüdische Bevölkerung Frankreichs einen produktiven Teil in der Gesellschaft beitrugen.
Das dritte Dekret, auch bekannt als decrét infame, machte sich die Unterdrückung der Geldgeschäfte und den vorgeworfenen Wucher jüdischer Kreditgeber zur Aufgabe. Zum einen wurden sämtliche Schuldenzahlungen getilgt, vermindert, oder verschoben, wenn sie jüdischen Kreditgebern galten. Eben jene benötigten ab sofort eine Geschäftslizenz, die sie sich bei ihrem zuständigen Präfekten einholen mussten, unter der Einwilligung der Konsistorien. Die Lizenz musste jährlich erneuert werden22, was eine staatliche Bürokratisierung der jüdischen kommerziellen Tätigkeiten mit sich führte. Somit sollten die „schlechten Äpfel“ aussortiert werden, um Wucher zu verhindern, in der Realität bot die Geschäftslizenz bloß einen weiteren Vorwand, um das Leben und die Tätigkeiten der jüdischen Bürger aufgrund von willkürlich getroffenen Entscheidungen zu kontrollieren.
Um die Anzahl der Juden in Elsass-Lothringen zu begrenzen, erließ das Dekret zusätzlich ein Siedlungsverbot am Hoch- und Unterrhein, womit die Aschkenasim offensichtlich direkt eingeschränkt, ergo diskriminiert wurden. Auch nicht-französischen Juden wurde die Niederlassung erschwert, indem der Landerwerb und die Beschäftigung in der Landwirtschaft als Voraussetzung für die Einwanderung beschlossen wurden.23
Napoleons Dekret verfolgte drei zentrale Ziele: zum einen sollten der Wucher, die Geldleihe und das Hausieren der kommerziell tätigen Juden unterdrückt werden. Somit konnte die antijüdische Stimmung im Elsass aufgrund des Wuchers und die daraus folgenden Aufstände beschwichtigt werden. Zum anderen ermöglichten die Siedlungsverbote sowohl die Kontrolle der Verbreitung der elsässischen Juden als auch die Eindämmung weiterer als unnütz und schädlich angesehener Juden aus dem Ausland. Das letztere Ziel klang in den beiden anderen Zielen bereits an: die Förderung „nützlicher“ Arbeit in der Industrie und der Landwirtschaft. Wie bereits angerissen gründet der Begriff der Nützlichkeit auch hier auf keiner klar definierten Basis, der Schaden an französischen Bürgern soll minimiert und der produktive Nutzen für die Allgemeinheit maximiert werden. Offensichtlich besitzt diese pseudo-altruistische Regelung nur für jüdische Unternehmer Geltung. Nicht-jüdische Unternehmer und Bankiers wurden keiner vergleichlichen Behandlung ausgesetzt, auch wenn ihre Tätigkeiten unter dieselbe vage Definition der „unnützlichen Arbeit“ fallen sollten. Dies unterstreicht klar die diskriminierende und gezielte rechtliche Sonderbehandlung der Juden unter Napoleon Bonaparte und stellt im Vergleich zu der prä-napoleonischen Zeit eine Regression24 der jüdischen Emanzipation dar, die im Weiteren noch näher beleuchtet wird.
3. Die Revolution und die napoleonischen Jahre
Die jüdischen Gemeinden genossen vor der Revolution 1789 einen gesonderten rechtlichen Status, welcher allen nicht-christlichen25 Glaubensgemeinschaften in Frankreich zugeschrieben wurde, den Korporationsstatus. Korporationen waren historische Vorläufer moderner Organisationen und fungierten als Einrichtungen, die Kenntnisse und Fertigkeiten in die Gesellschaft trugen.26 Für die Gründung von Korporationen war die Genehmigung der berechtigten geistlichen und politischen Institutionen erforderlich. Die jüdische Korporation besaß ihre eigenen Gesetze („ halakha “), eigene Verwaltungsorgane und eigene religiöse und Bildungsinstitutionen. Ihnen wurden Sondersteuern auferlegt, ihnen stand nur begrenzter Wohnraum zur Verfügung und die Mitgliedschaft in Zünften und anderen Berufen wurden ihnen verwehrt.27 Der daraus entstandene Eindruck eines religiösen Separatismus wurde als ein zentrales Hindernis angesehen, welches der Integration der Juden in die Mehrheitsgesellschaft im Wege stand. So wurde argumentiert, die Anhänger des Judentums stellten einen „Staat im Staate“28 dar, da die jüdische Korporation durch eigene Rechtsprechung zum Beispiel nicht dem allgemeingeltenden Bürgerrecht unterworfen waren. Diese Anfeindung an eine als kulturell fremd wahrgenommene Entität war die Hauptmotivation für jüdische Vertreter und aufgeklärte Politiker eine Ausweitung des Bürgerrechts auf die Juden zu verlangen. Die ersten Schritte in diese Richtung wurden im Jahre 1789 getätigt, womit nun die Französische Revolution und der Kampf um Anerkennung und Emanzipation weiter ausgeführt werden soll.
3.1. Revolution und Emanzipation 1789-1791
Da die Aristokratie 1789 immer weiter unter Druck geriet, erließ König Ludwig XVI. am 24. Januar seine lettres patentes, in welchen eine Regelung für die Einberufung der Versammlung der Generalstände festgelegt wurde. Nach der Eröffnung am 5. Mai und die offizielle Einberufung der Nationalversammlung am 17. Juni konnte man nun von Frankreich als eine Nation sprechen, die die monarchischen, mittelalterlichen Strukturen des ancien régime hinter sich ließ.29 Einige Monate früher, am 25. Februar, erhielten die Sephardim in Bordeaux eine Aufforderung, ihre Abgeordneten für den dritten Stand in der Generalversammlung zu ernennen. Dieser Umstand hebt erneut die privilegierte Stellung der Juden im Südwesten Frankreichs, da den Aschkenasim im Nordosten keine solche Aufforderung gestellt wurde. Die sephardischen Vertreter verzichteten jedoch auf die Verfassung eines cahier de doléance (Beschwerdebuch), durch welche die Interessen der einzelnen Gemeinden auf der Versammlung repräsentiert werden sollten. Dies war der Überlegung geschuldet, negative und ungewollte Aufmerksamkeit auf die Juden zu vermeiden und ihnen eine schleichende Integration zu erleichtern.30
Die aschkenasischen Juden gaben sich jedoch nicht geschlagen. Sie forderten Gehör für ihre Interessen und die Ernennung eines Abgeordneten, welche ihnen von der Obrigkeit gewährt wurde. Daraufhin verfassten sie ihr eigenes cahier, welches an ihren Mittelsmann Cerf Berr in Paris versandt wurde. Dieser präsentierte eben jenes cahier dem König, woraufhin ihnen die Einberufung zur Generalversammlung, welche ihnen zuerst verwehrt wurde, letztlich gewährt. Der Inhalt des aschkenasischen cahier bezog sich vor allem auf die diskriminierenden Praktiken der französischen Obrigkeit. Zumal wurde eine Befreiung der Schutzgeldzahlung an sowohl den König als auch an regionale Adligen, die Erlaubnis zur Kultivierung des Landes außerhalb der „Judenviertel“ und die freie Praxis ihrer Religion und der Beibehaltung der Rabbiner und deren Gemeinden verlangt. Sie forderten also im Kern eine gerechte Behandlung wie alle anderen Staatsbürger, gleichzeitig jedoch waren sie nicht bereit einige Sonderrechte wieder aufgeben zu müssen. Die Aschkenasim verlangten demnach dieselbe Behandlung wie ihre sephardischen Mitbürger, welche eine solche Sonderbehandlung bereits genossen.31 Grund für diese unterschiedliche Herangehensweise sind die verschiedenen Ausgangspositionen der beiden Minderheiten. Die Aschkenasim genossen keine besonders privilegierte, sondern eher diskriminierende Behandlung und hatten demnach durch vehementen Protest keine Verluste zu befürchten. Die Sephardim auf der anderen Seite erlebten das genaue Gegenteil, ihre stabile und komfortable Position würde durch zu viel negativer Aufmerksamkeit in Gefahr geraten, weshalb sie sich gegen sämtliche lautstarke Forderungen entschieden.32
Als sich nun die Versammlung der Generalstände am 17. Juli als Nationalversammlung proklamierte und anschließend am 26. August die Décleration des Droits de l’Homme et du Citoyen (Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte) erließ, schlugen die zwei Hauptgruppen der französischen Juden erneut unterschiedliche Wege ein. Die sephardischen Juden hatten keinen Anlass ihre Aufnahme in die Décleration anzuzweifeln. Ferner verfassten ihre Abgeordneten einen Brief an Abbé Gregoire, ein Abgeordneter der Nationalversammlung, der sich ausgesprochen bestätigend für die Emanzipation der Juden einsetzte. Sie baten ihn keine gesonderten Plädoyers zu Gunsten der jüdischen Emanzipation der Versammlung mitzuteilen, womit sie erneut das Risiko des Schweigens eingingen.33 Dieses Risiko konnten sich die Juden aus dem Nordosten allerdings nicht leisten. Ihnen war nun nicht nur die Aufnahme in die Bürgerrechtsdeklaration, sondern auch die Abschaffung aller Hindernisse und Diskriminierungen von Bedeutung. Somit verfasste Berr Isaac Berr, der Treuhänder der jüdischen Gemeinde in Nancy, eine Ansprache an die Nationalversammlung, in welcher erneut die Forderungen nach freier Wahl des Berufs und des Wohnsitzes, gleichberechtigte Besteuerung und den Erhalt des kommunalen Status der jüdischen Glaubensgemeinschaften gestellt wurde. Besonders der letztere Punkt stieß auf Widerstand, denn obwohl der Korporationsstatus als solcher noch nicht aufgelöst wurde, war ein solcher rechtlicher Sonderstatus für religiöse Minderheiten in einem aufgeklärten und vorwiegend katholischen Staat undenkbar.34 Den französischen Juden blieb also die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung verwehrt.
Allerdings wurden nicht nur die Juden in der Deklaration für Bürgerrechte außenvorgelassen, sondern auch die protestantische Minderheit in der katholisch-dominierten Nation. Diese hatte es jedoch leichter, die Nationalversammlung von ihrer Zugehörigkeit zu überzeugen35, wodurch sie am 24. Dezember 1789 in die Décleration aufgenommen wurden,36 und nun öffentliche Ämter bekleiden durften. Daraufhin entsandte der Sedaca 37 weitere Delegierte nach Paris, um sich mit aschkenasischen Abgeordneten zu treffen und eine gemeinsame Strategie der Interessenvertretung zu entwickeln. Jene zeigten sich jedoch kompromissbereiter als die sephardischen Delegierten, was dem Fakt geschuldet war, dass die Aschkenasim mehr Bereitschaft aufzeigten, die Pflichten eines Staatsbürgers auf sich zunehmen und auf Privilegien zu verzichten, solange ihre Kernforderungen erfüllt wurden. Da die Sephardim dagegen bereits uneingeschränkte Siedlungs- und Berufsfreiheit besaßen, wurde eine profitablere Alternative in Erwägung gezogen, eine egoistische Interessenvertretung auf Kosten ihrer Glaubensgenossen.38
Nach dieser unfruchtbaren Begegnung konzentrierten sich die jüdischen Delegierten aus dem Südwesten auf Treffen mit Abgeordneten und das Verfassen von Petitionen, um somit die Nationalversammlung von ihren gesonderten, spezifischen Qualitäten überzeugen zu können. In diesen Treffen und Schreiben wurde explizit gegen die Aschkenasim argumentiert, zum Beispiel wurden ihre separatistischen Intentionen infrage gestellt.39 Paradoxerweise nahmen die Sephardim gerade durch ihre Anschuldigung des Separatismus von der französischen Nation einen eigenen Separatismus von ihren spirituellen Brüdern und Schwestern vor, um aus reinem Egoismus ihre eigene Stellung zu wahren und zu verbessern. Auch appellierten die Delegierten somit an dem aufkommenden, aufklärerischen Säkularismus, welcher sich zu der Zeit in Frankreich verbreitete und später im Laizismus40 enden würde.
Diese moralisch fragwürdige Taktik trug jedoch Früchte, sodass ihnen am 28. Januar 1790 die Staatsbürgerschaft gewährt wurde41, und zwar unter der expliziten Prämisse, dass die Sephardim mit den Aschkenasim nicht gleichzustellen sein, wie in diesem von Frances Malino übersetzten Zitat des Abgeordneten Isaac René Guy Le Chapelier zu lesen ist.
„There is no connection whatsoever between the status of the Jews of Bourdeaux and those of Alsace. It is a question of conserving the status of the former and giving to the latter what they do not yet possess.” 42
Der letzte Satz impliziert die Absicht, den elsässischen Juden in naher Zukunft dieselben Rechte zukommen zulassen. Allerdings ließ sich diese Absicht nur schwer umsetzen, da in der Nationalversammlung immer noch starke antijüdische Ressentiments herrschten. Besonders christlich-konservative Abgeordnete ließen sich schwer für die Gleichstellung aller Juden gewinnen. Den größten Widerstand erfuhr die Emanzipation von Abgeordneten aus Elsass- Lothringen, wie Direktor Jean-François Reubell. Ihre Gegenargumente lauteten, dass die Juden gar kein Bürgerrecht wollen, da sie bereits durch ihre Sitten und religiösen Gesetze eine eigene Nation bilden würden, welcher der Französischen fremd sei. Außerdem würde das Ziel ihrer wucherischen Geldgeschäfte die Vertreibung aller Nicht-Juden und die Errichtung einer jüdischen Kolonie im Elsass sein, wozu man sie mit der Verleihung der Staatsbürgerschaft noch weiter anspornen würde. Und schließlich wolle man sich bei der angeblich überwiegend antisemitischen Bevölkerung keine Feinde machen oder seine Wählerschaft vergraulen.43
Acht Monate später wurde die erste Verfassung Frankreichs am dritten September 1791 verabschiedet, in welcher auch der Status des Staatsbürgers rechtlich definiert wurde.44 Die jüdischen Bürger wurden allerdings nicht explizit erwähnt. Der Abgeordnete Adrien du Port wies daraufhin auf die offensichtlich widersprüchliche Behandlung der elsässischen Juden hin, welche alle Voraussetzung für eine aktive Staatsbürgerschaft erfüllten. Somit sei die Ablehnung der Gleichberechtigung jüdischer Franzosen verfassungswidrig. Die Mehrheit der Anwesenden, wenn auch unter Widerstand der Fraktion Reubell, stimmte nun für die Annullierung jeglicher Aussetzungen, Restriktionen und Ausnahmen45 gegenüber der jüdischen Bevölkerung, unter der Bedingung, dass mit der Annahme der Staatsbürgerschaft der Verzicht auf jegliche Sonderrechte einherginge.46 Am 27. September 1791 wurden also jüdische Bewohner Frankreichs mit nicht-jüdischen Bürgern rechtlich gleichgestellt, was jedoch nicht die Annahme unterstützte, die Juden Frankreichs seien nun vollständig emanzipiert. Dieser Aspekt soll nach der Betrachtung des napoleonischen Einflusses auf das Leben der Juden kritisch analysiert werden.
3.2. 1806 - Die Notablenversammlung
Die französische Verfassung wurde in den folgenden Jahren in die französischen Territorien Belgien und der Batavischen Republik (heute Niederlande) getragen, und in den Jahren 1796-97 dank des Napoleonzuges nach Italien verbreitet.47 1799 erlangte Napoleon Bonaparte anschließend die Alleinherrschaft über Frankreich und beschäftigte sich in den darauffolgenden Jahren an der Seite des Papstes Pius VII. mit den Beziehungen zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus.48 Allerdings schienen zwei Konfliktlinien sich immer mehr herauszukristallisieren. Zum einen erreichten ihn Beschwerden über elsässische Juden, welche Wucher praktizierten. Der Umstand, dass jüdische Kreditgeber und Händler im Elsass immer noch tätig waren, schien die Idee der „Regenerierung“, also einer Nützlichmachung der Juden zu widerlegen.49 Auch sorgte die Frustration der Kreditnehmer in Wut umzuschwingen, da sich der Zahl der anti-jüdischen Aufstände vermehrte. Zum anderen besaßen jüdische Gemeinden im Gegensatz zu anderen Glaubensrichtungen keine zentralen und staatlichen Behörden oder Organisationen, an welche man sich wenden könnte und denen Rechenschaft zu leisten wäre.50 Da Napoleon besonderen Fokus sowohl auf die Zentralisierung als auch die Kodifizierung seiner Macht und Herrschaft legte, war eine zentralistische Organisation des Judentums für seine Regierung von großem Interesse.
Napoleon Bonaparte, der einiger Forschung nach vermeintlich allgemein verbreitete anti-jüdische Vorurteile teilte, war besonders von den ständigen Unruhen und Aufständen in Elsass-Lothringen besorgt.51 Um die wütenden Bauern zu besänftigen, beschloss der Conseil d’État (dt.: Staatsrat) am 30. Mai 1806 ein temporäres Moratorium, heißt also ein Aufschub aller Ratenzahlungen, welche jüdischen Kreditgebern galten. Diese Maßnahme wurde 1807 erneut verlängert und wurde daraufhin im „infamen Dekret“ kodifiziert. In derselben Sitzung verlangte der Herrscher eine Versammlung von jüdischen Notablen und Adligen aus Frankreich und Italien, die ihm bei deinem Vorhaben, die Juden zu regenerieren und integrieren, Rat geben sollten.52 Am 26. Juli fand die sogenannte ,Notablenversammlung‘ statt, zu denen 111 Notable einberufen wurden. Das zentrale Ziel der Versammlung war es, „[...] den Glauben der Juden mit den Pflichten der Franzosen in Einklang zu bringen und sie zu nützlichen Bürgern zu machen, da wir entschlossen sind, dem Übel abzuhelfen, dem sich viele von ihnen zum Schaden unserer Untertanen hingeben.“ [Übersetzung des Verfassers].53 Den Versammelten wurde eine Liste mit zwölf Fragen vorgelegt, hauptsächlich über das jüdische Eherecht, patriotische Überzeugungen, die Rolle der Rabbiner und das „wucherische“ Geldgeschäft.54 Die Delegierten akzeptierten die Vorherrschaft des französischen Bürgerrechts in politischen Angelegenheiten und beteuerten, das Frankreich ihre Heimat sei, die sie bis zum Tode verteidigen würden. Ebenso bestätigten sie, dass Rabbiner bloß religiöse Autorität besitzen und als spirituelle Führungskräfte dienen. Das Thema der „Mischehen“, also der Ehe zwischen Juden und Nicht-Juden, traf allerdings auf etwas mehr Widerstand, besonders bei den geladenen Rabbinern. Sie einigten sich darauf, dass Juden, die Christen heiraten, jüdisch bleiben. Bei der Frage der Geldleihe betonten sie, dass bloß wenige Juden Wucher betrieben und man sie deshalb nicht verbieten sollte.55 Diese beiden Punkte waren für Napoleon von besonderem Interesse, da er Ehen als Hauptinstrumente der Integration und Geldleihe als größtes Hindernis der erfolgreichen Assimilation ansah.
Die Antworten der Notablenversammlung waren zufriedenstellend, allerdings noch nicht rechtlich bindend, weshalb Napoleon eine weitere Versammlung anstrebte, um die besprochenen Punkte im religiösen Recht zu verankern.
3.3. 1807-1808 - Der GrandSanhedrin und das „infame Dekret“
Um sein Vorhaben, die Antworten der jüdischen Notablen in religiöses Gesetz zu verankern, zu verwirklichen, wurde eine zweite Versammlung organisiert. Diese Versammlung sollte den Namen Grand Sanhedrin tragen, eine Anspielung an den Obersten Gerichtshof aus dem antiken Jerusalem.56 Dies sollte die religiöse Bedeutsamkeit und Tragweite dieser Versammlung unterstreichen. Der Sanhedrin besaß 71 Mitglieder, von welchen 45 Rabbiner waren.
Am 09. Februar 1807 fand die erste Sitzung dieser Versammlung in Strasbourg statt. Die meisten Beschlüsse der Notablenversammlung wurden hier sanktioniert, sowie die Erklärung des Patriotismus und die rein religiöse Autorität des Rabbinerstatus. Allerdings wurde eine Reform des Eherechts abgelehnt, ein Zugeständnis war jedoch, dass Juden, die Nicht-Juden heirateten, ihren Status als Jude nicht verloren. Ebenso wurde der Geldleihe kein Verbot erteilt, sondern bloß für das Engagement in „nützlichen“ Tätigkeiten plädiert.57 Auch der Grand Sanhedrin weigerte sich also, die zwei wichtigsten Konfliktlinien Napoleons ausreichend anzusprechen und zusätzlich ließen die Aufstände der elsässischen Bauern nicht nach, was höchstwahrscheinlich zum Erlass der vier bereits behandelten Dekrete, einschließlich dem décret infame, am 17. März des darauffolgenden Jahres führte.
Die Auswirkungen des décret infame waren regional unterschiedlich. Im Südwesten wurden die Sephardim mehr oder weniger außen vorgelassen und genossen somit ein relativ unbeschwertes Leben, wie es ihnen bereits im prärevolutionären Frankreich möglich war. In Paris, Livorno und Basse Pyrénées wurde das Dekret nach 4 Monaten bereits wieder aufgehoben. Gänzlich wurde es 10 Jahre nach seinem Erlass dank König Louis XVIII am 16.März 1818 abgeschafft.58
3.4. Nach 1808 - Die Konsequenzen
Abschließend soll nun ein kleiner Ausblick auf die Zeit nach 1808 und den napoleonischen Dekreten gegeben werden. Der Katholizismus blieb bis zur revidierten charte constitutionelle vom 7. August 1830 Staatsreligion, danach wurden alle christlichen Religionen gleichgestellt und alle Geistlichen dieser Strömungen sollten von nun an den gleichen staatlichen Lohn erhalten.59 Dieses Privileg wurde 1831 auch den jüdischen Dienern Gottes zuteil, das Gehalt der Rabbiner wurde ab nun auch staatlich finanziert. Auch zog sich die Akkulturation der Juden nach 1808 in allen Teilen Frankreichs außer Elsass-Lothringen recht schnell von dannen.60 Das Consistoire central israélite (Zentralkonsistorium) blieb bis zum Gesetz über die Trennung von Kirche und Staat von 1905 bestehen61. Ebenso spielten jüdische Bürger eine zentrale Rolle in der Ausweitung der Künste, der freien Berufe und des französischen Bankwesens durch sephardische Bänker sowie zugewanderte Familien (die Hirschmanns, Rothschilds und Erbachs). Die Zahl der Konversionen und Mischehen nahm zu, was ein Indiz für eine erfolgreiche Integration bot.62
4. Ein Grundproblem der europäisch-jüdischen Geschichte?
Nun stellt sich die Frage nach der Relevanz dieses Themas für die europäisch-jüdische Geschichte. Das überzeugendste Proargument ist der Umstand, dass es sich bei der Aufnahme französischen Juden in die Décleration des Droits de l’Homme et du Citoyen um die Erste ihrer Art im modernen Europa handelt. Eine rechtliche Gleichstellung einer Minderheit mit der Mehrheitsgesellschaft ist ein zentraler Schritt in der Emanzipation dieser Minderheit. Auch ist Gleichberechtigung oft ein Heilmittel für gesellschaftliche Vorurteile und hasserfüllte Ansichten, indem sie einen neuen status quo errichtet, dem sich die Mehrheitsgesellschaft langsam, aber stetig anpasst. Natürlich lassen sich Ressentiments nur schwer gänzlich ausmerzen, besonders wenn sie nicht nur auf individueller, sondern auch auf struktureller Ebene verankert sind. Werden sie auf systemischer Makro-Ebene als „Fremde“ oder eigener „Staat im Staat“ betrachtet, zieht sich das durch die institutionelle und schließlich individuelle Ebene und fördert Misstrauen, Ressentiment und Feindseligkeit. Sind Juden „vollwertige“ Mitbürger, hat das einen Einfluss auf die Haltung der staatlichen Institutionen, sowie schließlich auch individuelle Bürger.
Auch der sich ständig entwickelnde Forschungsstand zeugt von einem hohen Interesse und der Formulierung verschiedenster Meinungen, welche die Relevanz des Themas unterstreichen und welche ich im Schlussteil leicht anreißen werde.
5. Forschungsstand und -debatten
Eine zentrale Frage, mit der sich der Großteil der Literatur beschäftigt, ist, ob es sich bei der ,Emanzipationsproklamation‘ von 1791 tatsächlich um eine befreiende Emanzipation handelt, wie sie in anderen Teilen der Welt zu beobachten war. Zunächst bedarf es einer Definition, an welcher der Zustand der französischen Juden verglichen werden soll. „Emanzipation bezeichnet einen Prozess der Befreiung aus Abhängigkeit und Unmündigkeit sowie der Verwirklichung der Selbstbestimmung [...], einem zentralen Ziel demokratischer Gesellschaften. Der Begriff wird oft im Zusammenhang mit der Unterprivilegierung gesellschaftlicher Gruppen [.] oder politischer Gemeinwesen verwendet.“63 Unabhängigkeit und Selbstbestimmung spielen also eine zentrale Rolle. Friedrich Battenberger bietet eine alternative Definition: „Das Wort - ursprünglich ein Begriff, der im römischen Recht für die Sklavenbefreiung verwendet wurde - wurde damit auf die gesellschaftliche und rechtliche Loslösung benachteiligter Gruppen aus dem Zustand der Unfreiheit bezogen [.]“64 Battenberger betont die Freiheit benachteiligter Gruppen. Frances Malino bietet uns eine weitere Definition an. „emancipation is to be defined as the culmination of a struggle based on programmate ideological grounds [...] natural rights had been withheld from the jews [...]“65 Emanzipation ist hier das Ergebnis eines Kampfes um die „natürlichen Rechte“ der Juden, welcher auf ideologischen Gründen basiert.
Anhand dieser Begriffsklärungen kann man nun Parallelen zur Gleichberechtigung der Juden Frankreichs ziehen. Sowohl Wolfgang Kruse als auch Werner Bergmann beteuern, dass ihre rechtliche Gleichstellung mit der katholischen Mehrheitsgesellschaft nicht mit materieller, gesellschaftlicher Befreiung gleichzusetzen ist. Laut Kruse erfuhren jüdische Integrationsstrategien zunehmenden Widerstand, auch aus revolutionären Lagern, wie den Jakobinern von Nancy. Auch in vermeintlich aufgeklärten Kreisen war das Vorurteil des „jüdischen Wuchers“ omnipräsent. Die Anschuldigungen des Wuchers führten dazu, dass reichen Juden oder ganzen Gemeinden Sonderabgaben von lokalen Revolutionsbehörden und Pariser Abgeordneten auferlegt wurden. Obwohl die Judensteuer offiziell 1791 abgeschafft wurde, (ein zentrales Ziel des jüdischen Aktivismus), blieb sie inoffiziell in vielen Gemeinden bestehen. Als 1795 Klage gegen die Aufrechterhaltung von Sondersteuern eingebracht wurde, beschloss der Rat der 500 1797 ihre Beibehaltung, trotz der eklatanten Verfassungswidrigkeit. Der Argumentation zufolge wurde der Korporationsstatus für jüdische Gemeinden doch nicht aufgehoben, weshalb ihre Steuerschulden nicht nationalisiert worden sind.66 Es wurde also erneut ein rechtlicher Sonderstatus für die Juden von einer institutionellen Obrigkeit kreiert, welche gegen die vermeintliche rechtliche Gleichberechtigung verstößt und gegen die materielle Emanzipation dieser betroffenen jüdischen Gemeinden spricht. Bergmann bekräftigt auch die These, das rechtliche Gleichstellung nicht unbedingt zu Emanzipation und Integration führt. Als Beispiel zieht er den erschwerten Zugang zu höheren Staatsämtern heran, welcher durch die Dominanz des katholischen Glaubens in Regierungsbelangen bis 1831 bestehen blieb.67
Werner Bergmann machte zudem eine ähnliche Entdeckung wie Wolfgang Kruse, nämlich dass besonders der Antisemitismus aus dem linken Flügel des politischen Spektrums nach 1791 zunahmen. Besonders der bereits erwähnte Zuwachs des französischen Bankwesens unter Einfluss einiger jüdischen Familien boten eine perfekte Zielscheibe. So konnten unter dem Deckmantel der Kapitalismuskritik jüdische Bankiers diffamiert und gebrandmarkt werden. Beispiele für solche linken Theoretiker sind Pierre-Joseph Proudhon, Alphonse Toussenel und Charles Fourier.68 Auch Arthur Hertzberg bekräftigt diese These. Er sieht in der französischen Aufklärung, besonders die des Voltaire, sogar den „Ursprung des modernen Antisemitismus“.69 Die Aufklärung betrachtete die Juden nicht mehr aus einer religiösen, sondern einer säkularen Perspektive. Der Grund für ihre Ausgrenzung war nun nicht mehr ihre Ablehnung des Christentums, sondern ihre Kultur, welche sie von Natur aus eigen macht und ihre biologischen Differenzen ihre Assimilation verhindert.70 Die Aufklärung brachte demnach zwei Strömungen hervor. Eine, die die Emanzipation der Juden als Notwendigkeit einer säkularen, modernen Gesellschaft ansah71 und eine, welche trotz ihre Toleranzgebote nicht auf ihre jüdischen Mitmenschen erweitern konnte und sogar Rechtfertigungen für ihre soziale Ausgrenzung suchte, um ihren eigenen Antisemitismus zu legitimieren und rationalisieren.
Die Forschung zur jüdischen Emanzipation nach der französischen Revolution lässt sich in zwei verschiedene Epochen einteilen. Daniella Doron beobachtet in ihrem Aufsatz, dass vor allem die Forschung im 20. Jahrhundert äußerst pessimistisch und negativ gegenüber der Emanzipationsproklamation eingestellt war.72 Simon Dubnow zeigte sich 1910 besorgt über den Kollaps der kommunalen Autonomie und dessen Einfluss auf die jüdische Kohäsion73. Auch Bernhard Wasserstein betrauerte die europäisch-jüdische Existenz als schwindend.74 Schmuel Trigano spricht sogar von der „obliteration of Jewish culture, after the obliteration [...] of the Jew within the citizen.”75 Die Einbürgerung und gesellschaftliche Befreiung der Juden kostete ihnen ihre kommunale Identität und die Präsenz des Judentums in der Welt76.
In der zeitgenössischen Forschung erkennt Daniella Doron einen Wandel der Meinungen. Statt „radikaler Assimilation“ wird der Prozess nun als Akkulturation beschrieben, die graduell und geographisch inkonsistent von statten ging77. Pierre Birnbaum widerlegte demnach die These, dass die Pariser Juden sich nicht blind assimilieren lassen haben, sondern ihre republikanischen Überzeugungen mit ihrem Glauben in Einklang brachten.78
Ein Aspekt, der in dieser Betrachtung- und bis dato auch in Forschung- außenvorgelassen wurde ist das Schicksal der jüdischen Kolonisierten im französisch-okkupierten Algerien. Joshua Schreier zieht eine direkte Parallele zwischen dem „Regenerierungsprozess“ der Juden in Frankreich mit der „civilizing mission“ in den Kolonien.79 In beiden Situationen wurde Unterdrückung unter dem Deckmantel des „Unnützen“ und „unassimilierbaren“ rationalisiert. Das Crémieux -Dekret, welches 1870 verabschiedet wurde, gewährte 30 tausend algerischen Juden die französische Staatsbürgerschaft. Doch selbst diese symbolische Geste, welche knapp 100 Jahre nach der Emanzipation der Juden des Mutterstaates erfolgte, erzeugte ganz eigene Probleme. So bekamen nicht nur muslimische Algerier keine französische Staatsbürgerschaft, sondern auch die jüdische Bevölkerung Süd-Algeriens.80 Sie besaßen den Status „indigènes“ (Indigene), genau wie ihre muslimischen Mitbürger. Als auch südalgerische Muslime 1925 den Bürgerstatus erhielten, blieben ungefähr 2500 Juden staatenlos,81 ohne Hoffnung auf gleichgestellte rechtliche Repräsentation. Dieser Umstand widerlegt die verbreitete These, dass jüdische Algerier sowohl keinen Widerstand gegen das koloniale Regime zeigten, sondern dazu noch von ihm profitierten.82
Die letzte Debatte, welche abschließend aufgegriffen werden soll, beschäftigt sich mit Napoleon Bonaparte als Person und seinen Absichten und Motivationen. Handelte es sich bei seiner diskriminierenden Politik um Antisemitismus oder um eine ausgeklügelte Machtdemonstration? Walter Bergmann weist daraufhin, dass Napoleon privat die Juden als „race détestable“, also als „verfluchte bzw. verhasste Rasse“ bezeichnete.83 Allerdings nennt der Autor keine Quelle für diese Behauptung, sie ist also mit Vorsicht zu genießen. Doch auch Alexander Grab erwähnt, dass der Kaiser „vermutlich allgemein verbreitete anti-jüdische Vorurteile teilte“ [Übersetzung des Verfassers],84 widerspricht dem jedoch später in seinem Aufsatz. Dort argumentiert er, dass das Moratorium 1806 und das „Infame Dekret“ 1808 „nicht durch ideologische Prinzipien, sondern durch pragmatische Überlegungen im Sinne der Sicherheit und der Ordnung motiviert wurden“ [Übersetzung des Autors].85 Er solle ganz rational die wirtschaftlichen Aktivitäten eingeschränkt haben, um somit antisemitischen Antagonismus zu verringern und um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Wie man diesen widersprüchlichen Behauptungen entnehmen kann, herrscht in dieser Debatte leider noch kein eindeutiger Konsens. Dies ist natürlich auch dem Fakt geschuldet, dass es recht schwer ist, die Motivationen und Gedanken eines Herrschers in der Retrospektive herauszufinden, vor allem wenn kaum Primärquellen, wie Tagebücher, vorhanden sind. Die Wichtigkeit solcher persönlichen Überzeugungen sollte jedoch in der Forschung nicht außenvorgelassen werden, da sie das Handeln von historischen Figuren entschlüsseln und erklären können.
6. Fazit
Es wurde dank der ausführlichen inhaltlichen Betrachtung und der Aufbereitung der Forschungsdebatten deutlich, dass trotz ausführlicher akademischer Behandlung noch immer Forschungsbedarf besteht. Darum sollte das Ziel dieser Arbeit ein nuancierter Blick auf das Thema und den Forschungsstand zu werfen und somit diesen Bedarf etwas zu stillen.
7. Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellen
Dohm, Christian Wilhelm: Ueber die bürgerliche Verbesserung der Juden, Berlin 1781.
Duvergier, J. B. (editor): Pasinomie ou Collection Complète des Lois, Décrets, Arrêtés et Réglemens Généraux, (première série, tome quatorzième), Bruxelles 1836, S. 249-253.
Grégoire, Henri: Essai sur la régéneration physique, morale et politique des Juifs, Metz 1788.
Pölitz, Karl Heinrich Ludwig: Die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit - Zweiter Band, Leipzig 1833.
Online-Ressourcen
Battenberger, Friedrich: Judenemanzipation im 18. Und 19. Jahrhundert, in: Europäische Geschichte Online, 2010, https://www.ieg-ego.eu/de/threads/europaeische-netzwerke/juedische-netzwerke/friedrich-battenberg-judenemanzipation-im-18-und-19-jahrhundert [02.04.2024].
Bonaparte, Napoleon: CG6 - 12557. - À CHAMPAGNY, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, in: NAPOLEONICA - les archives, 22. Juli 1806, https://www.napoleonica.org/en/collections/correspondance/CG6-12557.md?page=0&pageSize=20&startDate=1806-07-22 [30.03.2024].
Bundeszentrale für politische Bildung: Emanzipation, https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17396/emanzipation/ [01.04.2024].
Epafras, Leonard Chrysostomos: IBN KHALDUN AND THE JEWS: ON THE IDEA OF RELIGIOUS EMANCIPATION, https://www.academia.edu/37176032/IBN_KHALD%C5%AAN_AND_THE_JEWS_ON_THE_IDEA_OF_RELIGIOUS_EMANCIPATION?email_work_card=view-paper [02.04.2024].
Haus, Jeffrey: Consistoire central israélite, in: Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur (Onlineportal Brill), 2018, https://referenceworks.brill.com/display/entries/EJGK/COM-0156.xml?Tab- menu=article#top [30.03.2024].
Literatur
Ages, Arnold: HERTZBERG, ARTHUR. The French Enlightenment and the Jews. New York: Columbia-University Press, 1968. Pp. 420. $12.50, in: The Modern Language Journal (Vol. 53, No. 5), 1969, S. 357-358.
Bergmann, Werner: Geschichte des Antisemitismus, (Beck’sche Reihe 2187), München 62020.
Birnbaum, Pierre: The Jews of the Republic - A Political History of State Jews in France from Gambetta to Vichy, Stanford 1996.
Doron, Daniella: The Jews of Modern France: A Historiographical Essay, in: Kaplan, Zvi Jonathan; Malinovich, Nadia (Hrsg.): The Jews of Modern France - Images and Identities (Brill’s Series in Jewish Studies, Volume 56), Boston 2016, S. 9-32.
Grab, Alexander: Napoleon and the Jews (1806-1808), in: Bistrovic, Miriam; Grimmel, Andreas; u.a. (Hrsg.): Walter Grab und die Demokratiebewegung in Europa - Ein Leben für die Wissenschaft zwischen Wien, Tel Aviv und Hamburg (Schriftenreihe des EUROPA-KOLLEGS HAMBURG zur Integrationsforschung, Band 84), Baden-Baden 2022, S. 75-90.
Herlitz, Georg; Kirschner, Dr. Bruno (Hrsg.): Jüdisches Lexikon: ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Wissens in vier Bänden (Band 1), Berlin 1928.
Kruse, Wolfgang: Die französische Revolution, Paderborn 2005.
Malino, Frances: The Sephardic Jews of Bordeaux - Assimilation and Emancipation in Revolutionary and Napoleonic France, Tuscaloosa 1978.
Manuel, Albert : Les Consistoires israélites de France - Le Consistoire de Paris (1806-1905), in: Revue des études juives, tome 82, n°163-164, 1926 (Mélanges offerts à M. Israel Lévi par ses élèves et ses amis à l'occasion de son 70e anniversaire), S. 521-532.
Polke, Christian: Die Geburt des Laizismus aus dem Geist der Religionssoziologie - Auguste Comte und Émile Durkheim, in: Hidalgo, Oliver; Polke, Christian (Hrsg.): Staat und Religion - Zentrale positionen zu einer Schlüsselfrage des politischen Denkens, (Reihe Staat - Souveränität - Nation - Beiträge zur aktuellen Staatsdiskussion), Wiesbaden 2017, S. 297-316.
Prutsch, Markus J.: Die Revision der französischen Verfassung im Jahre 1830 - Zur Frage der Bewährung des Verfassungssystems der Charte constitutionelle von 1814, in: Der Staat, (Band 47, Nr. 1), 2008, S. 85-107.
Schreier, Joschua: Arabs of the Jewish Faith - The Civilizing Mission in Colonial Algeria, New Jersey 2010.
Stein, Sarah Abrevaya: Dividing south from north - French colonialism, Jews, and the Algerian Sahara, in: The Journal of North African Studies (Vol. 17, No. 5), Dezember 2012, S. 773-792.
Stichweh, Rudolf: Professionen im System der modernen Gesellschaft, in: Merten, Roland (Hrsg.): Systemtheorie sozialer Arbeit, Opladen 2000, S. 29-38.
Trigano, Shmuel: The French Revolution and the Jews, in: Modern Judaism (10, no. 2), 1990, S. 171-190.
Weiterführende Literatur
Algerische Juden:
Birnbaum, Pierre: French Jews and the ‘Regeneration’ of Algerian Jewry, in: Mendelsohn, Ezra (Hrsg.): Jews and the State - Dangerous Alliances and the Perils of Privilege, Oxford 2003, S. 88-103.
Stein, Sarah Abrevaya: Saharan Jews and the fate of French Algeria, Chicago 2014.
Aufklärung:
Francesconi, Federica: Invisible Enlighteners - The Jewish Merchants of Modena, from the Renaissance to the Emancipation (Reihe: Jewish Culture and Contexts), Philadelphia 2021.
Schechter, Ronald: Obstinate Hebrews - representation ofJews in France, 1715-1815, London 2003.
Emanzipation:
Birnbaum, Pierre; Katznelson, Ira: Paths of Emancipation - Jews, States and Citizenship, New Jersey 1995.
Französische Standardwerke:
Anchel, Robert: Napoléon et les juifs, Paris 1928.
Godechot, Jacques: LA REVOLUTION FRANÇAISE ET LES JUIFS (1789 - 1799), in: Colin, Armand (Hrsg.): Annales historiques de la Révolution française, (48e Année, No. 223), 1976, S. 47-70.
Grand Sanhedrin:
Berkovitz, Jay R.: The Napoleonic Sanhedrin - Halakhic Foundations and Rabbinical Legacy, in: CCAR Journal: A Reform Jewish Quarterly (54, 1), 2007, S. 11-34.
Linker Antisemitismus:
Battini, Michele: Socialism offools - capitalism and modern anti-Semitism, New York 2016.
Königreich Westphalen:
Lazarus, Felix: Das Königlich Westphälische Konsistorium der Israeliten, in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums (Jahrg. 58, 22, H. ^), 1914, S. 81-96.
[...]
1 Vgl. Bergmann, Werner: Geschichte des Antisemitismus, (Beck’sche Reihe 2187), München 62020, S. 22.
2 Vgl. Grab, Alexander: Napoleon and the Jews (1806-1808), in: Bistrovic, Miriam; Grimmel, Andreas; u.a. (Hrsg.): Walter Grab und die Demokratiebewegung in Europa - Ein Leben für die Wissenschaft zwischen Wien, Tel Aviv und Hamburg (Schriftenreihe des EUROPA-KOLLEGS HAMBURG zur Integrationsforschung, Band 84), Baden-Baden 2022, S. 75-90, hier: S. 75-76.
3 Vgl. Kruse, Wolfgang: Die französische Revolution, Paderborn 2005, S. 151.
4 Vgl. Grab, 2022, S. 76.
5 Vgl. Bergmann, 2020, S. 22.
6 Ebenda.
7 Vgl. Grab, 2022, S. 76.
8 Ebenda, S. 78.
9 Duvergier, J. B. (Herausgeber): Pasinomie ou Collection Complète des Lois, Décrets, Arrêtés et Réglemens Généraux, (première série, tome quatorzième), Bruxelles 1836, S. 249-253.
10 Vgl. Grab, 2022, S. 83.
11 Vgl. Manuel, Albert : Les Consistoires israélites de France - Le Consistoire de Paris (1806-1905), in: Revue des études juives, tome 82, n°163-164, 1926 (Mélanges offerts à M. Israel Lévi par ses élèves et ses amis à l'occasion de son 70e anniversaire), S. 521-532, hier: S. 522.
12 Vgl. Grab, 2022, S. 83.
13 Vgl. Manuel, 1926, S. 522.
14 Vgl . Herlitz, Georg; Kirschner, Dr. Bruno: Jüdisches Lexikon: ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Wissens in vier Bänden, (Band 1), Berlin 1928, S. 849
15 Vgl. Grab, 2022, S. 84.
16 Ebenda, S. 83.
17 Grab, 2022, S. 84.
18 Vgl. Malino, Frances: The Sephardic Jews ofBordeaux - Assimilation and Emancipation in Revolutionary and Napoleonic France, Tuscaloosa 1978, S. 38.
19 Vgl. Dohm, Christian Wilhelm: Ueber die bürgerliche Verbesserung der Juden, Berlin 1781.
20 Vgl. Grégoire, Henri: Essai sur la régéneration physique, morale et politique des Juifs, Metz 1788.
21 Ein Teil der südwestlichen Bevölkerung der sephardischen Juden bekleideten bereits vor der expliziten Erlaubnis im Jahre 1790 politische Ämter; siehe: Malino, 1978, S. 48. Nach der Emanzipation 1791 stieg auch im Nordosten die politische Partizipation in den jüdischen Gemeinden an; siehe: Ebenda, S. 56.
22 Vgl. Grab, 2022, S. 86.
23 Vgl. Grab, 2022, S. 87.
24 Ebenda, S. 88.
25 Vgl. Bergmann, 2020, S. 17.
26 Vgl. Stichweh, Rudolf: Professionen im System der modernen Gesellschaft, in: Merten, Roland (Hrsg.): Systemtheorie sozialer Arbeit, Opladen 2000, S. 29-38, hier: S. 29.
27 Vgl. Grab, 2022, S. 76.
28 Bergmann, 2020, S. 18.
29 Vgl. Malino, 1978, S. 40.
30 Vgl. Malino, 1978, S. 41-42.
31 Ebenda, S. 43.
32 Ebenda, S. 44.
33 Vgl. Malino, 1978, S. 45.
34 Ebenda, S. 45-46.
35 Als Gegenargumente gegen eine gleichzeitige Aufnahme von Protestanten und Juden wurde erneut Einspruch erhoben, dass die Juden eine „Nation in der Nation“ darstellen würden und somit nicht assimilierbar seien; siehe: Malino, 1978, S. 48.
36 Vgl. Grab, 2022, S. 77.
37 Die Société de Bienfaisance (auch Sedaca oder nation) war die formelle kommunale Struktur der portugiesischen Juden in Bourdeaux, siehe: Malino, 1978, S. 10.
38 Vgl. Malino, 1978, S. 49.
39 Vgl. Malino, 1978, S. 49-50.
40 Laizismus beschreibt das „französische Modell der Verhältnisbestimmung von Staat und Religion“; siehe: Polke, Christian: Die Geburt des Laizismus aus dem Geist der Religionssoziologie - Auguste Comte und Émile Durkheim, in: Hidalgo, Oliver; Polke, Christian (Hrsg.): Staat und Religion - Zentrale Positionen zu einer Schlüsselfrage des politischen Denkens, (Reihe Staat - Souveränität - Nation - Beiträge zur aktuellen Staatsdiskussion), Wiesbaden 2017, S. 297-316, hier: S. 297.
41 Vgl. Grab, 2022, S. 77.
42 Malino, 1978, S. 51. Malino zitiert und übersetzt hier ein Zitat aus einer unveröffentlichten Dissertation von David Feuerwerker aus dem Jahre 1961. Es war mir nicht möglich Zugang zu dieser Dissertation zu erlangen, womit ich auf die Korrektheit der Übersetzung und dem Wahrheitsgehalt von Frances Malinos Zitat angewiesen.
43 Vgl. Kruse, 2005, S. 152.
44 Vgl. Pölitz, Karl Heinrich Ludwig: Die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit - Zweiter Band, Leipzig 1833, S. 4f.
45 Vgl. Grab, 2022, S. 77.
46 Vgl. Kruse, 2005, S. 153.
47 Vgl. Grab, 2022, S. 77.
48 Ebenda, S.78.
49 Ebenda.
50 Vgl. Grab, 2022, S. 78.
51 Ebenda, S. 78-79.
52 Ebenda, S. 79.
53 Napoleon: CG6 -12557. - À CHAMPAGNY, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, in: NAPOLEONICA - les archives, 22. Juli 1806, https://www.napoleonica.org/en/collections/correspondance/CG6- 12557.md?page=0&pageSize=20&startDate=1806-07-22 [30.03.2024].
54 Ebenda.
55 Vgl. Grab, 2022, S. 81.
56 Ebenda, S. 82.
57 Ebenda.
58 Vgl. Grab, 2022, S. 88-89.
59 Vgl. Prutsch, Markus J.: Die Revision der französischen Verfassung im Jahre 1830 - Zur Frage der Bewährung des Verfassungssystems der Charte constitutionelle von 1814, in: Der Staat, (Band 47, Nr. 1), 2008, S. 85-107, hier: S. 98.
60 Vgl. Bergmann, 2020, S. 25.
61 Vgl. Haus, Jeffrey: Consistoire central israélite, in: Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur (Onlineportal Brill), 2018, https://referenceworks.brill.com/display/entries/EJGK/COM-0156.xml?Tab-menu=article#top [30.03.2024]. Um auf das ,Abstract‘ dieses Artikels zuzugreifen, muss man sich per institutionellem Login eine Berechtigung beschaffen. Erst dann wird der zitierte Inhalt angezeigt.
62 Vgl. Bergmann, 2020, S. 25-26.
63 Bundeszentrale für politische Bildung: Emanzipation, https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17396/emanzipation/ [01.04.2024].
64 Battenberger, Friedrich: Judenemanzipation im 18. Und 19. Jahrhundert, in: Europäische Geschichte Online, 2010 https://www.ieg-ego.eu/de/threads/europaeische-netzwerke/juedische-netzwerke/friedrich-battenberg-judenemanzipation-im-18-und-19-jahrhundert [02.04.2024].
65 Malino, 1978, S. 52.
66 Vgl. Kruse, 2005, S. 153-154.
67 Vgl. Bergmann, 2020, S. 25.
68 Ebenda, S. 26.
69 Doron, Daniella : The Jews of Modern France: A Historiographical Essay, in: Kaplan, Zvi Jonathan; Malinovich, Nadia (Hrsg.): The Jews of Modern France - Images and Identities (Brill’s Series in Jewish Studies, Volume 56), Boston 2016, S. 9-32, hier: S. 10.
70 Vgl. Ages, Arnold: HERTZBERG, ARTHUR. The French Enlightenment and the Jews. New York: Columbia- University Press, 1968. Pp. 420. $12.50, in: The Modern Language Journal, Vol. 53, No. 5, 1969, S. 357-358.
71 Vgl. Epafras, Leonard Chrysostomos: IBN KHALDUN AND THE JEWS: ON THE IDEA OF RELIGIOUS EMANCIPATION, S. 121, (academia.edu), https://www.academia.edu/37176032/IBN_KHALD%C5%AAN_AND_THE_JEWS_ON_THE_IDEA_OF_RELIGIOUS_EMANCIPATION?email_work_card=view-paper [02.04.2024].
72 Vgl. Doron, 2016, S. 10.
73 Ebenda, S. 9.
74 Ebenda.
75 Trigano, Shmuel: The French Revolution and the Jews, in: Modern Judaism (10, no. 2), 1990, S. 171-190, hier: S. 185.
76 Ebenda.
77 Vgl. Doron, 2016, S. 12.
78 Birnbaum, Pierre: The Jews of the Republic - A Political History of State Jews in France from Gambetta to Vichy, Stanford 1996, S. 115.
79 Schreier, Joschua: Arabs of the Jewish Faith - The Civilizing Mission in Colonial Algeria, New Jersey 2010, S. 83. Siehe auch: Doron, 2016, S. 14.
80 Stein, Sarah Abrevaya: Dividing south from north - French colonialism, Jews, and the Algerian Sahara, in: The Journal of North African Studies (Vol. 17, No. 5), Dezember 2012, S. 773-792, hier: S. 774-775.
81 Ebenda, S. 775.
82 Doron, 2016, S. 15-16.
83 Bergmann, 2020, S. 24-25.
84 Grab, 2022, S. 78. Mir war es leider nicht möglich Zugriff auf die von Alexander Grab zitierte Quelle zu erhalten, um sie besser nachvollziehen zu können. (Anchel, Robert: Napoléon et les juifs, Paris 1928, S. 62-64.)
85 Ebenda, S. 89.
- Citar trabajo
- Nando Stubenrauch (Autor), 2024, Die Emanzipationsproklamation für die Juden Frankreichs vom 28. September 1791 und die Modifikation durch Napoleon 1808, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1557768