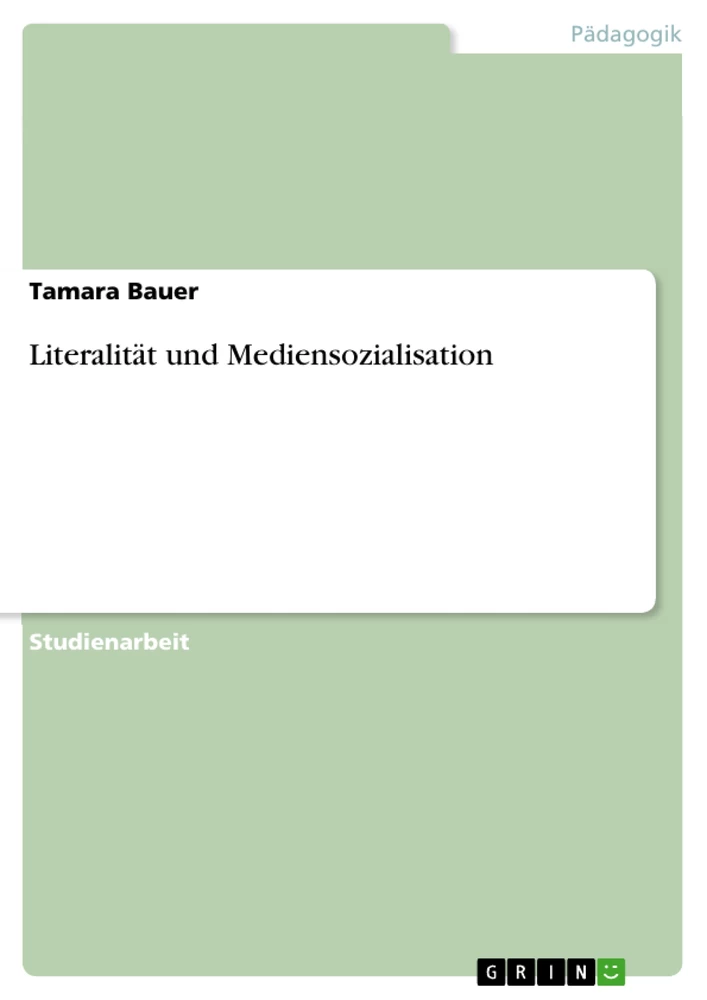[...] Zu Beginn meiner Arbeit wird die Mediennutzung heutiger Generationen
beschrieben. Es werden Studien des Medienpädagogischen Forschungsbundes
Südwest und des Instituts für angewandte Kindermedienforschung herangezogen.
Im Anschluss daran wird die Rolle des Buches im Medienverbund erläutert.
Damit verbunden ist die Veränderung der Funktionen von Lektüre.
Im Kapitel Gute Zeiten? Schlechte Zeiten? wird das Buch im Medienverbund
anhand der Begleitbücher zur Fernsehserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten
verdeutlicht. Es wird gezeigt, welche Bedeutung Filmbücher für Kinder und
Jugendliche haben. In einem weiteren Kapitel wird auf die Auswirkungen der „medialen
Veränderungen“ auf die Leseförderung eingegangen. Die veränderten
Bedingungen dürfen nicht unberücksichtigt bleiben. Die Notwendigkeit eines
Konzeptwechsels in der Leseförderung und im Literaturunterricht wird aufgezeigt.
Abschließend werden die wichtigsten Aspekte resümiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Mediennutzung
- Das Buch im Medienverbund
- Gute Zeiten? Schlechte Zeiten?
- Konzeptwechsel in der Leseförderung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Veränderungen in der Mediennutzung auf die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen. Sie befasst sich mit der Bedeutung des Buches im Medienverbund und der Notwendigkeit eines Konzeptwechsels in der Leseförderung.
- Die Veränderungen in der Mediennutzung
- Die Rolle des Buches im Medienverbund
- Der Einfluss audiovisueller Medien auf das Leseverhalten
- Die Bedeutung von Filmbüchern
- Die Notwendigkeit eines Konzeptwechsels in der Leseförderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den aktuellen Medienalltag von Kindern und Jugendlichen dar und betont die Notwendigkeit einer ausreichenden Lesekompetenz im digitalen Zeitalter.
- Die Mediennutzung: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Mediennutzung in den letzten Jahrzehnten und beleuchtet die dominierende Rolle von audiovisuellen Medien in der heutigen Zeit.
- Das Buch im Medienverbund: Dieses Kapitel untersucht die veränderten Funktionen von Lektüre im Kontext des Medienverbunds und beleuchtet die Bedeutung des Buches in einer multimedialen Welt.
- Gute Zeiten? Schlechte Zeiten?: Dieses Kapitel analysiert die Funktion von Filmbüchern, die zur Fernsehserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gehören, und zeigt ihre Relevanz für Kinder und Jugendliche auf.
Schlüsselwörter
Mediensozialisation, Lesekompetenz, Mediennutzung, audiovisuelle Medien, Buch, Filmbücher, Konzeptwechsel, Leseförderung, Literaturunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen verändert?
Audiovisuelle Medien dominieren heute den Alltag, was die Funktionen der klassischen Lektüre verändert und neue Anforderungen an die Lesekompetenz stellt.
Welche Rolle spielt das Buch im modernen Medienverbund?
Das Buch existiert nicht mehr isoliert, sondern ist oft Teil eines Verbunds, etwa als Begleitbuch zu Fernsehserien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.
Warum sind Filmbücher für die Leseförderung wichtig?
Sie können als Brücke dienen, um medienaffine Kinder und Jugendliche über bekannte TV-Inhalte zum Lesen zu motivieren.
Warum ist ein Konzeptwechsel in der Leseförderung notwendig?
Da sich die Bedingungen des Aufwachsens medial verändert haben, müssen Literaturunterricht und Leseförderung diese neuen Realitäten berücksichtigen, um effektiv zu bleiben.
Was wird unter „Mediensozialisation“ verstanden?
Es beschreibt den Prozess, wie Kinder und Jugendliche in einer von Medien geprägten Umwelt aufwachsen und wie diese Medien ihr Verhalten und ihre Kompetenzen prägen.
- Quote paper
- Tamara Bauer (Author), 2006, Literalität und Mediensozialisation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155784