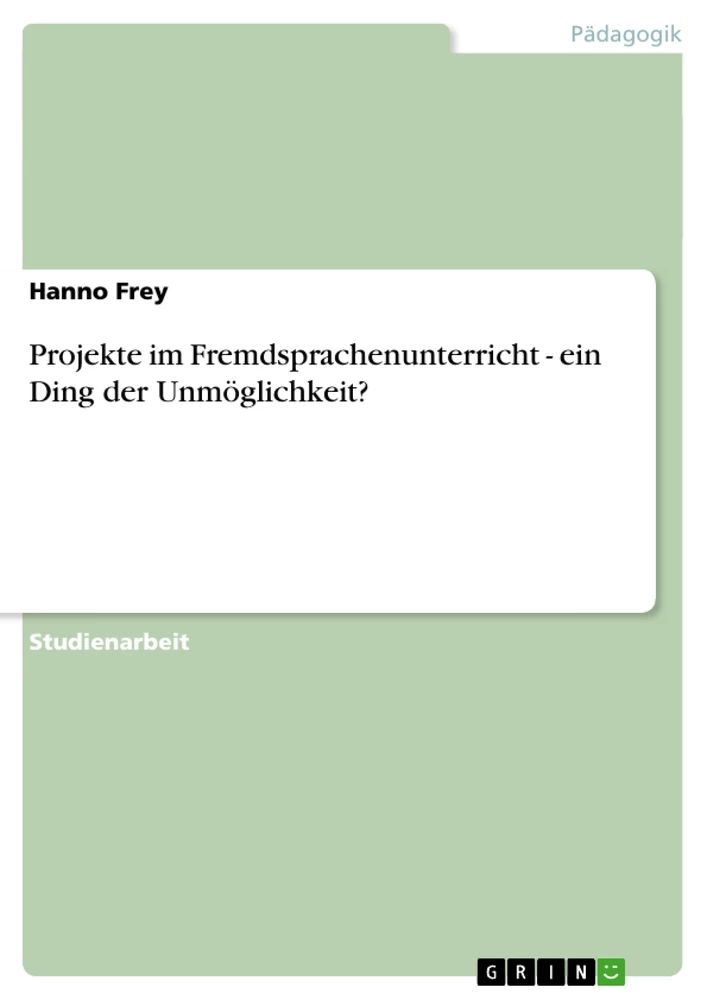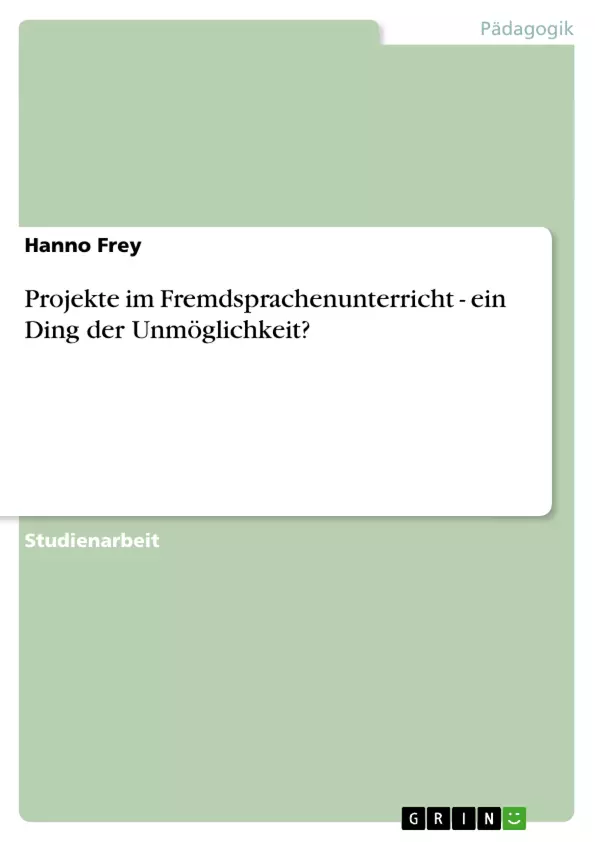Fremdsprachenunterricht und Projektarbeit sind immer wieder als "zwei sich schwer versöhnlich gegenüberstehende" (Reisener, 1999, S. 20) Lernkulturen dargestellt worden. Als direkte Folge dieser Haltung ist die Tatsache zu sehen, daß "der Projektgedanke heute in vielen Schulen immer noch auf die Projektwochen beschränkt ist" (Heursen, 1997, S. 199). Somit verläuft der überwiegende Teil des Schulunterrichts lehrerdominiert. Die Gründe dafür, Projekte vom Fachunterricht und speziell vom Fremdsprachenunterricht (vgl. hierzu: Minuth, 1996) auszugrenzen, scheinen vielfältig zu sein, wenn man den Gegnern des Einsatzes von Projekten in diesen Bereichen schulischer Arbeit Glauben schenkt.
Ein Vertreter dieser These ist beispielsweise auch Gudjons, der sich in seinem Buch "Handlungsorientiert lehren und lernen" (1986) mit zentralen Fragestellungen des Projektunterrichts beschäftigt. Im Rahmen seiner Überlegungen kommt er zur These, daß Projekte sich im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts nicht eignen und dort somit keine oder nur begrenzte Anwendung erfahren können. Ob diese These zutrifft, ist im Folgenden zu diskutieren. Dabei wird es zunächst um die Bedeutung und Entstehung des Projektbegriffes gehen. In einem zweiten Teil wird dann auf den spezifischen Zusammenhang zwischen Projekttheorie und Fremdsprachenunterricht einzugehen sein, wobei wiederholt auf Beispiele erfolgreicher Verknüpfung verwiesen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Projektbegriff
- Begriffsdefinition
- Dewey: Erfahrung, Demokratie, soziale Orientierung
- Begriffsdefinition
- Der Projektgedanke im Fremdsprachenunterricht
- Probleme und Lösungswege
- Erfahrungen im Fremdsprachenunterricht
- Lehrgänge und Sprachwissen
- Soziale Orientierung von Sprache?
- Projektinitiative
- Leistungsbeurteilung
- Probleme und Lösungswege
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Möglichkeit und Machbarkeit von Projekten im Fremdsprachenunterricht. Sie stellt die Frage, ob Projekte im Kontext des Fremdsprachenunterrichts ein \"Ding der Unmöglichkeit\" sind, und diskutiert verschiedene Argumente und Positionen zu diesem Thema. Die Arbeit geht dabei auf die historische Entwicklung des Projektbegriffs ein und beleuchtet die Ansätze von John Dewey, die eine wichtige Grundlage für den heutigen Projektgedanken in der Pädagogik darstellen. Im Fokus stehen die Herausforderungen und Chancen, die mit der Integration von Projekten im Fremdsprachenunterricht verbunden sind, und es werden konkrete Beispiele und Lösungsansätze vorgestellt.
- Der Projektbegriff und seine Entwicklung
- Deweys Konzepte von Erfahrung, Demokratie und sozialer Orientierung
- Herausforderungen und Chancen von Projekten im Fremdsprachenunterricht
- Die Rolle von Sprache und Sprachwissen in Projekten
- Leistungsbeurteilung und Evaluation von Projekten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt in das Thema Projekte im Fremdsprachenunterricht ein. Das zweite Kapitel behandelt den Projektbegriff und seine historische Entwicklung, wobei insbesondere auf die Ansätze von John Dewey eingegangen wird. In Kapitel drei wird die Frage diskutiert, wie sich der Projektgedanke in den Fremdsprachenunterricht integrieren lässt. Es werden Herausforderungen und Chancen des Projektansatzes im Fremdsprachenunterricht aufgezeigt und konkrete Beispiele für die Umsetzung von Projekten im Unterricht diskutiert. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Fremdsprachenunterricht, Projektarbeit, Projektbegriff, Dewey, Erfahrung, Demokratie, soziale Orientierung, Handlungsorientierung, Sprachlernprozess, Leistungsbeurteilung, Projektmanagement, Interkulturelles Lernen, Mehrsprachigkeit
Häufig gestellte Fragen
Sind Projekte im Fremdsprachenunterricht tatsächlich unmöglich?
Die Arbeit diskutiert diese These kritisch und zeigt anhand erfolgreicher Beispiele auf, wie Projekttheorie und Sprachunterricht trotz gegenteiliger Meinungen verknüpft werden können.
Welchen Einfluss hatte John Dewey auf den Projektbegriff?
Dewey prägte den Projektgedanken durch seine Konzepte von Erfahrung, Demokratie und sozialer Orientierung, die als Basis für handlungsorientiertes Lernen dienen.
Welche Probleme treten bei Projekten im Fremdsprachenunterricht auf?
Herausforderungen liegen oft in der systematischen Vermittlung von Sprachwissen, der sozialen Orientierung der Sprache sowie der schwierigen Leistungsbeurteilung in offenen Lernformen.
Warum wird Projektarbeit oft auf Projektwochen beschränkt?
Oft dominiert im regulären Fachunterricht eine lehrerzentrierte Kultur, die den Projektgedanken aufgrund von Zeitdruck oder Lehrplanvorgaben ausgrenzt.
Wie kann Handlungsorientierung im Sprachunterricht gelingen?
Durch die Integration von Projekten, die reale Sprachsituationen schaffen und den Lernprozess stärker an den Erfahrungen der Schüler ausrichten.
- Arbeit zitieren
- Hanno Frey (Autor:in), 2003, Projekte im Fremdsprachenunterricht - ein Ding der Unmöglichkeit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15581