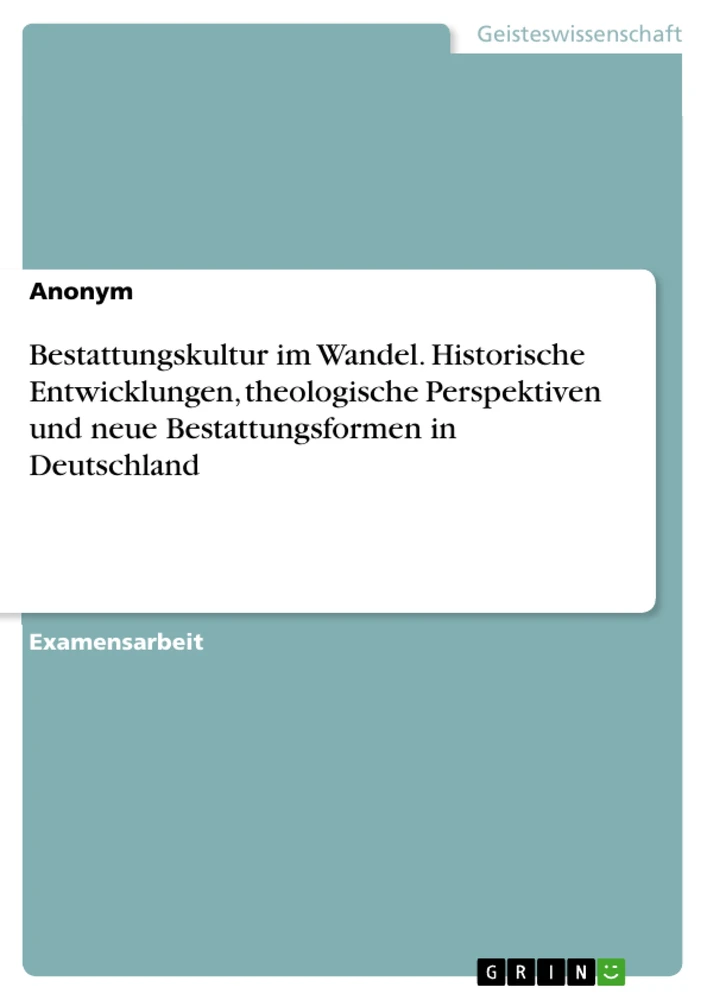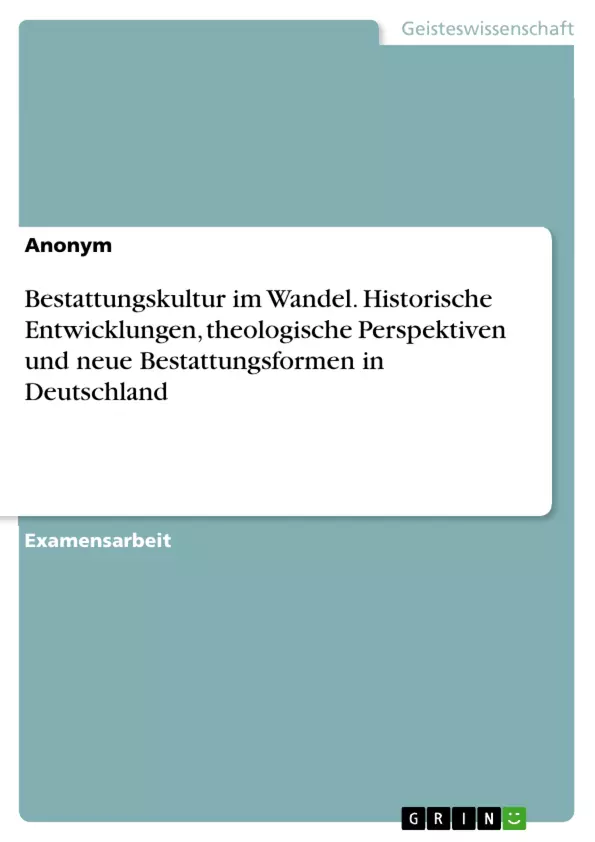Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Phänomenen und Ursachen des Wandels in der Bestattungskultur in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der (christlichen) Bestattungspraxis und ihrer Kultur. Theologisch zentrale Aspekte des Sterbens und des Todes, die für die Bestattungsthematik relevant sind, werden hierbei mitberücksichtigt. Dies trägt dem Verständnis der Bestattung als „gestreckter“ Kasualie Rechnung, das im praktisch-theologischen Teil entfaltet wird.
In Teil A werden die Themenfelder Sterben, Tod und Bestattung aus einer evangelisch-theologischen Perspektive analysiert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den praktisch-theologischen Aspekten der Kasualtheorie, der Liturgie sowie der Seelsorge und Trauerarbeit. Zur kontextuellen Einordnung werden zudem exegetische, kirchengeschichtliche und systematisch-theologische Grundlagen der Bestattung erörtert. Diese umfassende historische und theologische Darstellung ist essenziell, da der Wandel der Bestattungskultur auf verschiedenen kulturellen, theologischen und gesellschaftlichen Ebenen erfolgt. Zudem wird der Frage nach den Eigenheiten und der Entwicklung der christlichen Bestattungspraxis nachgegangen.
Teil B überträgt die zuvor behandelten Themen auf die gegenwärtige Situation in Deutschland. Dabei werden zentrale Transformationsprozesse wie die Anonymisierung, Medialisierung und Eventisierung der Bestattungskultur betrachtet. Besondere Aufmerksamkeit gilt den widersprüchlichen Tendenzen innerhalb der Gesellschaft: Während der Tod vielfach verdrängt wird, erfährt er zugleich durch verschiedene Medienformate eine verstärkte öffentliche Präsenz und wird Teil der Popkultur. Diese Ambivalenz prägt die Bestattungspraxis und -kultur in der Gegenwart.
Teil C widmet sich – ausgehend von der Feuerbestattung – verschiedenen neuen Bestattungsformen und reflektiert deren (praktisch-)theologische Potenziale, Konsequenzen und mögliche Kritikpunkte. Besonders hervorgehoben wird die Reerdigung, ein innovatives Bestattungsformat, das im deutschen Kontext in Kooperation mit der Nordkirche etabliert werden soll.
Im Fazit werden die zentralen Motive und Entwicklungen der Arbeit zusammengeführt und mögliche praktisch-theologische Perspektiven sowie weiterführende Forschungsansätze aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- a. Sterben, Tod und Bestattung aus evangelisch-theologischer Perspektive
- I. Biblisch-theologisch
- a) Altes Testament
- b) Neues Testament
- II. Kirchengeschichtlich
- III. Systematisch-theologisch
- IV. Praktisch-theologisch
- V. Zwischenfazit zu Teil a.: Zur Frage der christlichen Bestattungskultur
- I. Biblisch-theologisch
- b. Sterben, Tod und Bestattung in der Gegenwart in Deutschland
- I. Zur Einführung: Der Status quo und dessen Entstehung
- II. Bestattungskultur in Spannungsfeldern
- III. Zwischenfazit zu Teil b.: Bestattungskultur der Gegenwart
- c. „Erde zu Erde, Staub zu Staub und...?“ – Zur Vielfalt der Bestattungsformen
- I. Grundlage der Vielfalt: Die Feuerbestattung
- II. Gegenwärtig neue Bestattungsformen
- III. Zwischenfazit zu Teil c.: Bestattungsformen und der Wandel der Bestattungskultur
- a. Sterben, Tod und Bestattung aus evangelisch-theologischer Perspektive
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Bestattungskultur in Deutschland. Der Fokus liegt auf der christlichen Bestattungspraxis und ihren kulturellen Aspekten. Theologische Perspektiven auf Sterben und Tod werden berücksichtigt, um die Bestattung als „gestreckte“ Kasualie zu verstehen. Die Arbeit beleuchtet sowohl die evangelisch-theologische Sichtweise als auch die gegenwärtige Situation in Deutschland, inklusive neuer Bestattungsformen.
- Evangelisch-theologische Perspektiven auf Sterben, Tod und Bestattung
- Wandel der Bestattungskultur in Deutschland
- Einflussfaktoren des Wandels (Milieukontext, Anonymisierung, Medialisierung, Eventisierung)
- Neue Bestattungsformen und ihre theologischen Implikationen
- Praktisch-theologische Perspektiven und Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Wandel der Bestattungskultur anhand eines Beispiels: die Beisetzung von Renato Bialetti in einem übergroßen Espressokocher. Sie skizziert den Forschungsfokus auf die christliche Bestattungspraxis und ihre kulturellen Aspekte, wobei theologische Perspektiven auf Sterben und Tod mitberücksichtigt werden. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: einen evangelisch-theologischen Teil, einen Teil zur gegenwärtigen Situation in Deutschland und einen Teil zu neuen Bestattungsformen.
2. Hauptteil a. Sterben, Tod und Bestattung aus evangelisch-theologischer Perspektive: Dieser Abschnitt untersucht Sterben, Tod und Bestattung aus verschiedenen evangelisch-theologischen Perspektiven. Er beginnt mit einer biblisch-theologischen Analyse des Alten und Neuen Testaments, geht dann auf kirchengeschichtliche Entwicklungen ein und beleuchtet systematisch-theologische und praktisch-theologische Aspekte. Besonderes Augenmerk liegt auf der Kasualtheorie, der Liturgie sowie der Seelsorge und Trauerarbeit. Die historische und theologische Darstellung soll den Wandel in kulturellen, theologischen und gesellschaftlichen Ebenen verdeutlichen und die Eigenheiten der christlichen Bestattungspraxis beleuchten.
2. Hauptteil b. Sterben, Tod und Bestattung in der Gegenwart in Deutschland: Dieser Teil analysiert die gegenwärtige Bestattungskultur in Deutschland. Er untersucht Einflussfaktoren wie den Milieukontext, Anonymisierung, Medialisierung und Eventisierung. Dabei werden widersprüchliche Tendenzen thematisiert: die gesellschaftliche Verdrängung des Todes einerseits und seine Thematisierung in Medienformaten andererseits. Dies verdeutlicht die Spannungen in der gegenwärtigen Bestattungspraxis und -kultur.
2. Hauptteil c. „Erde zu Erde, Staub zu Staub und...?“ – Zur Vielfalt der Bestattungsformen: Ausgehend von der Feuerbestattung werden in diesem Abschnitt verschiedene neue Bestattungsformen vorgestellt und deren theologische Potenziale, Konsequenzen und mögliche Kritikpunkte diskutiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Reerdigung als ein neues Bestattungsformat im deutschen Kontext.
Schlüsselwörter
Bestattungskultur, Wandel, evangelisch-theologische Perspektive, Deutschland, Feuerbestattung, neue Bestattungsformen, Anonymisierung, Medialisierung, Eventisierung, Seelsorge, Trauerarbeit, Kasualtheorie, Liturgie, Biblisch-theologische Grundlagen, Kirchengeschichte, Systematische Theologie, Praktische Theologie, Reerdigung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zur Bestattungskultur?
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Bestattungskultur in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die christliche Bestattungspraxis. Sie betrachtet theologische Perspektiven auf Sterben und Tod und analysiert die aktuellen Trends und Herausforderungen in der Bestattungskultur.
Welche Themen werden in dieser Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: evangelisch-theologische Perspektiven auf Sterben, Tod und Bestattung; den Wandel der Bestattungskultur in Deutschland; Einflussfaktoren dieses Wandels wie Milieukontext, Anonymisierung, Medialisierung und Eventisierung; neue Bestattungsformen und ihre theologischen Implikationen; sowie praktisch-theologische Perspektiven.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: einen evangelisch-theologischen Teil, der Sterben, Tod und Bestattung aus biblischer, kirchengeschichtlicher, systematischer und praktischer Sicht beleuchtet; einen Teil zur gegenwärtigen Situation der Bestattungskultur in Deutschland; und einen Teil, der sich mit neuen Bestattungsformen auseinandersetzt.
Was sind die wichtigsten Schlagwörter dieser Arbeit?
Die wichtigsten Schlagwörter sind: Bestattungskultur, Wandel, evangelisch-theologische Perspektive, Deutschland, Feuerbestattung, neue Bestattungsformen, Anonymisierung, Medialisierung, Eventisierung, Seelsorge, Trauerarbeit, Kasualtheorie, Liturgie, Biblisch-theologische Grundlagen, Kirchengeschichte, Systematische Theologie, Praktische Theologie, Reerdigung.
Welche Bedeutung hat die Kasualtheorie in dieser Arbeit?
Die Arbeit versteht die Bestattung als eine "gestreckte" Kasualie und betont die Bedeutung der Kasualtheorie für das Verständnis und die Gestaltung von Bestattungsritualen.
Was wird im Teil zur gegenwärtigen Bestattungskultur in Deutschland untersucht?
Dieser Teil analysiert die aktuellen Trends und Herausforderungen der Bestattungskultur in Deutschland, einschließlich der Einflüsse von Milieukontext, Anonymisierung, Medialisierung und Eventisierung. Er thematisiert auch die widersprüchlichen Tendenzen zwischen der gesellschaftlichen Verdrängung des Todes und seiner Thematisierung in den Medien.
Welche neuen Bestattungsformen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene neue Bestattungsformen, ausgehend von der Feuerbestattung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Reerdigung als ein neues Bestattungsformat im deutschen Kontext. Die theologischen Potenziale, Konsequenzen und möglichen Kritikpunkte dieser Formen werden diskutiert.
Welche Rolle spielt die evangelisch-theologische Perspektive in dieser Arbeit?
Die evangelisch-theologische Perspektive ist zentral für die Analyse von Sterben, Tod und Bestattung. Die Arbeit untersucht biblische Grundlagen, kirchengeschichtliche Entwicklungen sowie systematisch-theologische und praktisch-theologische Aspekte, um ein umfassendes Verständnis der christlichen Bestattungspraxis zu ermöglichen.
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den Wandel der Bestattungskultur in Deutschland zu untersuchen und insbesondere die christliche Bestattungspraxis und ihre kulturellen Aspekte zu beleuchten. Theologische Perspektiven auf Sterben und Tod werden berücksichtigt, um die Bestattung als „gestreckte“ Kasualie zu verstehen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2024, Bestattungskultur im Wandel. Historische Entwicklungen, theologische Perspektiven und neue Bestattungsformen in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1558717