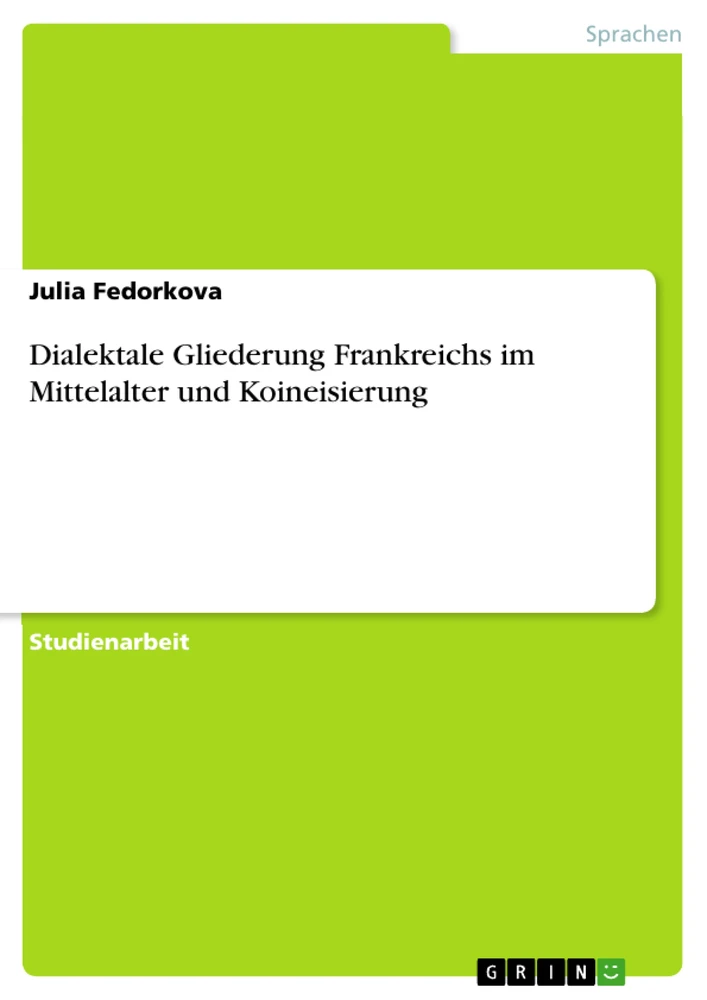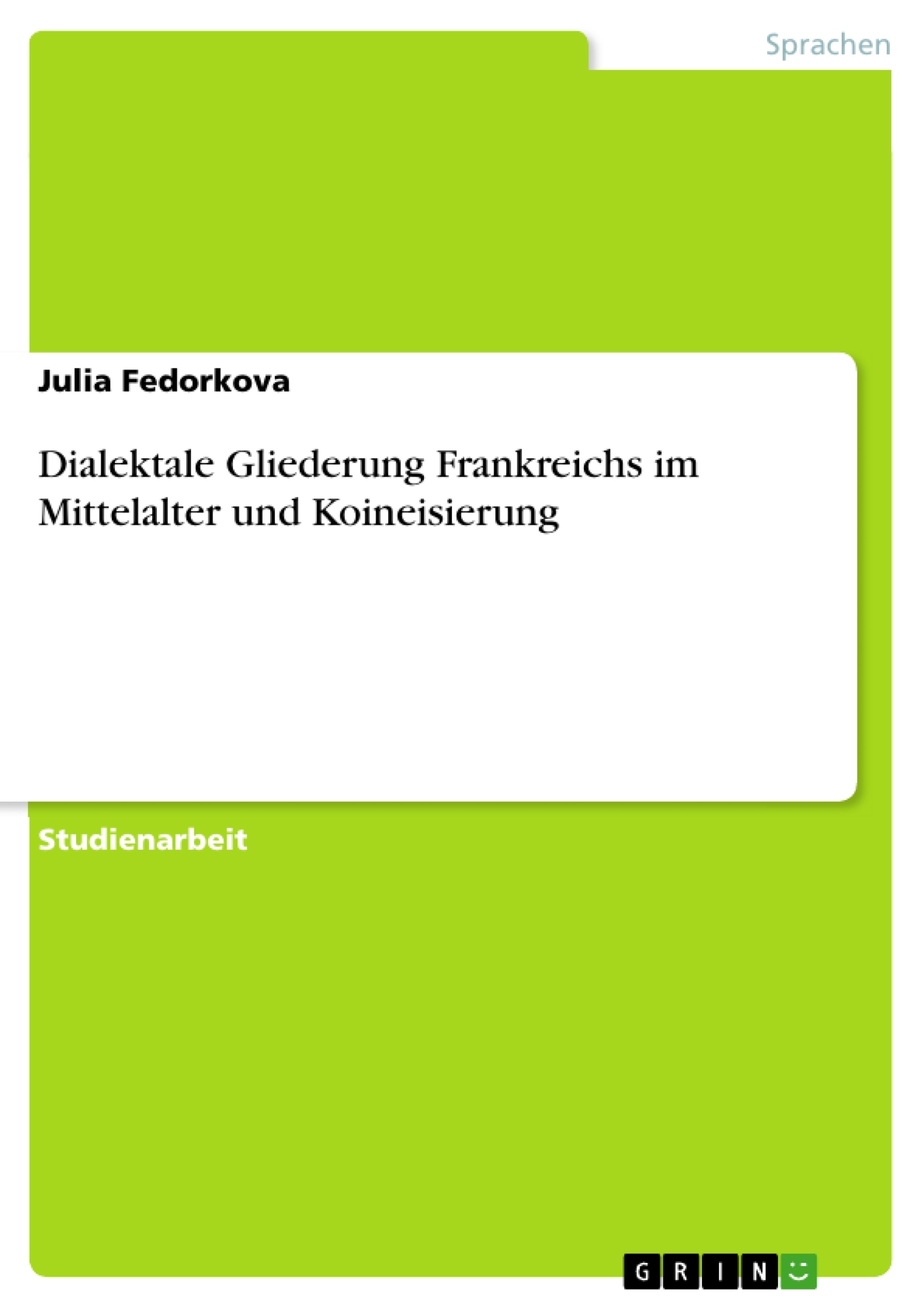Das sogenannte français commun bezeichnet die am meisten verwendete und als „normal“ (Prüßmann-Zemper 1990:830) empfundene Varietät des Französischen. Diese orientiert sich am Französischen des Gebietes der Ile-de-France und weist ein gewisses Prestige gegenüber anderen Varietäten auf, was seinen Ursprung im Mittelalter hat. (Prüßmann-Zemper 1990:830-831) Aufgrund dessen fragt man sich, inwiefern sich ein solches Muster auf die Vergangenheit übertragen lässt, wie und warum sich das Französische als Dachsprache etablierte und weshalb es ausgerechnet dieses Gebiet betrifft. Da in einigen Bereichen Quellen, die eine gesicherte Aussage zulassen fehlen, muss man sich hierbei mit Hypothesen zufrieden geben. Folglich soll zuerst ein Überblick über die Dialekte – ihre geschichtlichen Hintergründe mit eingeschlossen – gegeben werden, wobei aus jener Zeit erhaltene Schriftstücke ausgewertet werden. Anschließend wird der Prozess der Etablierung der Hochsprache, sowie seine Gründe und sein Verlauf, bei dem auch das okzitanische Sprachgebiet nicht außen vor bleibt, erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sprachliche Situation
- 2.1 Geschichtliche Hintergründe
- 2.2 Dialekte
- 2.2.1 langue d'oïl
- 2.2.2 langue d'oc und Frankoprovenzalisch
- 3 Skriptae
- 3.1 Entstehung der Schriftsprache
- 3.2 Herkunft der verschiedenen Skriptae
- 4 Koiné
- 4.1 Koineisierung
- 4.2 Kontaktsituationen
- 4.3 Koineisierung im Paris des Mittelalters
- 5 Gründe für die Vorrangstellung des Franzischen
- 6 Franzisierung der Schriftsprachen
- 6.1 Verlauf im nordfranzösischen Sprachgebiet
- 6.2 Verlauf im okzitanischen Sprachgebiet
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Französischen im Mittelalter, insbesondere den Prozess seiner Koineisierung und die Etablierung als Dachsprache. Sie beleuchtet die sprachliche Situation Frankreichs mit seinen vielfältigen Dialekten und deren geschichtlichen Hintergründe. Die Arbeit analysiert die Rolle verschiedener Faktoren bei der Herausbildung des Französischen als Standardsprache.
- Die dialektale Gliederung Frankreichs im Mittelalter
- Die Entstehung der französischen Schriftsprache
- Der Prozess der Koineisierung des Französischen
- Die Rolle des Gebietes der Ile-de-France
- Die Ausbreitung des Französischen im nord- und südfranzösischen Sprachraum
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Etablierung des Französischen als Dachsprache im Mittelalter. Sie skizziert den methodischen Ansatz und die Struktur der Arbeit, die die sprachliche Situation, die Entwicklung der Schriftsprache und den Prozess der Koineisierung beleuchten wird.
2 Sprachliche Situation: Dieses Kapitel beschreibt die sprachliche Vielfalt Frankreichs im Mittelalter. Es beleuchtet die geschichtlichen Hintergründe, indem es den Einfluss des Gallischen und Germanischen auf das Vulgärlatein und die daraus resultierende Dialektbildung erläutert. Die geographischen und politischen Faktoren, die zu dieser Vielfalt beitrugen, werden ebenfalls diskutiert. Die Kapitel beschreibt die Teilung in langue d'oïl und langue d'oc und erläutert die regionalen Unterschiede der Dialekte.
3 Skriptae: Dieses Kapitel widmet sich der Entstehung und Herkunft der verschiedenen Schriftsprachen. Es analysiert die Entwicklung einer standardisierten Schreibweise aus den regionalen Varietäten und untersucht deren Entwicklung im Laufe des Mittelalters. Die verschiedenen Schreibweisen und ihre regionale Verbreitung werden beleuchtet.
4 Koiné: Das Kapitel fokussiert auf den Prozess der Koineisierung und dessen Bedeutung für die Entwicklung des Französischen. Es analysiert die Kontaktsituationen und die sprachlichen Veränderungen, die zur Herausbildung einer gemeinsamen Sprache führten. Besonderes Augenmerk liegt auf der Koineisierung in Paris als wichtiges Zentrum des Mittelalters.
5 Gründe für die Vorrangstellung des Franzischen: Dieses Kapitel erörtert die Gründe für die Dominanz des Franzischen als Grundlage der französischen Standardsprache. Es analysiert die Faktoren, die zur Herausbildung und Verbreitung dieser Varietät beitrugen, und vergleicht sie mit anderen Dialekten. Die wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte spielen hier eine wichtige Rolle.
6 Franzisierung der Schriftsprachen: Das Kapitel beschreibt den Prozess der Ausbreitung des Franzischen im nord- und südfranzösischen Sprachgebiet. Es analysiert den Verlauf dieser Entwicklung und beleuchtet die Herausforderungen und die Rolle der politischen und sozialen Faktoren. Der Vergleich der Entwicklung im Norden und Süden Frankreichs zeigt regionale Unterschiede in der Sprachentwicklung auf.
Schlüsselwörter
Französisch, Mittelalter, Dialekte, langue d'oïl, langue d'oc, Koineisierung, Schriftsprache, Ile-de-France, Sprachgeschichte, Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entwicklung des Französischen im Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Französischen im Mittelalter, insbesondere den Prozess seiner Koineisierung und die Etablierung als Dachsprache. Sie beleuchtet die sprachliche Situation Frankreichs mit seinen vielfältigen Dialekten und deren geschichtlichen Hintergründe und analysiert die Rolle verschiedener Faktoren bei der Herausbildung des Französischen als Standardsprache.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die dialektale Gliederung Frankreichs im Mittelalter, die Entstehung der französischen Schriftsprache, den Prozess der Koineisierung des Französischen, die Rolle des Gebietes der Ile-de-France und die Ausbreitung des Französischen im nord- und südfranzösischen Sprachraum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus sieben Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Sprachliche Situation) beschreibt die sprachliche Vielfalt Frankreichs im Mittelalter, einschließlich der geschichtlichen Hintergründe und der Dialekte (langue d'oïl und langue d'oc). Kapitel 3 (Skriptae) befasst sich mit der Entstehung und Herkunft der verschiedenen Schriftsprachen. Kapitel 4 (Koiné) fokussiert auf den Prozess der Koineisierung und dessen Bedeutung für die Entwicklung des Französischen, insbesondere in Paris. Kapitel 5 (Gründe für die Vorrangstellung des Franzischen) erörtert die Gründe für die Dominanz des Franzischen. Kapitel 6 (Franzisierung der Schriftsprachen) beschreibt die Ausbreitung des Franzischen im nord- und südfranzösischen Sprachgebiet. Kapitel 7 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Französisch, Mittelalter, Dialekte, langue d'oïl, langue d'oc, Koineisierung, Schriftsprache, Ile-de-France, Sprachgeschichte, Sprachentwicklung.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit skizziert einen methodischen Ansatz zur Untersuchung der sprachlichen Entwicklung, welcher im Detail innerhalb der Arbeit beschrieben wird. Die Struktur der Arbeit beleuchtet die sprachliche Situation, die Entwicklung der Schriftsprache und den Prozess der Koineisierung.
Welche Rolle spielte die Ile-de-France?
Die Arbeit analysiert die Rolle des Gebietes der Ile-de-France bei der Herausbildung des Französischen als Standardsprache. Die Koineisierung in Paris als wichtiges Zentrum des Mittelalters wird besonders hervorgehoben.
Wie unterscheidet sich die Entwicklung des Französischen im Norden und Süden Frankreichs?
Die Arbeit vergleicht die Entwicklung des Französischen im Norden und Süden Frankreichs und zeigt regionale Unterschiede in der Sprachentwicklung auf. Der Verlauf der Franzisierung im okzitanischen Sprachgebiet wird dabei besonders beleuchtet.
Welche Faktoren trugen zur Etablierung des Französischen als Dachsprache bei?
Die Arbeit analysiert verschiedene Faktoren, die zur Herausbildung und Verbreitung des Franzischen als Grundlage der französischen Standardsprache beitrugen. Wirtschaftliche und kulturelle Aspekte spielen dabei eine wichtige Rolle.
- Arbeit zitieren
- Julia Fedorkova (Autor:in), 2010, Dialektale Gliederung Frankreichs im Mittelalter und Koineisierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155893