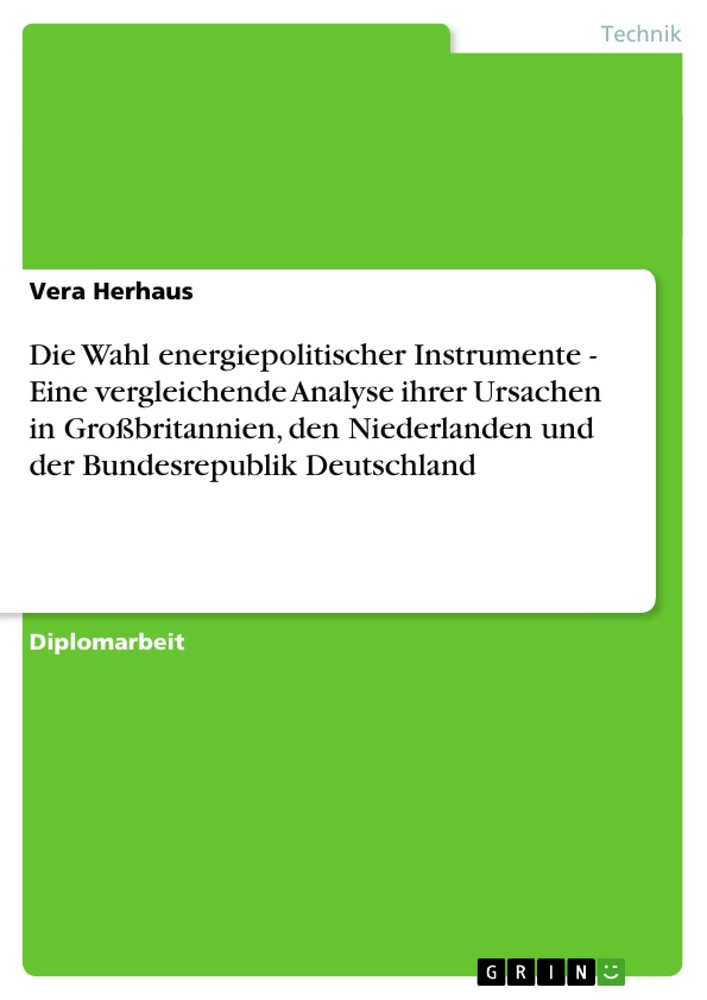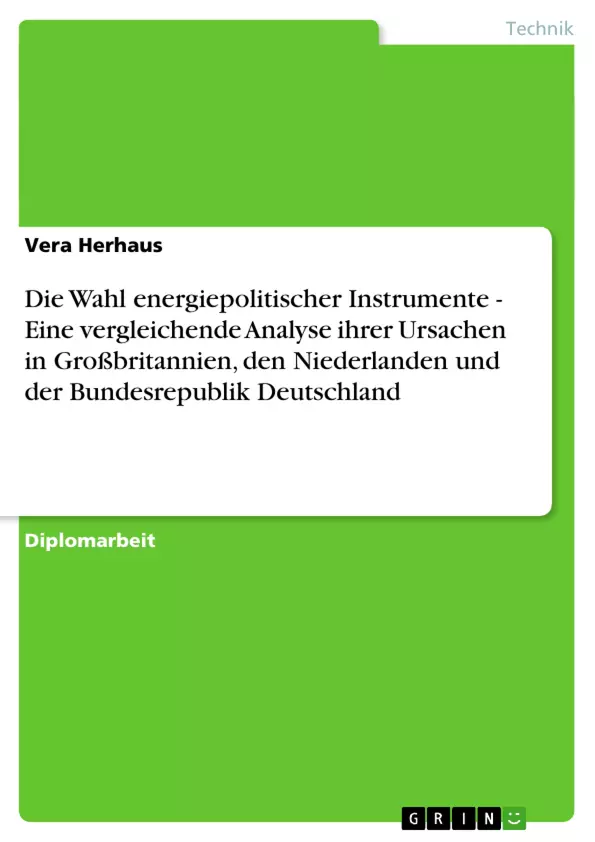In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Instrumente zur Förderung erneuerbarer
Energien in verschiedenen europäischen Ländern gewählt wurden, um den Anteil der
erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung zu erhöhen. Dabei liegt der Fokus auf den
Gründen, die sich für die Wahl eines Förderinstruments - aus einer Reihe von möglichen
Instrumenten - finden lassen. Es wird die These vertreten, dass es Faktoren gibt, die die
Instrumentenwahl beeinflussen. Da ein Zeitraum von über zehn Jahren betrachtet wird
(1990-2002) ist auch relevant, ob die Entscheidung für ein Instrument Bestand hatte, oder
ob im Laufe der Jahre ein anderes Instrument gewählt wurde und welche Gründe sich dafür
finden lassen. Politische Akteure sehen sich zunehmend vor die Frage gestellt, mit welchen Strategien sie
dem weltweit wachsenden Energiebedarf und den damit verbundenen Folgeproblemen
begegnen können, insbesondere dem Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre
und der Endlichkeit fossiler Brennstoffe. Von den energiebedingten CO2-Emissionen im
Jahr 1999 in Deutschland in Höhe von 833 Mio. t entfielen 43 % (357 Mio. t) auf den Bereich
Energieerzeugung und -umwandlung, 22 % auf den Bereich Transport und Verkehr
und ca. 15 % auf die privaten Haushalte; die restlichen 21 % verteilen sich auf Industrie,
Handel, Dienstleistungen und Gewerbe (vgl. BMWI 2001b:74). Da die Energieerzeugung
und -umwandlung für den größten Teil der CO2-Emissionen verantwortlich ist, erscheint es
sinnvoll, hier mit Einsparmaßnahmen anzusetzen. Dafür gibt es mehrere Optionen: Die
meistdiskutierten sind Energieeinspar- und Energieeffizienzstrategien sowie der Einsatz
von erneuerbaren Energien (EE)1. Regenerative Energien zu fördern ist unter rein volkswirtschaftlichen
Gesichtspunkten (Wohlfahrtssteigerung gemessen am Bruttoinlandsprodukt)
oft nicht der kostengünstigste Weg (vgl. DÜNGEN 1993:42), aber angesichts der endlichen
fossilen Ressourcen wird langfristig ein Übergang zu einem neuen Energiesystem
unausweichlich sein. [...]
1 Unter EE werden im folgenden Wind- und Wasserkraft, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Biomasse,
sowie Deponie-, Klär- und Grubengas verstanden, analog zu §1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (vgl. EEG
2000). Für die betrachteten Länder gilt die jeweils vorgestellte nationale Definition von EE. Die Begriffe
regenerative Energien und alternative Energiequellen werden synonym verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung des Themas
- Fragestellung und Ziele der Arbeit
- Methodik
- Gliederung der Arbeit
- Ansatz
- Forschungsstandanalyse
- Der analytische Bezugsrahmen
- Rahmenbedingungen
- Problemstruktur
- Akteure
- Zusammenfassung
- Instrumente zur Förderung erneuerbarer Energien
- Bewertungskriterien
- Die Modelle im Überblick
- Das Ausschreibungsmodell
- Das Quotenmodell
- Die Einspeisevergütung
- Vergleich der Instrumente
- Zusammenfassung
- Die Förderinstrumente in Deutschland
- Ökonomisch-technische Rahmenbedingungen
- Definition und Potentiale erneuerbarer Energien in Deutschland
- Entwicklung der erneuerbaren Energien
- Stromerzeugung und Verbrauch
- Struktur der Stromwirtschaft
- Politische-institutionelle Rahmenbedingungen
- Staatsstruktur
- Partizipation und Interessenvermittlung
- Kompetenzverteilung in der Energiepolitik
- Problemstruktur
- Problemdruck
- Restriktionen
- Akteure
- Politische Akteure
- Wirtschaftliche Akteure
- Gesellschaftliche Akteure
- Prozessanalyse
- Situation vor der gesetzlichen Regelung der Einspeisevergütung
- Einspeisevergütung im Stromeinspeisegesetz (1990-1998)
- Einspeisevergütung im novellierten Stromeinspeisegesetz (1998-2000)
- Einspeisevergütung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (ab 2000)
- Zusammenfassung
- Die Förderinstrumente in Großbritannien
- Ökonomisch-technische Rahmenbedingungen
- Definition und Potentiale erneuerbarer Energien in Großbritannien
- Entwicklung der erneuerbaren Energien
- Stromerzeugung und Verbrauch
- Struktur der Stromwirtschaft
- Politisch-institutionelle Rahmenbedingungen
- Staatsstruktur
- Partizipation und Interessenvermittlung
- Kompetenzverteilung in der Energiepolitik
- Problemstruktur
- Problemdruck
- Restriktionen
- Akteure
- Politische Akteure
- Wirtschaftliche Akteure
- Gesellschaftliche Akteure
- Prozessanalyse
- Situation vor Einführung des Ausschreibungsmodells
- Ausschreibungssystem der Non Fossil Fuel Obligation (1990-1998)
- Übergang zum Quotenmodell Renewable Obligation (ab 2002)
- Zusammenfassung
- Die Förderinstrumente in den Niederlanden
- Ökonomische und technische Rahmenbedingungen
- Definition und Potential erneuerbarer Energien in den Niederlanden
- Entwicklung der erneuerbaren Energien
- Stromerzeugung und Verbrauch
- Struktur der Stromwirtschaft
- Politisch-institutionelle Rahmenbedingungen
- Staatsstruktur
- Partizipation und Interessenvermittlung
- Kompetenzverteilung in der Energiepolitik
- Problemstruktur
- Problemdruck
- Restriktionen
- Akteure
- Politische Akteure
- Wirtschaftliche Akteure
- Gesellschaftliche Akteure
- Prozessanalyse
- Freiwillige Vereinbarungen in Umweltplänen
- Quotenmodell mit Grüne-Label-System (1998-2000)
- Übergang zum Quotenmodell mit Grüne-Zertifikate-System (ab 2001)
- Zusammenfassung
- Vergleich der Ergebnisse
- Ökonomisch-technische Rahmenbedingungen
- Politisch-institutionelle Rahmenbedingungen
- Problemstruktur
- Akteure
- Ursachen für die Wahl der energiepolitischen Instrumente in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden
- Ansätze zur Verallgemeinerung der Aussagen
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Wahl energiepolitischer Instrumente zur Förderung erneuerbarer Energien in Großbritannien, den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die Ursachen für die jeweilige Wahl der Instrumente und stellt diese im Kontext der jeweiligen ökonomisch-technischen, politisch-institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dar. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Dynamik des politischen Entscheidungsprozesses bei der Gestaltung von Energiepolitik zu gewinnen.
- Die Bedeutung der ökonomisch-technischen Rahmenbedingungen für die Wahl von Energiepolitik-Instrumenten
- Die Rolle der politisch-institutionellen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung von Energiepolitik
- Die Interaktion von Akteuren und deren Einfluss auf die Auswahl von Energiepolitik-Instrumenten
- Der Vergleich von verschiedenen Fördermodellen für erneuerbare Energien in verschiedenen Ländern
- Die Analyse der Prozesse, die zur Einführung und Entwicklung verschiedener Fördermodelle geführt haben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung, Fragestellung, Methodik und Gliederung. Das erste Kapitel behandelt den analytischen Bezugsrahmen und setzt sich mit den Rahmenbedingungen, der Problemstruktur und den Akteuren auseinander. Das zweite Kapitel befasst sich mit Instrumenten zur Förderung erneuerbarer Energien, bewertet diese anhand von Kriterien und stellt die Modelle im Überblick dar. Die Kapitel 3, 4 und 5 analysieren die Förderinstrumente in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden anhand der jeweiligen ökonomisch-technischen, politisch-institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, der Problemstruktur und der relevanten Akteure. Die Kapitel beleuchten außerdem die Prozesse, die zur Einführung und Entwicklung der jeweiligen Fördermodelle geführt haben. Das sechste Kapitel vergleicht die Ergebnisse der einzelnen Länderanalysen und untersucht die Ursachen für die Wahl der energiepolitischen Instrumente. Abschließend bietet das siebte Kapitel eine Zusammenfassung der Ergebnisse und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Erneuerbare Energien, Energiepolitik, Förderinstrumente, Ausschreibungsmodell, Quotenmodell, Einspeisevergütung, Vergleichende Analyse, Großbritannien, Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, Ökonomisch-technische Rahmenbedingungen, Politisch-institutionelle Rahmenbedingungen, Problemstruktur, Akteure, Prozessanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Welche Instrumente zur Förderung erneuerbarer Energien gibt es?
Zu den wichtigsten Modellen gehören das Ausschreibungsmodell, das Quotenmodell und die Einspeisevergütung.
Wie unterscheidet sich die Energiepolitik in Deutschland von der in Großbritannien?
Während Deutschland primär auf die Einspeisevergütung (z.B. durch das EEG) setzt, hat Großbritannien Erfahrungen mit dem Ausschreibungsmodell (NFFO) und später dem Quotenmodell (Renewable Obligation) gesammelt.
Was beeinflusst die Wahl eines energiepolitischen Instruments?
Die Wahl wird durch ökonomisch-technische Rahmenbedingungen, politisch-institutionelle Strukturen (wie die Staatsstruktur) und das Zusammenspiel verschiedener Akteure beeinflusst.
Was ist das Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)?
Das EEG zielt darauf ab, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung durch garantierte Vergütungssätze für Erzeuger nachhaltig zu erhöhen.
Welche Rolle spielen die Niederlande in der europäischen Energiepolitik?
Die Niederlande nutzten unter anderem freiwillige Vereinbarungen in Umweltplänen und entwickelten später Quotenmodelle mit Grünen Zertifikaten.
- Quote paper
- Vera Herhaus (Author), 2003, Die Wahl energiepolitischer Instrumente - Eine vergleichende Analyse ihrer Ursachen in Großbritannien, den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15595