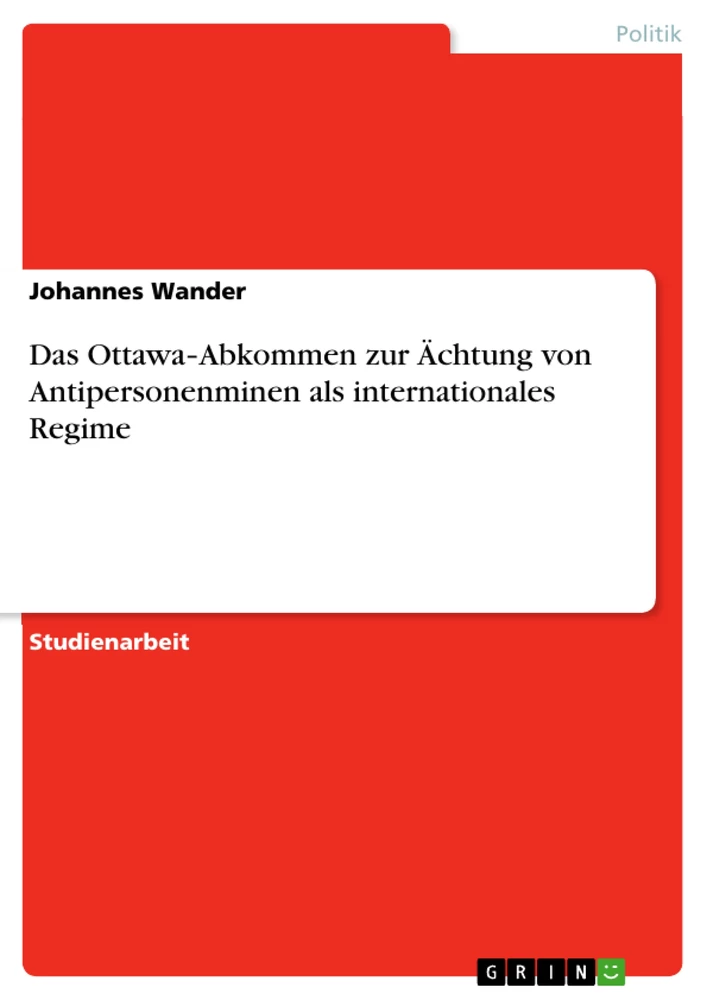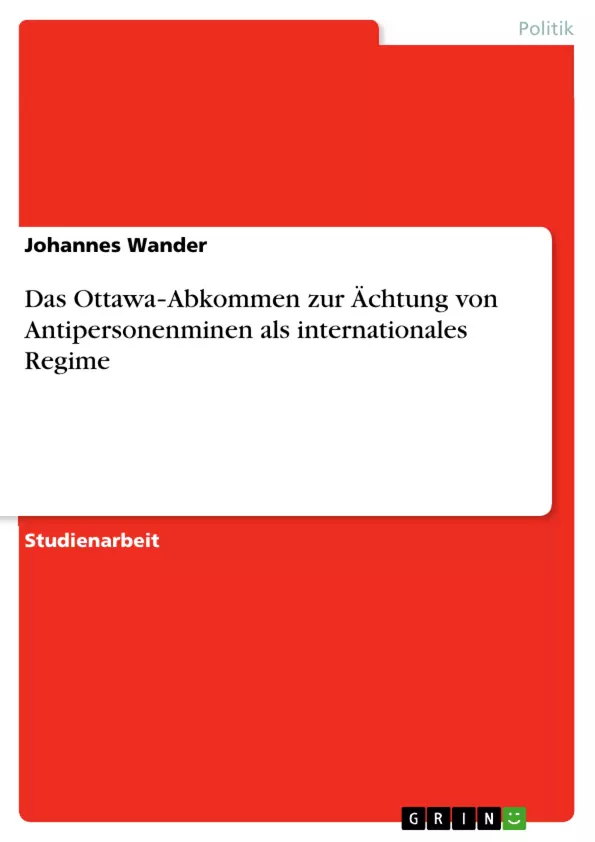Landminen unterscheiden nicht zwischen Freund und Feind, Zivilisten und Soldaten, Kindern und Erwachsenen. Eine Erkenntnis, die heute nicht nur von der Bundesregierung, der Bundeswehr und zahlreichen Non‐Governmental Organisations geteilt wird, sondern bereits vor 13 Jahren Anlass für die Schaffung einer internationalen Kooperation war.
Das „Übereinkommen vom 18. September 1997 über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung“, kurz auch „Ottawa‐Konvention“ genannt, gilt als ein Musterbeispiel für internationale Kooperation in der Abrüstungsfrage. Das theoretische Konstrukt zur Zusammenarbeit auf transnationaler Ebene in Form von internationalen Regimen soll zentrales Thema dieser Hausarbeit sein. Konkret sollen die Eigenschaften von internationalen Regimen am Beispiel der besagten Abrüstungskooperation aufgezeigt und erläutert werden.
Die Fragestellung, der diese Hausarbeit gerecht werden soll, lautet: Ist das Ottawa‐Abkommen ein internationales Regime und wenn ja, kann man es den spezifischeren Definitionen eines problemstrukturellen Regimeansatzes zugeordnet werden?
Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst die Regimetheorie erläutert, ideengeschichtlich verortet, ihre unterschiedlichen Ansätze erklärt und anschließend der spezielle problemstrukturell geprägte Ansatz der Tübinger Forschungsgruppe4 beleuchtet. Es folgt ein kurzer Überblick zum Ottawa‐Abkommen zur Ächtung von Landminen, genauer Antipersonenminen, kurz APM, auf dessen Grundlage abschließend die Einordnung des Abkommens als ein internationales Regime steht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Regime in den internationalen Beziehungen
- 2.1 Regime aus ideengeschichtlicher Perspektive
- 3. Ratifizierung und Implementierung
- 3.1 Ottawa-Konvention als internationales Regime
- 3.2 Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren
- 4. Problemstrukturelle Merkmale von Regimen
- 4.1 Einordnung des Ottawa-Regimes
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Ottawa-Abkommen zur Ächtung von Antipersonenminen als internationales Regime. Die zentrale Fragestellung ist, ob das Abkommen den Definitionen eines problemstrukturellen Regimeansatzes entspricht. Die Arbeit analysiert die Regimetheorie, ordnet sie ideengeschichtlich ein und beleuchtet den problemstrukturellen Ansatz der Tübinger Forschungsgruppe.
- Die Regimetheorie und ihre ideengeschichtlichen Wurzeln
- Der problemstrukturelle Ansatz der Tübinger Forschungsgruppe
- Das Ottawa-Abkommen und seine Eigenschaften als internationales Regime
- Die Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren des Ottawa-Abkommens
- Die Einordnung des Ottawa-Abkommens in den problemstrukturellen Regimeansatz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Einordnung des Ottawa-Abkommens als internationales Regime und seiner Zuordnung zu den Definitionen des problemstrukturellen Ansatzes. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und betont die Bedeutung der Landminenproblematik und die Rolle des Ottawa-Abkommens als Beispiel internationaler Kooperation in der Abrüstung.
2. Regime in den internationalen Beziehungen: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Definition von internationalen Regimen im Kontext der Interdependenztheorie. Es erläutert den umstrittenen, aber grundlegenden Begriff des internationalen Regimes, der sich aus Prinzipien, Normen, Regeln und Entscheidungsverfahren zusammensetzt. Die Definitionen verschiedener Autoren werden verglichen und die Kernkomponenten identifiziert. Die Interdependenztheorie und deren Bezug zur Regimetheorie werden eingehend diskutiert, um den theoretischen Rahmen zu etablieren.
2.1 Regime aus ideengeschichtlicher Perspektive: Dieses Kapitel ordnet die Regimetheorie ideengeschichtlich ein und verortet sie im Neoinstitutionalismus. Es betont die enge Verbindung zwischen der Regimetheorie und der Interdependenztheorie, insbesondere durch die Arbeit von Robert O. Keohane. Der Entstehungszusammenhang der Interdependenztheorie in den 1960er und 70er Jahren als Reaktion auf den Vietnamkrieg wird erläutert, und der Einfluss dieser Theorie auf die Entwicklung der Regimetheorie wird analysiert.
3. Ratifizierung und Implementierung: Dieses Kapitel behandelt die Ratifizierung und Implementierung der Ottawa-Konvention. Es wird die Bedeutung der politischen Willensbildung und der praktischen Umsetzung für den Erfolg des Abkommens behandelt. Die Herausforderungen bei der Umsetzung des Abkommens, die Zusammenarbeit der beteiligten Staaten und die Überwachung der Einhaltung der Regeln werden analysiert.
3.1 Ottawa-Konvention als internationales Regime: Dieses Kapitel untersucht detailliert die Ottawa-Konvention als internationales Regime. Die Einordnung der Konvention wird in Bezug auf die vorher etablierten theoretischen Rahmenbedingungen (Kapitel 2 und 2.1) vorgenommen. Die spezifischen Merkmale des Regimes im Kontext seiner Ziele und der beteiligten Akteure werden diskutiert, einschließlich der zentralen Prinzipien und Normen.
3.2 Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren: Dieses Kapitel untersucht die spezifischen Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren der Ottawa-Konvention. Es wird eine genaue Analyse der einzelnen Bestandteile des Regimes mit Bezug auf die allgemeine Definition von internationalen Regimen vorgenommen, um die Einhaltung der Definitionen zu überprüfen.
4. Problemstrukturelle Merkmale von Regimen: Dieses Kapitel beschreibt die problemstrukturellen Merkmale von Regimen und wie diese Merkmale im Ottawa-Abkommen zum Tragen kommen. Die Eigenschaften des Ottawa-Regimes werden im Kontext des problemstrukturellen Ansatzes der Tübinger Forschungsgruppe eingeordnet. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie das Abkommen die spezifischen Herausforderungen, die die Landminenproblematik darstellt, bewältigt.
4.1 Einordnung des Ottawa-Regimes: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und ordnet das Ottawa-Abkommen im Kontext der problemstrukturellen Merkmale von Regimen ein. Es beantwortet die Forschungsfrage nach der Einordnung des Abkommens in den theoretischen Rahmen, indem es die Übereinstimmung bzw. Abweichung von den Kriterien des problemstrukturellen Ansatzes aufzeigt.
Schlüsselwörter
Ottawa-Konvention, Antipersonenminen, internationales Regime, Regimetheorie, Interdependenztheorie, Neoinstitutionalismus, problemstruktureller Ansatz, Tübinger Forschungsgruppe, Abrüstung, internationale Kooperation.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Das Ottawa-Abkommen als internationales Regime
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Ottawa-Abkommen zur Ächtung von Antipersonenminen. Ihr zentraler Fokus liegt darauf, ob dieses Abkommen den Definitionen eines problemstrukturellen Regimeansatzes entspricht.
Welche Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Regimetheorie, ordnet sie ideengeschichtlich ein und beleuchtet den problemstrukturellen Ansatz der Tübinger Forschungsgruppe. Sie untersucht die Ratifizierung und Implementierung des Ottawa-Abkommens, analysiert dessen Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren und ordnet es schließlich in den problemstrukturellen Regimeansatz ein.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Regimetheorie, die Interdependenztheorie und den Neoinstitutionalismus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem problemstrukturellen Ansatz der Tübinger Forschungsgruppe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Regimen in den internationalen Beziehungen (inkl. ideengeschichtlicher Einordnung), Ratifizierung und Implementierung des Ottawa-Abkommens, den problemstrukturellen Merkmalen von Regimen (inkl. Einordnung des Ottawa-Abkommens) und ein Fazit. Ein Literaturverzeichnis rundet die Arbeit ab.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in diesen?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Regimen in den internationalen Beziehungen, der ideengeschichtlichen Perspektive von Regimen, Ratifizierung und Implementierung der Ottawa-Konvention, der Ottawa-Konvention als internationales Regime, den Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren des Abkommens, den problemstrukturellen Merkmalen von Regimen, der Einordnung des Ottawa-Regimes und einem Fazit, sowie einem Literaturverzeichnis.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind Ottawa-Konvention, Antipersonenminen, internationales Regime, Regimetheorie, Interdependenztheorie, Neoinstitutionalismus, problemstruktureller Ansatz, Tübinger Forschungsgruppe, Abrüstung, internationale Kooperation.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob das Ottawa-Abkommen den Definitionen eines problemstrukturellen Regimeansatzes entspricht.
Welche Bedeutung hat das Ottawa-Abkommen in dieser Arbeit?
Das Ottawa-Abkommen dient als Fallbeispiel zur Anwendung und Überprüfung der Regimetheorie und des problemstrukturellen Ansatzes. Es wird detailliert analysiert, um die theoretischen Konzepte zu illustrieren.
Was ist der problemstrukturelle Ansatz?
Der problemstrukturelle Ansatz (hier der Tübinger Forschungsgruppe) bietet einen analytischen Rahmen zur Untersuchung der Merkmale internationaler Regime und deren Fähigkeit, bestimmte Problemstrukturen zu bewältigen. Die Arbeit untersucht, ob das Ottawa-Abkommen diesem Ansatz entspricht.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt und dient der Analyse von Themen im Bereich der internationalen Beziehungen und der Regimetheorie.
- Arbeit zitieren
- Johannes Wander (Autor:in), 2010, Das Ottawa‐Abkommen zur Ächtung von Antipersonenminen als internationales Regime, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156024