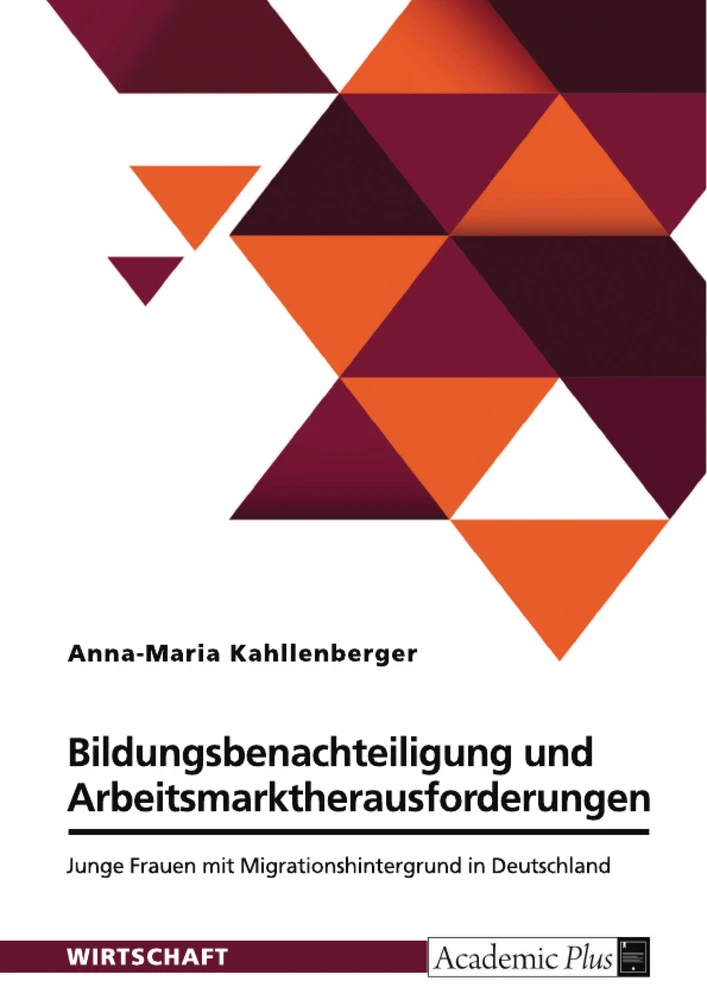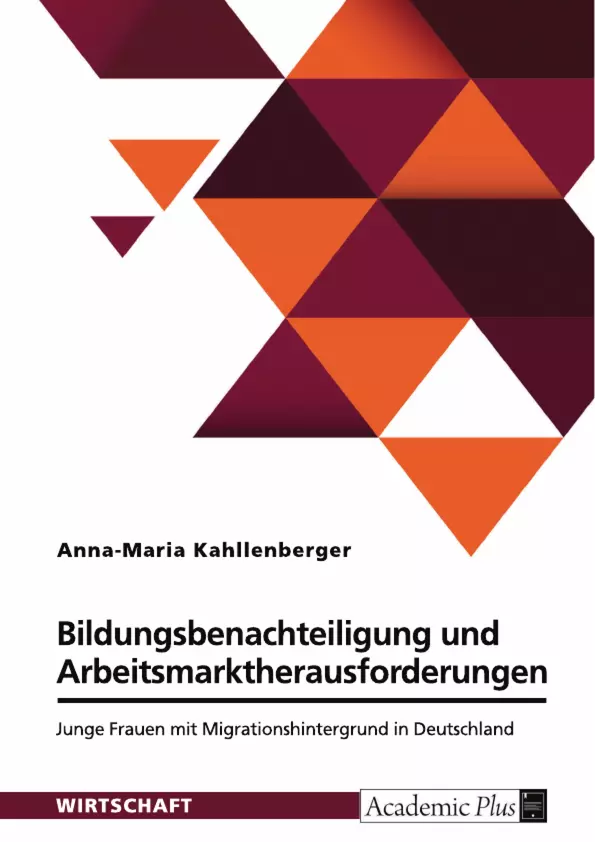Junge Frauen mit Migrationshintergrund haben im Gegensatz zu jungen Frauen ohne Migrationshintergrund eine geringere Chance auf einen Ausbildungsplatz und folglich auch auf ihre Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt. Dies widerspricht jedoch dem Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz, das in seiner Zielsetzung in §1 besagt, dass es das „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen“ (§1 AGG). Wie kann es sein, dass trotz dieses Gesetzes junge Frauen mit Migrationshintergrund also immer noch Benachteiligungen im Berufsleben erleiden? Wie können diese jungen Frauen in ihrer Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt werden? Die vorliegende Arbeit muss mit einer kritischen Betrachtung der gesellschaftlichen Wirklichkeit gelesen werden. Denn trotz vorgelegter rechtlicher Verankerungen gelten Diskriminierungen immer noch als alltäglich.
Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert: Der erste Teil ist der theoretische Part und der zweite Teil umfasst eine empirische Untersuchung des Forschungsgegenstandes mittels qualitativer Interviews. Die Theorie dieser Masterarbeit wird als notwendig für die empirische Untersuchung betrachtet und dient als Grundlage für deren Analyse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ausbildungssystem in Deutschland
- 2.1 Betriebliche Ausbildung
- 2.2 Schulische Ausbildung
- 2.3 Übergangssystem
- 2.3.1 Das Berufsvorbereitungsjahr
- 2.3.2 Kritik
- 2.4 SchülerInnen mit dem Förderbedarf Lernen
- 3. Arbeitsmarkt
- 4. Intersektionalität und soziale Ungleichheit
- 4.1 Intersektionalität
- 4.2 Kategorien und Dimensionen
- 4.3 Kapitalbegriffe nach Bourdieu
- 4.4 Soziale Ungleichheit
- 4.5 Strukturkategorien bildungsbenachteiligter, junger Frauen mit Migrationshintergrund auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
- 4.5.1 Kategorie der Herkunft
- 4.5.2 Kategorie des Geschlechts
- 4.5.3 Kategorie der Bildung
- 5. Unterstützungsmöglichkeiten
- 5.1 Resilienzförderung
- 5.2 Ressourcenorientierung
- 5.3 Frühstückstreffen für Frauen
- 5.4 Beurteilung der Maßnahmen
- 6. Empirischer Teil
- 6.1 Inhalte und Methode der Untersuchung
- 6.2 Vorbereitungsphase
- 6.2.1 Zugang zur Untersuchungsgruppe
- 6.2.2 Auswahl der Interviewpartnerinnen
- 6.2.3 Erhebungsmethode
- 6.3 Datenanalyse
- 6.4 Ergebnisse der Untersuchung
- 6.4.1 Benachteiligung aufgrund der Herkunft
- 6.4.2 Benachteiligung aufgrund des Geschlechts
- 6.4.3 Benachteiligung aufgrund der Bildung
- 6.4.4 Benachteiligung aufgrund der Herkunftsfamilie/Erziehung
- 6.4.5 Benachteiligung aufgrund von körperlichen Eigenschaften
- 6.4.6 Intersektionale Analyse der Ergebnisse
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Benachteiligung bildungsbenachteiligter junger Frauen mit Migrationshintergrund auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die Arbeit nutzt die Intersektionalitätstheorie, um die komplexen Wechselwirkungen verschiedener Benachteiligungsformen zu analysieren. Eine qualitative Studie mit ExpertInneninterviews liefert konkrete Einblicke in die Lebensrealitäten dieser Frauen.
- Benachteiligung junger Frauen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt
- Anwendung der Intersektionalitätstheorie zur Analyse von Benachteiligung
- Qualitative Untersuchung mittels ExpertInneninterviews
- Identifizierung intersektioneller Benachteiligungsformen
- Analyse von Unterstützungsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Benachteiligung von bildungsbenachteiligten jungen Frauen mit Migrationshintergrund auf dem deutschen Arbeitsmarkt ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie erläutert die Relevanz des Themas und die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf bearbeitet werden.
2. Ausbildungssystem in Deutschland: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das deutsche Ausbildungssystem, differenziert zwischen betrieblicher und schulischer Ausbildung und beleuchtet den Übergang in den Beruf. Es beschreibt das Berufsvorbereitungsjahr und kritische Aspekte des Systems, insbesondere für Schüler*innen mit Lernförderbedarf. Der Fokus liegt auf der Darstellung der strukturellen Hürden, denen junge Frauen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem begegnen können.
3. Arbeitsmarkt: Das Kapitel beschreibt den deutschen Arbeitsmarkt und seine Herausforderungen, insbesondere für benachteiligte Gruppen. Es beleuchtet allgemeine Trends und Strukturen, die die Chancen auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen. Dies bildet den Kontext für die spätere Analyse der spezifischen Herausforderungen für die untersuchte Gruppe.
4. Intersektionalität und soziale Ungleichheit: Dieses Kapitel erläutert das Konzept der Intersektionalität und seine Relevanz für die Analyse sozialer Ungleichheit. Es definiert zentrale Begriffe wie Kapitalformen nach Bourdieu und beschreibt verschiedene Dimensionen sozialer Ungleichheit. Im Fokus steht die Anwendung der Intersektionalitätstheorie auf die spezifischen Kategorien von Herkunft, Geschlecht und Bildung bei bildungsbenachteiligten jungen Frauen mit Migrationshintergrund.
5. Unterstützungsmöglichkeiten: Dieses Kapitel präsentiert und bewertet verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten für bildungsbenachteiligte junge Frauen mit Migrationshintergrund. Es analysiert Ansätze wie Resilienzförderung und Ressourcenorientierung und untersucht die Wirksamkeit solcher Maßnahmen. Konkrete Beispiele wie "Frühstückstreffen für Frauen" werden kritisch beleuchtet und ihre Effektivität im Kontext der Benachteiligung diskutiert.
Schlüsselwörter
Bildungsbenachteiligung, junge Frauen, Migrationshintergrund, Arbeitsmarkt, Intersektionalität, soziale Ungleichheit, qualitative Studie, ExpertInneninterviews, Resilienz, Ressourcenorientierung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Benachteiligung von bildungsbenachteiligten jungen Frauen mit Migrationshintergrund auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
Welche Theorie wird zur Analyse verwendet?
Die Intersektionalitätstheorie wird verwendet, um die komplexen Wechselwirkungen verschiedener Benachteiligungsformen zu analysieren.
Wie wird die Untersuchung durchgeführt?
Es wird eine qualitative Studie mit ExpertInneninterviews durchgeführt, um konkrete Einblicke in die Lebensrealitäten dieser Frauen zu gewinnen.
Welche Kategorien werden bei der Intersektionalitätsanalyse berücksichtigt?
Die Kategorien Herkunft, Geschlecht und Bildung werden bei der Analyse der Benachteiligung berücksichtigt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem das deutsche Ausbildungssystem, den Arbeitsmarkt, Intersektionalität und soziale Ungleichheit sowie Unterstützungsmöglichkeiten für die Zielgruppe.
Was wird im Kapitel "Ausbildungssystem in Deutschland" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das deutsche Ausbildungssystem, differenziert zwischen betrieblicher und schulischer Ausbildung und beleuchtet den Übergang in den Beruf. Es werden auch kritische Aspekte des Systems, insbesondere für Schüler*innen mit Lernförderbedarf, betrachtet.
Was wird im Kapitel "Arbeitsmarkt" beschrieben?
Das Kapitel beschreibt den deutschen Arbeitsmarkt und seine Herausforderungen, insbesondere für benachteiligte Gruppen. Es werden allgemeine Trends und Strukturen beleuchtet, die die Chancen auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen.
Was wird im Kapitel "Intersektionalität und soziale Ungleichheit" erklärt?
Dieses Kapitel erläutert das Konzept der Intersektionalität und seine Relevanz für die Analyse sozialer Ungleichheit. Es definiert zentrale Begriffe wie Kapitalformen nach Bourdieu und beschreibt verschiedene Dimensionen sozialer Ungleichheit.
Was wird im Kapitel "Unterstützungsmöglichkeiten" untersucht?
Dieses Kapitel präsentiert und bewertet verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten für bildungsbenachteiligte junge Frauen mit Migrationshintergrund. Es analysiert Ansätze wie Resilienzförderung und Ressourcenorientierung und untersucht die Wirksamkeit solcher Maßnahmen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Bildungsbenachteiligung, junge Frauen, Migrationshintergrund, Arbeitsmarkt, Intersektionalität, soziale Ungleichheit, qualitative Studie, ExpertInneninterviews, Resilienz, Ressourcenorientierung.
Was ist das Ziel der empirischen Studie?
Die empirische Studie zielt darauf ab, die Benachteiligung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Bildung, Herkunftsfamilie/Erziehung und körperlichen Eigenschaften zu untersuchen und eine intersektionale Analyse der Ergebnisse durchzuführen.
Welche Unterstützungsmöglichkeiten werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Unterstützungsmöglichkeiten wie Resilienzförderung, Ressourcenorientierung und "Frühstückstreffen für Frauen" und beurteilt deren Wirksamkeit.
- Citation du texte
- Anna-Maria Kahllenberger (Auteur), 2023, Bildungsbenachteiligung und Arbeitsmarktherausforderungen. Junge Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1561499