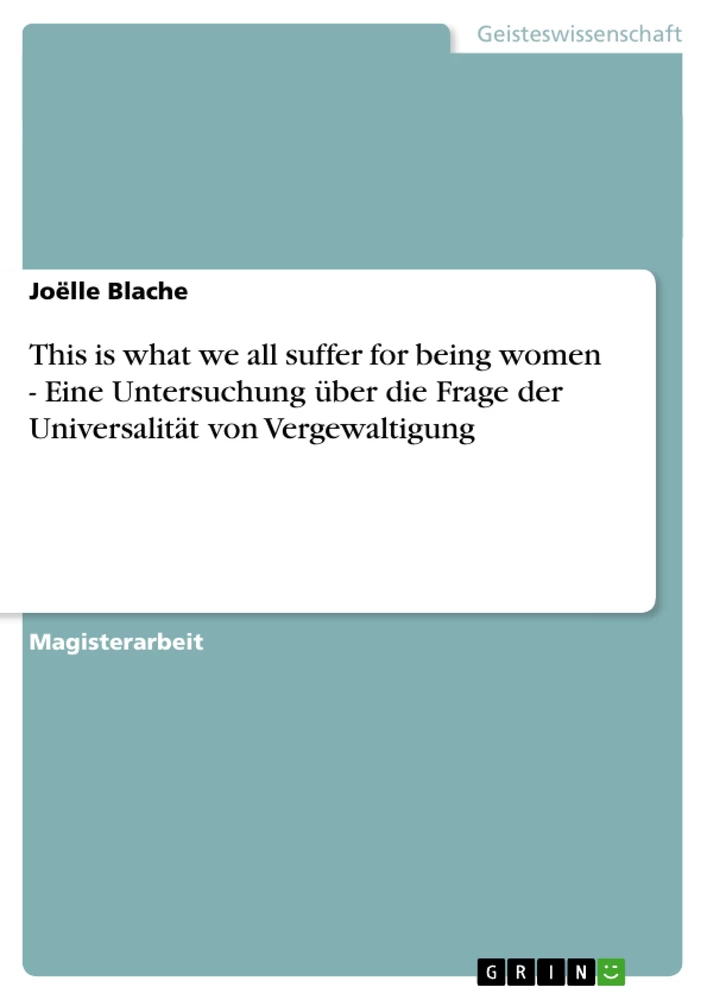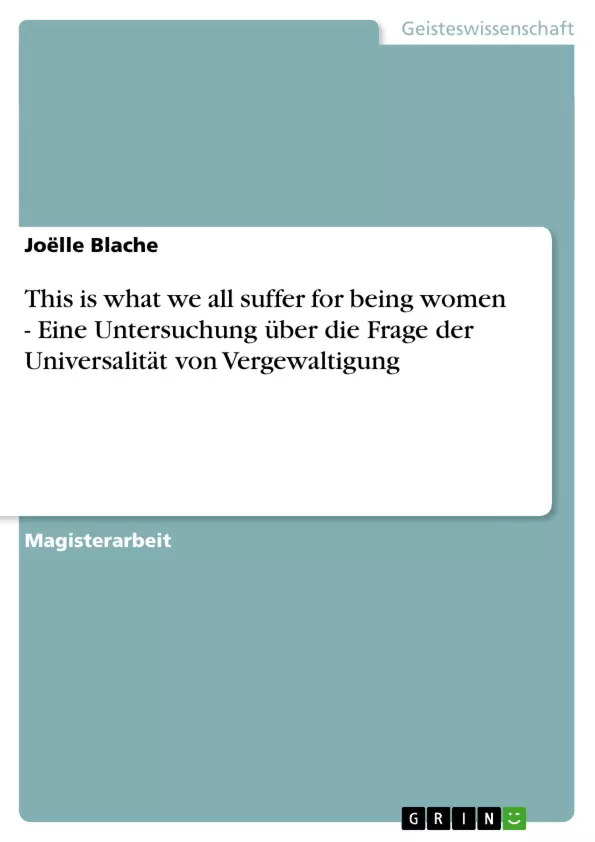„This is what we all suffer for being women“ sagten äthiopische Frauen um die Ethnologin zu
trösten. Sie war gerade von ihrem Informanten vergewaltigt worden. „As long as we are
women we are at the mercy of men. There was no need for me to feel ashamed or unhappy.
What had happened to me was horrible and dreadful, but, unfortunately, normal“ (Moreno
1995: 243).
Muß es so sein? Müssen Frauen wirklich immer auf diese Weise leiden? Hat die Natur es so
gewollt? Eva Moreno gibt Ansätze um ihre Vergewaltigung zu erklären. Ihr Informant hatte ihr
immer wieder gezeigt, wie abhängig sie von ihm war. Für sie geht es dabei um
Geschlechterrollen und um Macht: „Rape in any form is about power and male domination“
(Moreno 1995: 236).
Während es weltweit Programme gibt, um die Benachteiligung von Frauen zu verringern und
auch speziell die Gewalt gegenüber Frauen zu eliminieren, stellt sich die Frage nach deren
Erfolgsmöglichkeiten. Kann gegen die Vergewaltigung, als eine Form der Gewalt gegen
Frauen, etwas unternommen werden? Den soziobiologischen Theorien zufolge, liegt
Vergewaltigung als eine Reproduktionsstrategie, in der männlichen Natur. In ihrer Logik
könnten nur repressive Gesetze etwas ändern.1 Geht man jedoch von soziokulturellen Theorien
aus, sind gesellschaftliche Strukturen und gesellschaftliches Handeln für Vergewaltigung
verantwortlich und nicht unser Schicksal. Um Veränderungen zu ermöglichen, müßten die
Ursachen und Strukturen erkannt werden. Der erste Schritt zu diesen Fragen ist festzustellen,
ob Vergewaltigung eine Universalie ist. Es gibt einige Ethnographien, die vermuten lassen, daß
Vergewaltigung nicht universell ist. Wenn das so ist, was zeichnet diese Gesellschaften aus?
Welche Strukturen kann man bei ihnen erkennen, die dazu beitragen, daß es keine
Vergewaltigung gibt? Bevor die Eigenschaften, die mit Vergewaltigung korrelieren, weiter untersucht werden
können, wäre an dieser Stelle eine Definition von Vergewaltigung angebracht. Vergewaltigung
hier zu definieren, halte ich für eine heikle Aufgabe. Nicht etwa aus Prüderie. Nein. Aber wer
kann Vergewaltigung definieren? Mit welcher Autorität? [...]
1 So auch die Meinung von William und Lea Shields: „We predict, on the basis of these evolutionary
models, that punishing rape surely and severely might be the most effective in minimizing the frequency of
rape.“ (Shields und Shields 1983: 132). Durch die Bestrafung würden die Kosten steigen und der Nutzen
vermindert werden (siehe Seite 8).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Bisherige Theorien
- Vergewaltigung als Reproduktionsstrategie: Die soziobiologische Sicht
- Die männliche Herrschaft und die Wirtschaft: Soziokulturelle Ansätze
- Sandays Ansatz
- Schwendinger und Schwendingers Ansatz
- Fazit
- Entwurf einer These
- „Die Ideologie der männlichen Herrschaft“
- Machtverhältnisse
- Geschlechterkonstruktionen und Wertesysteme
- Gewalt
- Gewalt: Natur oder Kultur?
- Wissenschaftliche Diskurse über die Gewalt
- Gewaltlose Gesellschaften
- Alternativen
- Gewalt gegen Frauen
- Gewalt: Natur oder Kultur?
- Sexualität: Von der Konstruktion des Begehrens
- Weiterführende Überlegungen zum Thema Vergewaltigung
- „Die Ideologie der männlichen Herrschaft“
- Ethnographische Fallbeispiele
- Eine vergewaltigungsfreie Gesellschaft: Die Chewong
- Eine isolierte Gesellschaft
- Der Mensch in seiner Umwelt
- Menschliche Beziehungen
- Iatmul
- Allgemeine Informationen
- Die Organisation der Macht
- Organisation der Haushalte
- Liebe, Sexualität und Ehe
- Konfliktregelung
- Vergewaltigung
- Eine vergewaltigungsfreie Gesellschaft: Die Chewong
- Auswertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage der Universalität von Vergewaltigung, ausgehend von der Annahme, dass diese Form der Gewalt nicht universell ist. Die Autorin untersucht verschiedene Theorien und Ansätze, die sich mit der Erklärung von Vergewaltigung auseinandersetzen, und stellt die These auf, dass Vergewaltigung durch gesellschaftliche Strukturen und Machtverhältnisse beeinflusst wird.
- Die soziobiologische Perspektive auf Vergewaltigung als Reproduktionsstrategie
- Soziokulturelle Ansätze zur Erklärung von Vergewaltigung
- Die Rolle der männlichen Herrschaft und der Geschlechterkonstruktionen
- Die Frage der Gewalt als Natur oder Kultur
- Ethnographische Fallbeispiele von Gesellschaften mit und ohne Vergewaltigung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Ist Vergewaltigung eine Universalie? Im zweiten Kapitel werden verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung von Vergewaltigung beleuchtet, darunter die soziobiologische Perspektive und verschiedene soziokulturelle Ansätze. Das dritte Kapitel entwickelt eine These, die die Ideologie der männlichen Herrschaft als Grundlage für Vergewaltigung identifiziert und sich mit den Themen Machtverhältnisse, Geschlechterkonstruktionen und Gewalt auseinandersetzt. Die Kapitel 5 und 6 präsentieren ethnographische Fallbeispiele von Gesellschaften, die unterschiedliche Formen von Gewalt und Sexualität aufweisen. Die Analyse dieser Fallbeispiele soll Aufschluss darüber geben, welche sozialen Strukturen und Normen die Häufigkeit von Vergewaltigung beeinflussen.
Schlüsselwörter
Vergewaltigung, Universalität, soziobiologische Theorie, soziokulturelle Ansätze, männliche Herrschaft, Geschlechterkonstruktionen, Machtverhältnisse, Gewalt, Sexualität, Ethnographie, Chewong, Iatmul.
Ist Vergewaltigung eine menschliche Universalie?
Die Arbeit untersucht, ob Vergewaltigung in allen Kulturen vorkommt oder ob es Gesellschaften gibt, in denen diese Form der Gewalt nicht existiert.
Was besagt die soziobiologische Sichtweise?
Soziobiologische Theorien interpretieren Vergewaltigung als eine in der männlichen Natur liegende Reproduktionsstrategie.
Welche Rolle spielt die „männliche Herrschaft“?
Soziokulturelle Ansätze argumentieren, dass Vergewaltigung ein Ausdruck von Machtverhältnissen und männlicher Dominanz in gesellschaftlichen Strukturen ist.
Gibt es vergewaltigungsfreie Gesellschaften?
Die Arbeit nennt ethnographische Beispiele wie die Chewong, bei denen Strukturen und Normen existieren, die Gewalt gegen Frauen verhindern.
Wie kann Gewalt gegen Frauen reduziert werden?
Wenn Vergewaltigung soziokulturell bedingt ist, müssen die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturen und Geschlechterkonstruktionen verändert werden.