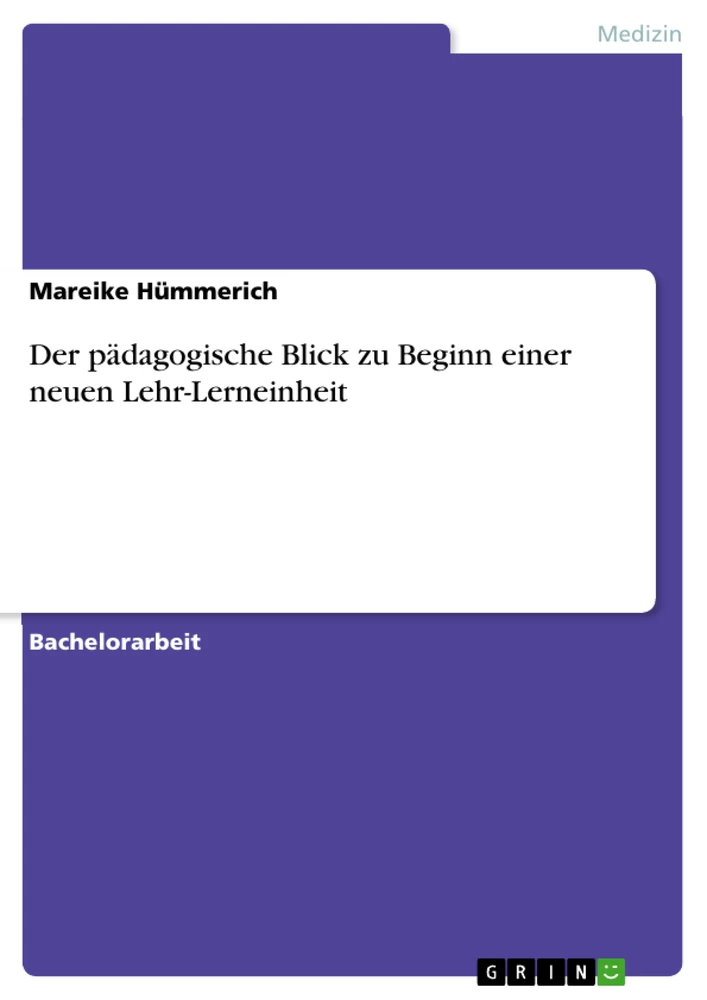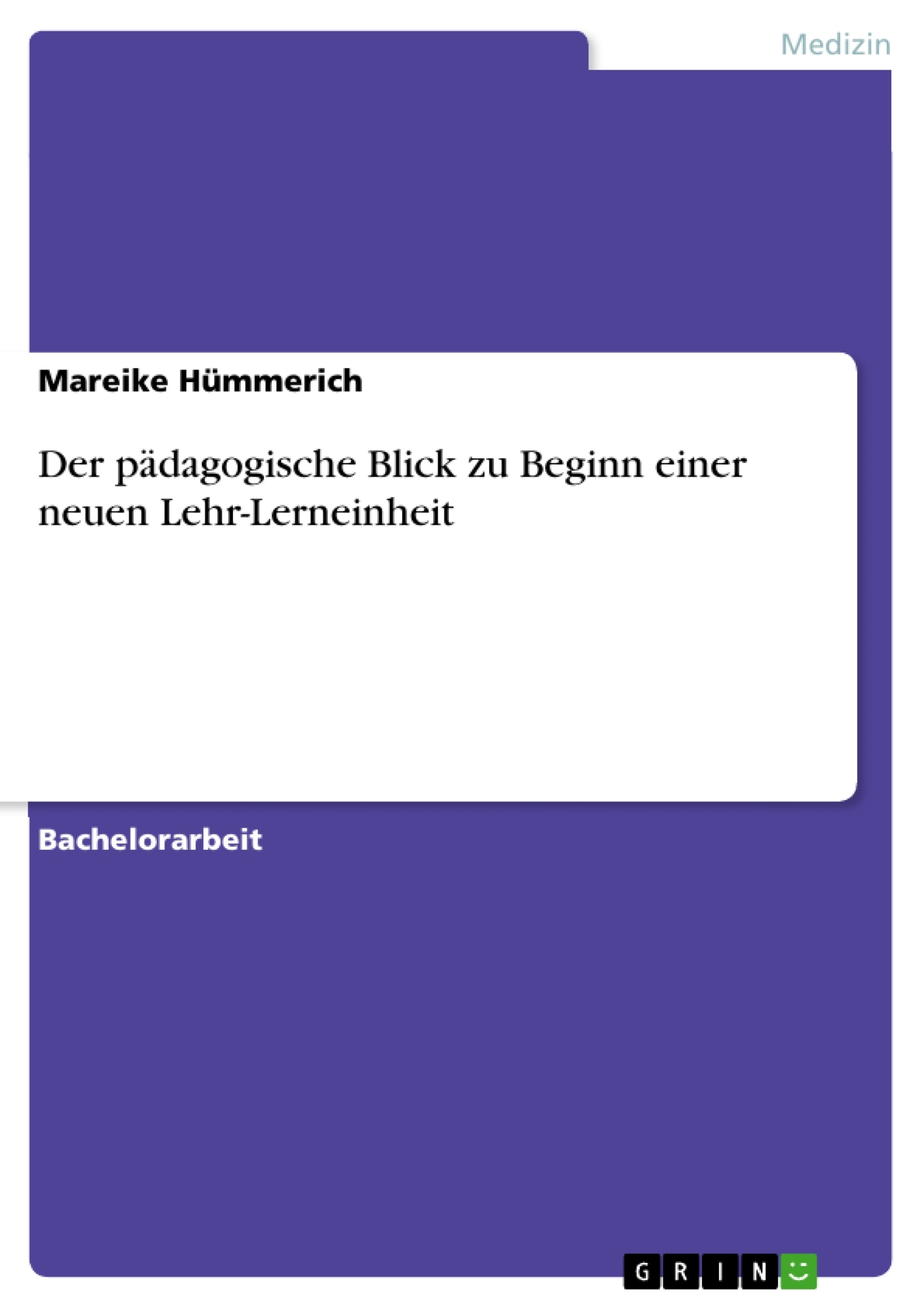„So, heute beginnen wir mit dem Thema Rechtskunde in der
Krankenpflege“ lautete der erste Satz eines Lehrenden zu Beginn
der neuen Lerneinheit. Die Lernenden sitzen da, und für den ein oder
anderen ist nach dieser Ankündigung, die im manchen Ohren schon fast
als Drohung anklingt, die Stunde, der Tag oder sogar das ganze Thema
gelaufen. Lehrer und Teilnehmer quälen sich durch den Stoff, finden nicht so recht zusammen, sind gelangweilt und Störungen treten auf.
Alle Unterrichtsinhalte der Ausbildung in der Gesundheits- und
Krankenpflege sind nach den gesetzlichen Richtlinien vorgegeben. Sie
bilden die Grundlage für professionelles Pflegehandeln.
Die vorliegende Arbeit beschreibt, anhand welcher Orientierungspunkte
der Lehrende den Einstieg in eine neue Lehr- Lerneinheit plant. Darin wird der Begriff ‚pädagogischer Blick’ erörtert und es werden generelle Lernvorgänge und -voraussetzungen dargestellt. Welche Rolle die pädagogische Diagnostik dabei spielt, um diese
Unterrichtssituation zu erfassen, wird weiterhin ausgeführt. Eine Auswahl von Handlungsmöglichkeiten soll Alternativen anregen, um
den Lehrenden und Lernenden einen einschläfernden Einstieg in ein
neues Thema zu ersparen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 DER PÄDAGOGISCHE BLICK AUF DIE EINSTIEGSSITUATION EINER NEUEN LEHR-LERNEINHEIT
- 1.1 Der pädagogische Blick
- 1.2 Grundvoraussetzungen von Lernen
- 1.2.1 Verarbeitungsprozesse
- 1.2.2 Aufmerksamkeit
- 1.2.3 Bedeutungsvolles Lernen
- 1.2.4 Motivation
- 1.3 Zusammenfassung der verschiedenen Lernprozesse
- 2 EXPLORATION DER UNTERRICHTSSITUATION
- 2.1 Arbeitsschritte und Verfahren des Diagnostizierens
- 2.2 Erfassung der Einstiegssituation
- 3 GESTALTUNG VON EINSTIEGSSITUATIONEN
- 3.1 Kriterien eines guten Unterrichtseinstiegs
- 3.2 Elaboration der Unterrichtsinhalte
- 3.3 Einsichtiges Lernen fördern – der szenische Einstieg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Gestaltung des Unterrichtseinstiegs in neuen Lehr-Lerneinheiten im Kontext der Pflegewissenschaft. Ziel ist es, Orientierungspunkte für Lehrende aufzuzeigen, um einen motivierenden und effektiven Beginn zu gewährleisten und uninspirierende Starts zu vermeiden. Die Arbeit analysiert den "pädagogischen Blick" des Lehrenden und die Bedeutung von Lernprozessen und -voraussetzungen.
- Der pädagogische Blick des Lehrenden
- Grundvoraussetzungen erfolgreichen Lernens
- Pädagogische Diagnostik zur Erfassung der Unterrichtssituation
- Gestaltung von motivierenden Unterrichtseinstiegen
- Kriterien für einen guten Unterrichtseinstieg
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt ein häufiges Problem: unmotivierende Unterrichtseinstiege in der Krankenpflege. Sie betont die Bedeutung professionellen Pflegehandelns, das auf wissenschaftlichen Grundlagen basiert, und führt in das Thema der Arbeit ein. Der Fokus liegt auf der Planung des Unterrichtseinstiegs aus der Perspektive des Lehrenden und der Nutzung pädagogischer Diagnostik zur Erfassung der Lernsituation.
1 DER PÄDAGOGISCHE BLICK AUF DIE EINSTIEGSSITUATION EINER NEUEN LEHR-LERNEINHEIT: Dieses Kapitel erörtert den "pädagogischen Blick" als zentrale Orientierung für Lehrende beim Planen des Unterrichtseinstiegs. Es werden grundlegende Lernprozesse und -voraussetzungen wie Verarbeitungsprozesse, Aufmerksamkeit, bedeutungvolles Lernen und Motivation detailliert beschrieben. Die Zusammenfassung der verschiedenen Lernprozesse am Ende des Kapitels bildet eine Brücke zu den folgenden Kapiteln, die sich mit der Diagnostik und der Gestaltung des Unterrichtseinstiegs befassen.
2 EXPLORATION DER UNTERRICHTSSITUATION: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Erfassung der Einstiegssituation durch pädagogische Diagnostik. Es werden verschiedene Arbeitsschritte und Verfahren des Diagnostizierens erläutert, die dem Lehrenden helfen, die Bedürfnisse und das Vorwissen der Lernenden zu verstehen und die Lernumgebung optimal zu gestalten. Die genaue Erfassung der Ausgangslage dient als Grundlage für die Entwicklung geeigneter Unterrichtseinstiege.
3 GESTALTUNG VON EINSTIEGSSITUATIONEN: Das Kapitel behandelt die konkrete Gestaltung von Unterrichtseinstiegen. Es werden Kriterien für einen guten Einstieg definiert und Möglichkeiten der Elaboration der Unterrichtsinhalte vorgestellt. Besonders wird der "szenische Einstieg" als Methode zur Förderung einsichtigen Lernens hervorgehoben und detailliert beschrieben. Der Fokus liegt darauf, Lernende aktiv in den Prozess einzubeziehen und ihre Motivation zu steigern.
Schlüsselwörter
Pädagogischer Blick, Unterrichtseinstieg, Lehr-Lerneinheit, Lernprozesse, Lernvoraussetzungen, Pädagogische Diagnostik, Motivation, Bedeutungvolles Lernen, Unterrichtsgestaltung, Pflegewissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Gestaltung von Unterrichtseinstiegen in der Pflegewissenschaft
Was ist das zentrale Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Gestaltung von motivierenden und effektiven Unterrichtseinstiegen in neuen Lehr-Lerneinheiten im Kontext der Pflegewissenschaft. Der Fokus liegt auf der Planung des Einstiegs aus der Perspektive des Lehrenden und der Nutzung pädagogischer Diagnostik zur Erfassung der Lernsituation.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den "pädagogischen Blick" des Lehrenden, die Bedeutung von Lernprozessen und -voraussetzungen (Verarbeitungsprozesse, Aufmerksamkeit, bedeutungvolles Lernen, Motivation), pädagogische Diagnostik zur Erfassung der Unterrichtssituation, und die Gestaltung motivierender Unterrichtseinstiege inklusive Kriterien für einen guten Einstieg. Ein besonderer Fokus liegt auf dem "szenischen Einstieg" als Methode zur Förderung einsichtigen Lernens.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte Lehrenden Orientierungspunkte für die Gestaltung von Unterrichtseinstiegen aufzeigen, um uninspirierende Starts zu vermeiden und einen motivierenden und effektiven Beginn von Lehr-Lerneinheiten zu gewährleisten. Sie will dazu beitragen, das Verständnis für die Bedeutung einer sorgfältigen Planung des Unterrichtseinstiegs zu verbessern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel 1 befasst sich mit dem pädagogischen Blick und Lernprozessen. Kapitel 2 behandelt die Exploration der Unterrichtssituation mittels pädagogischer Diagnostik. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Gestaltung von Unterrichtseinstiegen, insbesondere den szenischen Einstieg. Die Arbeit enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methode. Sie beschreibt den "pädagogischen Blick", verschiedene Lernprozesse und -voraussetzungen sowie Methoden der pädagogischen Diagnostik. Sie analysiert Kriterien für einen guten Unterrichtseinstieg und stellt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten vor, insbesondere den szenischen Einstieg.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Pädagogischer Blick, Unterrichtseinstieg, Lehr-Lerneinheit, Lernprozesse, Lernvoraussetzungen, Pädagogische Diagnostik, Motivation, Bedeutungvolles Lernen, Unterrichtsgestaltung, Pflegewissenschaft.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende in der Pflegewissenschaft, Ausbilder und alle, die sich mit der Gestaltung von Unterricht und der Förderung von Lernprozessen in der Pflege auseinandersetzen. Sie bietet praktische Hilfestellungen für die Planung und Durchführung von Unterrichtseinheiten.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit beschreibt den "szenischen Einstieg" als konkrete Methode zur Gestaltung eines motivierenden und effektiven Unterrichtseinstiegs. Weitere konkrete Beispiele sind im Text enthalten, jedoch nicht explizit als solche benannt. Die Arbeit fokussiert auf die Prinzipien und Konzepte.
- Arbeit zitieren
- Mareike Hümmerich (Autor:in), 2008, Der pädagogische Blick zu Beginn einer neuen Lehr-Lerneinheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156318