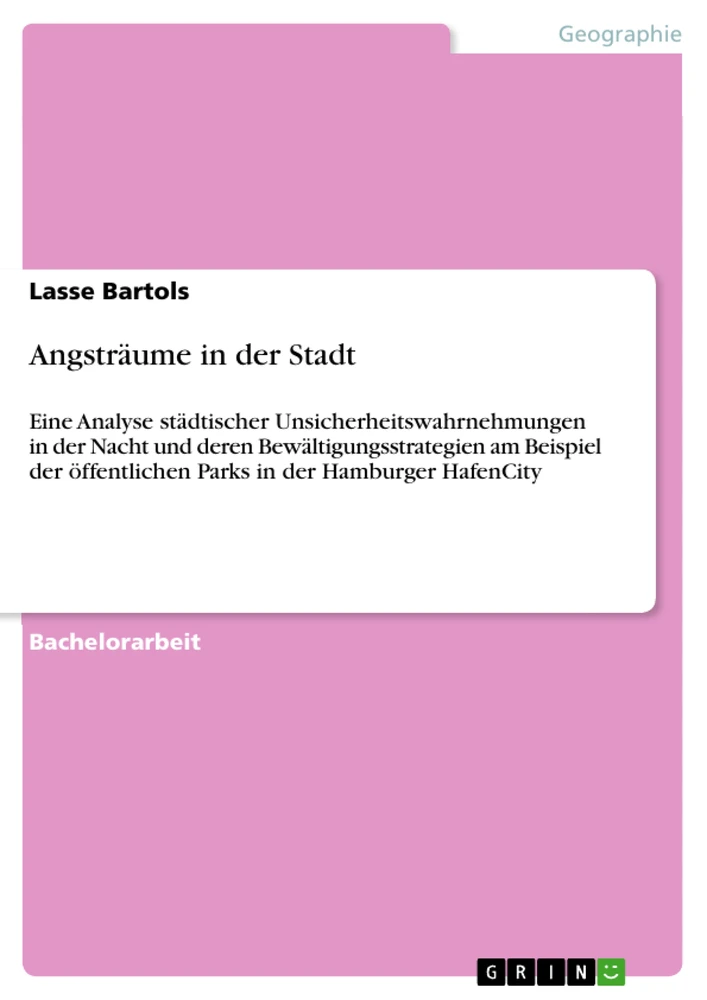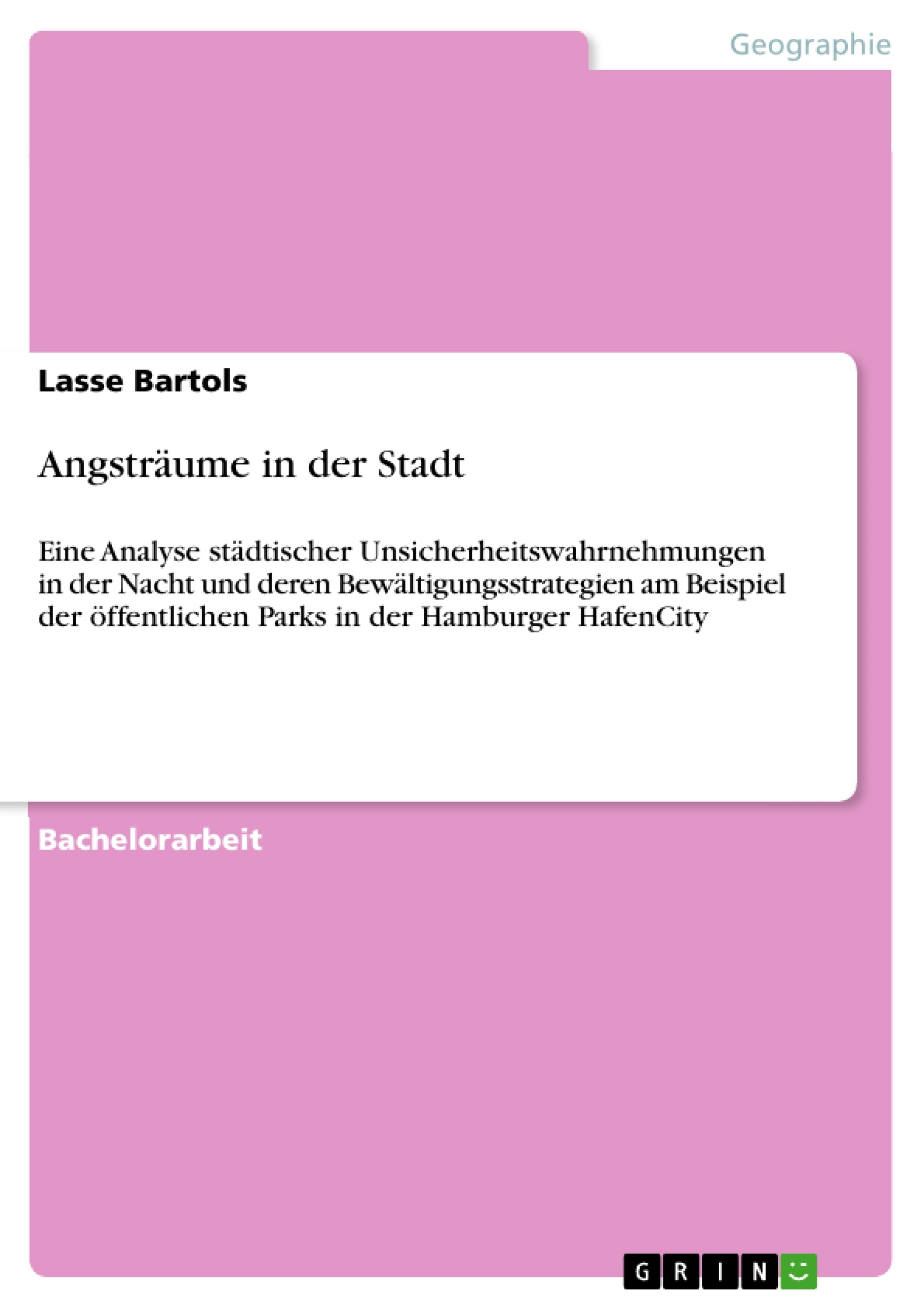Nachts verändern sich Städte – bekannte Orte wirken plötzlich fremd, manche Straßen oder Parks werden gemieden. Doch was genau macht einen städtischen Raum zum Angstraum? Welche Faktoren beeinflussen, ob sich Menschen sicher oder unsicher fühlen? Diese Arbeit untersucht das Thema anhand der Parks in der Hamburger HafenCity und zeigt, wie Stadtplanung, Beleuchtung und soziale Kontrolle die Wahrnehmung von Sicherheit beeinflussen.
Neben theoretischen Grundlagen werden auch reale Beobachtungen und Expertenmeinungen einbezogen, um ein umfassendes Bild zu zeichnen. Besonders spannend ist dabei der Blick auf geschlechtsspezifische Unterschiede und die Frage, warum einige Gruppen sich in öffentlichen Räumen unwohler fühlen als andere.
Die Untersuchung bietet keine einfachen Antworten, sondern regt dazu an, Stadtentwicklung neu zu denken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz des Themas
- Zielsetzung und Fragestellung
- Forschungsfeld
- Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Methodik
- Die Bedeutung von Angsträumen im urbanen Kontext
- Historischer und gesellschaftlicher Kontext von Angsträumen
- Geschlechtsspezifische Perspektiven auf urbane Unsicherheiten
- Die Rolle von sozialer Kontrolle und Raumgestaltung
- Analyse der Angsträume in der Hamburger HafenCity
- Die Parks in der HafenCity
- Lohsepark
- Sandtorpark
- Grasbrookpark
- Baakenpark
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die Entstehung und Wahrnehmung von Angsträumen in den öffentlichen Parks der Hamburger HafenCity, insbesondere nachts. Die Arbeit untersucht die Faktoren, die zu Unsicherheitsgefühlen führen, und wie verschiedene Bevölkerungsgruppen mit diesen Räumen umgehen. Ziel ist ein besseres Verständnis des komplexen Zusammenspiels von räumlicher Gestaltung und psychologischen Effekten.
- Die Entstehung und Wahrnehmung von Angsträumen in städtischen Parks
- Der Einfluss sozialer, physischer und geschlechtsspezifischer Faktoren auf die Wahrnehmung von Unsicherheit
- Bewältigungsstrategien von Stadtbewohnern in Bezug auf Angsträume
- Die Rolle der Raumgestaltung und sozialer Kontrolle bei der Entstehung von Angsträumen
- Die HafenCity als spezifisches Beispiel für die Entstehung und Wahrnehmung von Angsträumen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Angsträume in der Stadt ein und beleuchtet deren Relevanz in zunehmend verdichteten urbanen Räumen. Sie formuliert die Forschungsfragen und die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Entstehung und Wahrnehmung von Angsträumen in den Parks der Hamburger HafenCity zu analysieren und zu verstehen, wie diese Räume sicherer und inklusiver gestaltet werden können. Die Arbeit fokussiert sich auf die HafenCity aufgrund ihres Status als neues Stadtentwicklungsprojekt und die leichte Zugänglichkeit der Parks als Forschungsfeld.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse von Angsträumen dar. Es werden verschiedene Theorien und Konzepte herangezogen, wie beispielsweise die Theorien von Henri Lefebvre zur Produktion des Raumes, Leslie Kerns "Feminist City", die Broken-Windows-Theorie von Wilson und Kelling, sowie die Konzepte des räumlichen Affekts von Nigel Thrift und Ben Anderson und Doreen Masseys Raum als Prozess. Diese liefern ein breites Spektrum an Perspektiven, um die Entstehung und Wahrnehmung von Angsträumen im urbanen Kontext zu verstehen. Die Kapitel werden verwendet, um ein umfassendes Verständnis der relevanten Theorien und ihrer Anwendbarkeit auf das Forschungsthema zu schaffen.
Methodik: Das Kapitel beschreibt die gewählte Methodik der Arbeit, welche qualitative Experteninterviews und teilnehmende Beobachtung umfasst. Es wird detailliert erläutert, wie diese Methoden eingesetzt wurden, um Daten zu sammeln und die Forschungsfragen zu beantworten. Der Fokus liegt auf der Erhebung von subjektiven Erfahrungen und Perspektiven, um ein umfassendes Bild der Wahrnehmung von Angsträumen in der HafenCity zu erhalten. Die Methodenbeschreibung dient der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Forschung.
Die Bedeutung von Angsträumen im urbanen Kontext: Dieses Kapitel untersucht den historischen und gesellschaftlichen Kontext von Angsträumen, beleuchtet geschlechtsspezifische Perspektiven auf urbane Unsicherheiten und die Rolle von sozialer Kontrolle und Raumgestaltung. Es vertieft das Verständnis für die komplexen sozialen, kulturellen und räumlichen Faktoren, die zur Entstehung und Wahrnehmung von Angsträumen beitragen. Der umfassende Ansatz ermöglicht eine differenzierte Analyse der Thematik.
Analyse der Angsträume in der Hamburger HafenCity: Dieser Abschnitt analysiert die ausgewählten Parks in der HafenCity (Lohsepark, Sandtorpark, Baakenpark, Grasbrookpark) als potenzielle Angsträume. Die Analyse berücksichtigt die räumlichen Gegebenheiten, die Beleuchtung, die soziale Kontrolle und die Nutzung der Parks, um die Wahrnehmung von Sicherheit und Unsicherheit zu verstehen. Es wird untersucht, wie die spezifischen Merkmale der Parks zur Entstehung von Angsträumen beitragen.
Schlüsselwörter
Angsträume, urbane Unsicherheitswahrnehmungen, HafenCity, öffentliche Parks, qualitative Forschung, Experteninterviews, teilnehmende Beobachtung, Raumgestaltung, soziale Kontrolle, Geschlecht, Sicherheit, subjektive Erfahrung, Stadtplanung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Bachelorarbeit über Angsträume?
Die Bachelorarbeit analysiert die Entstehung und Wahrnehmung von Angsträumen in den öffentlichen Parks der Hamburger HafenCity, insbesondere nachts. Sie untersucht, welche Faktoren zu Unsicherheitsgefühlen führen und wie verschiedene Bevölkerungsgruppen mit diesen Räumen umgehen. Ziel ist ein besseres Verständnis des Zusammenspiels von räumlicher Gestaltung und psychologischen Effekten.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Themenschwerpunkte:
- Die Entstehung und Wahrnehmung von Angsträumen in städtischen Parks
- Der Einfluss sozialer, physischer und geschlechtsspezifischer Faktoren auf die Wahrnehmung von Unsicherheit
- Bewältigungsstrategien von Stadtbewohnern in Bezug auf Angsträume
- Die Rolle der Raumgestaltung und sozialer Kontrolle bei der Entstehung von Angsträumen
- Die HafenCity als spezifisches Beispiel für die Entstehung und Wahrnehmung von Angsträumen
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit greift auf verschiedene Theorien und Konzepte zurück, darunter:
- Die Theorien von Henri Lefebvre zur Produktion des Raumes
- Leslie Kerns "Feminist City"
- Die Broken-Windows-Theorie von Wilson und Kelling
- Die Konzepte des räumlichen Affekts von Nigel Thrift und Ben Anderson
- Doreen Masseys Raum als Prozess
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Methodik, die Experteninterviews und teilnehmende Beobachtung umfasst. Diese Methoden dienen dazu, subjektive Erfahrungen und Perspektiven zu erheben und ein umfassendes Bild der Wahrnehmung von Angsträumen in der HafenCity zu erhalten.
Welche Parks in der HafenCity werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf folgende Parks:
- Lohsepark
- Sandtorpark
- Grasbrookpark
- Baakenpark
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Angsträume, urbane Unsicherheitswahrnehmungen, HafenCity, öffentliche Parks, qualitative Forschung, Experteninterviews, teilnehmende Beobachtung, Raumgestaltung, soziale Kontrolle, Geschlecht, Sicherheit, subjektive Erfahrung, Stadtplanung.
Warum wurde die HafenCity als Untersuchungsgebiet gewählt?
Die HafenCity wurde aufgrund ihres Status als neues Stadtentwicklungsprojekt und die leichte Zugänglichkeit der Parks als Forschungsfeld ausgewählt.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist, die Entstehung und Wahrnehmung von Angsträumen in den Parks der Hamburger HafenCity zu analysieren und zu verstehen, wie diese Räume sicherer und inklusiver gestaltet werden können.
- Quote paper
- Lasse Bartols (Author), 2024, Angsträume in der Stadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1563351