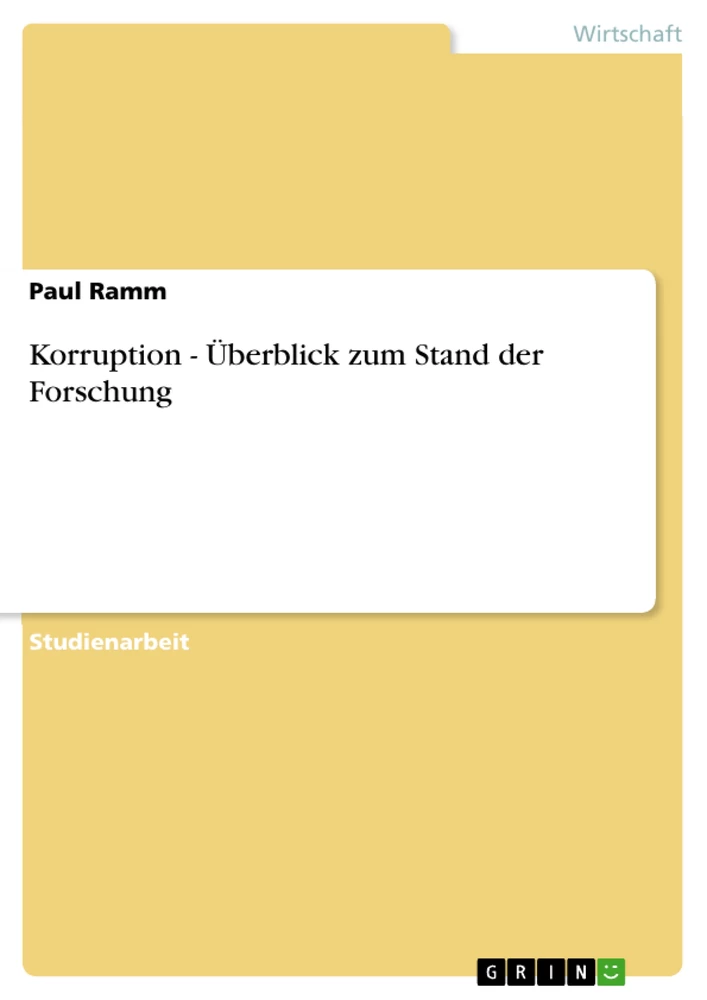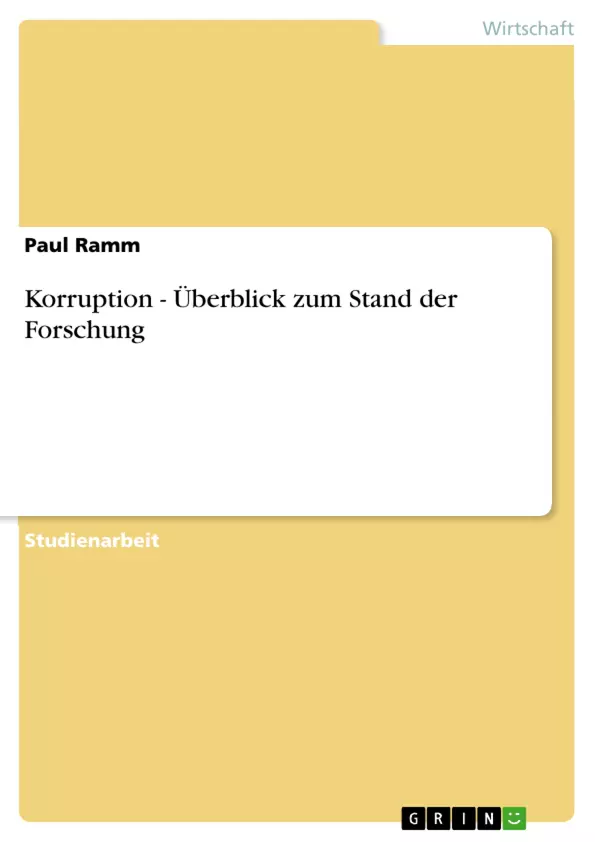So alt und so abwechslungsreich wie die Menschheit ist auch die Korruption. Nicht nur in der Tagespresse ist dieses Thema kaum mehr wegzudenken. Fälle wie der Schmiergeldskandal bei Siemens oder das allgemein hohe Korruptionsniveau in Verwaltung, Politik und Wirtschaft des sich aktuell in Finanznöten befindlichen EU-Staates Griechenland werden umfangreich diskutiert. Das Ausmaß der Korruption scheint allerdings von Land zu Land bzw. von Kultur zu Kultur zu differenzieren. So weisen bspw. Entwicklungsländer tendenziell eine höhere Korruptionsrate auf als Industrienationen (Vgl. Transparency International 2010a). Zu hinterfragen ist allerdings, welche Faktoren dafür ursächlich sind. Des Weiteren wird Korruption unterschiedlich empfunden. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein Wahrnehmungsphänomen ist (Vgl. von Alemann 2005, S. 14, 23 und Moroff 2005): Entscheidend ist insofern, was eigentlich als Korruption aufgefasst wird und was eben nicht, und nicht nur, wie viel von dem tatsächlich korrupten Verhalten aufgedeckt und wahrgenommen wird.
Zu hinterfragen bleibt außerdem, wie es eigentlich zu korruptem Verhalten kommen kann und welche gesamtwirtschaftlichen Effekte diese Art des „abweichenden Verhaltens“ haben können. Welchen Erklärungsbeitrag vermag die Korruptionsforschung dazu zu liefern? Ist es der Forschung überhaupt möglich, dieser Verhaltensweise auf den Grund zu gehen? Denn nur wenn die Entstehungsursachen bekannt sind, ist auch eine effektive Korruptionsbekämpfung möglich.
Der Begriff Korruption wird alltäglich gebraucht, ohne im Grunde eindeutig zu wissen, welcher Sachverhalt damit umrissen wird. Um dem zu entgegnen, wird im zweiten Kapital der Begriff näher erläutert. Im darauf folgenden dritten Abschnitt werden die empirische und die experimentelle Korruptionsforschung vorgestellt und auf die jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen eingegangen. Das vierte Kapitel stellt letztlich den Schwerpunkt dieser Ausarbeitung dar. In diesem wird der aktuelle Stand der Korruptionsforschung wiedergegeben, indem größtenteils aktuelle experimentelle Studien vorgestellt werden. Dieser 4. Abschnitt ist weiterhin unterteilt in den jeweiligen Gegenstand der Untersuchung (Effekte). Warum korruptes Verhalten überhabt vorkommt und welche möglichen Auswirkungen diese Handlungsweise hat, wird im vorletzten Kapitel durchleuchtet. Eine kritische Schlussbetrachtung rundet diese Ausarbeitung ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff der Korruption
- Empirische und experimentelle Korruptionsforschung
- Stand der Korruptionsforschung
- Einfluss von Eigennutz, Reziprozität, Fairness und Moral
- Gender- und Kultureffekte
- Korruptionsbekämpfung
- Ursachen und Folgen von Korruption
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit "Korruption: Überblick zum Stand der Forschung" analysiert das Phänomen der Korruption und beleuchtet insbesondere aktuelle Forschungsergebnisse zur Korruptionsforschung. Die Arbeit geht den Fragen nach, wie sich Korruption definieren lässt, welche empirischen und experimentellen Ansätze zur Erforschung von Korruption existieren und welche Faktoren Korruption beeinflussen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Korruption
- Empirische und experimentelle Forschungsmethoden zur Analyse von Korruption
- Aktuelle Forschungsergebnisse zum Einfluss von Eigennutz, Reziprozität, Fairness und Moral auf Korruption
- Gender- und Kultureffekte auf korruptes Verhalten
- Möglichkeiten und Herausforderungen der Korruptionsbekämpfung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Korruption ein und beleuchtet die Relevanz des Themas in der heutigen Zeit. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, den aktuellen Stand der Korruptionsforschung darzustellen und wichtige Forschungsfragen zu beleuchten.
Zum Begriff der Korruption: In diesem Kapitel wird der Begriff der Korruption aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Es werden verschiedene Definitionen von Korruption vorgestellt und diskutiert, wobei der Fokus auf die Definition von Transparency International liegt. Zudem wird das Phänomen der Korruption im Rahmen von Prinzipal-Agent-Beziehungen erläutert.
Empirische und experimentelle Korruptionsforschung: Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die empirische und experimentelle Korruptionsforschung. Es werden die Möglichkeiten und Grenzen beider Forschungsansätze dargestellt, wobei die empirische Forschung vor allem Makrodaten zur Analyse der Folgen von Korruption verwendet, während die experimentelle Forschung auf kontrollierte Laborexperimente setzt, um Korruptionsverhalten zu untersuchen.
Stand der Korruptionsforschung: In diesem Kapitel werden die aktuellen Forschungsergebnisse zur Korruptionsforschung vorgestellt. Es werden insbesondere experimentelle Studien behandelt, die den Einfluss von Eigennutz, Reziprozität, Fairness und Moral auf korruptes Verhalten untersuchen. Zudem werden Gender- und Kultureffekte auf Korruption beleuchtet, sowie Möglichkeiten der Korruptionsbekämpfung diskutiert.
Schlüsselwörter
Korruption, Korruptionsforschung, Empirie, Experimente, Eigennutz, Reziprozität, Fairness, Moral, Gender-Effekte, Kultureffekte, Korruptionsbekämpfung, Prinzipal-Agent-Theorie, Transparency International.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Transparency International Korruption?
Korruption wird allgemein als der Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Vorteil definiert.
Warum ist Korruption in Entwicklungsländern oft höher?
Dies liegt oft an schwächeren Institutionen, mangelnder Transparenz in der Verwaltung und ökonomischen Faktoren, die korruptes Verhalten begünstigen.
Was ist experimentelle Korruptionsforschung?
Hierbei wird in kontrollierten Laborexperimenten untersucht, unter welchen Bedingungen Menschen zu korruptem Verhalten neigen (z.B. Einfluss von Moral oder Entdeckungsrisiko).
Spielt das Geschlecht eine Rolle bei Korruption?
Die Forschung untersucht "Gender-Effekte", wobei einige Studien darauf hindeuten, dass Frauen in bestimmten Kontexten weniger korruptionsanfällig sind als Männer.
Was sind die gesamtwirtschaftlichen Folgen von Korruption?
Korruption führt zu Marktverzerrungen, ineffizienter Ressourcenallokation, sinkenden Investitionen und einem Vertrauensverlust in staatliche Institutionen.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Ökonom Paul Ramm (Autor:in), 2010, Korruption - Überblick zum Stand der Forschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156336