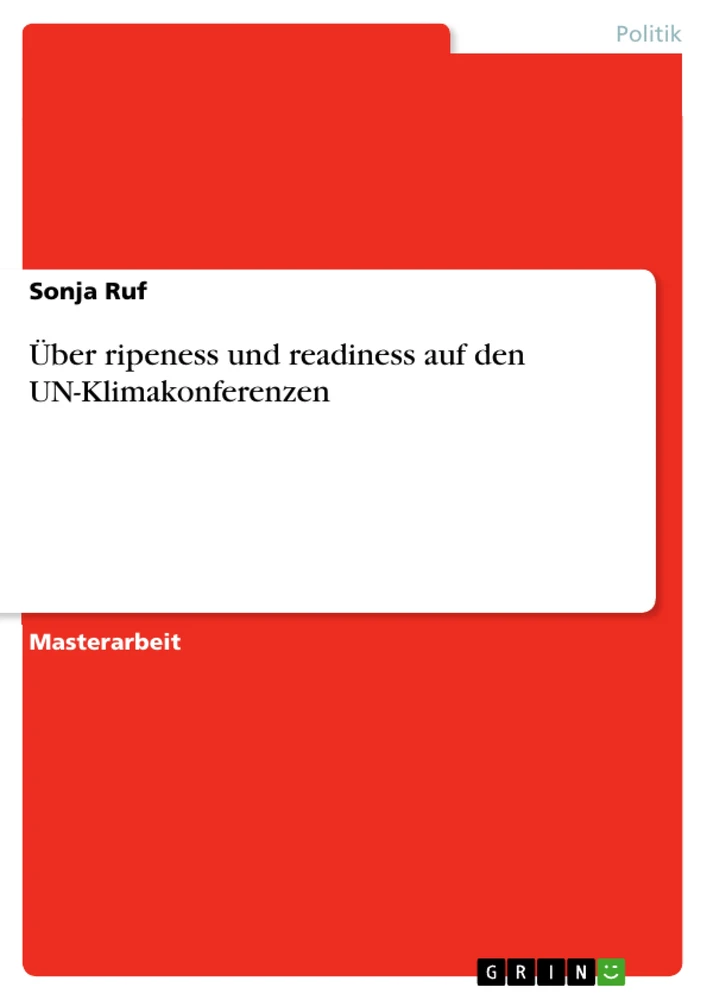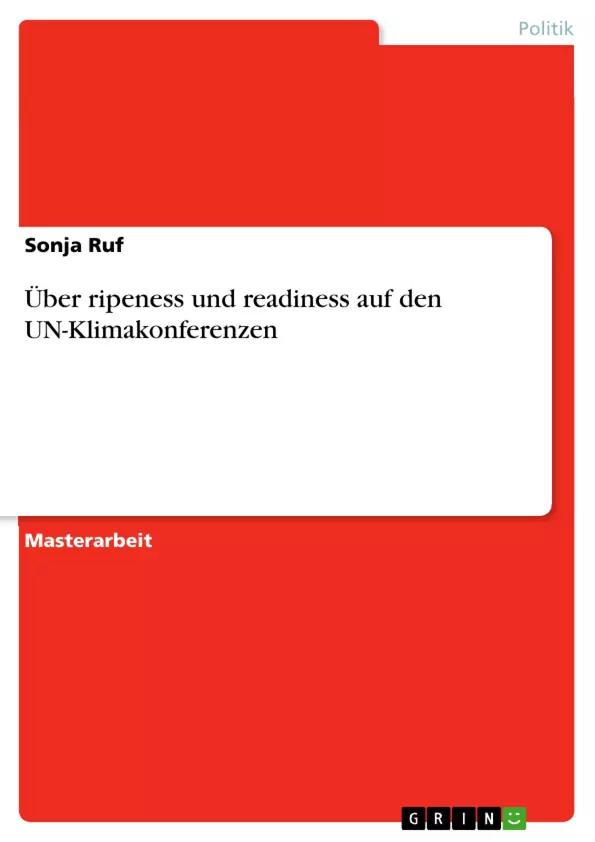Rio 1992, Kyoto 1997 und Paris 2015 – seit 1992 finden im Bereich der internationalen Klimapolitik jährlich die UN-Klimakonferenzen, die sogenannten Conferences of the Parties (COPs), statt. Manche Daten, wie die eingangs genannten, bleiben hierbei als erfolgreiche diplomatische Ereignisse in Erinnerung. Inwiefern lassen sich aus den Grundlagen der ripeness-Theorie, ihrer überarbeiteten Version und der readiness-Theorie Bedingungen und Voraussetzungen ableiten, welche die Wahrscheinlichkeit für erfolgreich abgeschlossene UN-Klimakonferenzen erhöhen?
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsstand: Die UN-Klimakonferenzen
- 3 Theoretischer Rahmen
- 3.1 Ripeness und ihre Komponenten
- 3.2 Entstehung und Entwicklung der ripeness-Theorie
- 3.3 Der Übertrag: Die ripeness-Theorie und die UN-Klimakonferenzen
- 3.4 Operationalisierung: Ripeness in Rio
- 4 Theoretischer Rahmen: Erweiterung
- 4.1 Ripeness 2.0: Die Komponenten
- 4.2 Die Komponenten der readiness-Theorie
- 4.3 Operationalisierung: Ripeness 2.0 und readiness in Kyoto und Paris
- 4.4 Zusammenfassung: Operationalisierung für Rio, Kyoto und Paris
- 5 Methodik und Daten
- 6 Auswertung
- 6.1 Forschungsliteratur und Medienberichterstattung: Ripeness
- 6.2 Forschungsliteratur und Medienberichterstattung: Ripeness 2.0
- 6.3 Forschungsliteratur und Medienberichterstattung: Readiness
- 6.4 Interviews: Rio, Kyoto und Paris
- 7 Schluss und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedingungen für erfolgreiche UN-Klimakonferenzen. Sie analysiert, inwiefern die ripeness-Theorie, ihre Erweiterung (Ripeness 2.0) und die readiness-Theorie helfen können, den Erfolg solcher Konferenzen vorherzusagen und zu fördern. Die Arbeit kombiniert Literaturanalyse mit qualitativen Interviews, um diese theoretischen Konzepte empirisch zu überprüfen.
- Analyse der ripeness-Theorie und ihrer Anwendbarkeit auf UN-Klimakonferenzen
- Bewertung der Erweiterung der ripeness-Theorie (Ripeness 2.0) im Kontext der Klimaverhandlungen
- Einbeziehung der readiness-Theorie zur Erklärung von Erfolgsfaktoren bei multilateralen Verhandlungen
- Empirische Überprüfung der Theorien anhand von Literaturanalysen und Experteninterviews
- Identifizierung von Bedingungen und Voraussetzungen für erfolgreiche UN-Klimakonferenzen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der UN-Klimakonferenzen ein und stellt die Diskrepanz zwischen der jährlichen Häufigkeit der Konferenzen und ihrem unterschiedlichen Erfolg heraus. Sie hebt die drei besonders erfolgreichen Konferenzen von Rio (1992), Kyoto (1997) und Paris (2015) hervor, die jeweils völkerrechtlich bindende Abkommen hervorbrachten, im Gegensatz zu vielen anderen Konferenzen. Die Arbeit formuliert die Forschungsfrage, inwiefern die ripeness-Theorie, ripeness 2.0 und die readiness-Theorie Bedingungen für erfolgreiche Konferenzen erklären können. Die methodische Vorgehensweise mit Literaturanalyse und Experteninterviews wird skizziert.
2 Forschungsstand: Die UN-Klimakonferenzen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den bisherigen Forschungsstand zu den UN-Klimakonferenzen. Es beleuchtet die Geschichte der Konferenzen und analysiert bisherige Erfolge und Misserfolge. Dieser Abschnitt legt die Grundlage für die Anwendung der theoretischen Frameworks im weiteren Verlauf der Arbeit. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der Identifizierung von Mustern und Faktoren, die den Erfolg oder Misserfolg beeinflussen.
3 Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel stellt die ripeness-Theorie von Zartman und die readiness-Theorie von Pruitt vor. Es erklärt die Kernkonzepte beider Theorien und ihre jeweiligen Komponenten. Der Abschnitt beschreibt, wie diese Theorien auf den Kontext der UN-Klimakonferenzen übertragen werden können, und legt die Grundlage für die empirische Untersuchung.
4 Theoretischer Rahmen: Erweiterung: Dieser Teil vertieft den theoretischen Rahmen, indem er die Erweiterung der ripeness-Theorie (Ripeness 2.0) einführt und diese mit der readiness-Theorie verbindet. Es wird erläutert, wie die Komponenten beider Theorien operationalisiert und auf die Konferenzen in Rio, Kyoto und Paris angewendet werden können. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines analytischen Frameworks für die empirische Untersuchung.
5 Methodik und Daten: Das Kapitel beschreibt die Methoden, die in der Arbeit verwendet werden, insbesondere die methodische Triangulation aus systematischer Literaturrecherche und qualitativen Interviews mit Expertinnen und Experten. Die Auswahl der Datenquellen und die Interviewstrategie werden detailliert dargestellt. Die Begründung für die Wahl der Methoden und ihre Eignung zur Beantwortung der Forschungsfrage wird dargelegt.
6 Auswertung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse. Es berichtet über die Auswertung der Literaturrecherche und der Interviews zu den drei Konferenzen (Rio, Kyoto, Paris), getrennt nach den drei theoretischen Ansätzen (Ripeness, Ripeness 2.0, Readiness). Die Ergebnisse werden im Kontext der Forschungsfrage interpretiert und diskutiert.
Schlüsselwörter
UN-Klimakonferenzen, Ripeness, Readiness, völkerrechtliche Abkommen, Klimapolitik, internationale Verhandlungen, methodische Triangulation, qualitative Interviews, Literaturanalyse, Erfolgsfaktoren, Rio, Kyoto, Paris.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedingungen für erfolgreiche UN-Klimakonferenzen und analysiert, inwiefern die ripeness-Theorie, ihre Erweiterung (Ripeness 2.0) und die readiness-Theorie helfen können, den Erfolg solcher Konferenzen vorherzusagen und zu fördern.
Welche UN-Klimakonferenzen werden in der Arbeit besonders betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die UN-Klimakonferenzen von Rio (1992), Kyoto (1997) und Paris (2015), da diese völkerrechtlich bindende Abkommen hervorbrachten.
Welche Theorien werden zur Analyse der UN-Klimakonferenzen verwendet?
Die Arbeit verwendet die ripeness-Theorie, die Erweiterung der ripeness-Theorie (Ripeness 2.0) und die readiness-Theorie.
Was ist die ripeness-Theorie?
Die ripeness-Theorie, entwickelt von Zartman, und die readiness-Theorie von Pruitt sind Theorien, die Bedingungen für erfolgreiche Verhandlungen beschreiben. Die Arbeit untersucht, wie diese Theorien auf den Kontext der UN-Klimakonferenzen übertragen werden können.
Was ist Ripeness 2.0?
Ripeness 2.0 ist eine Erweiterung der ursprünglichen ripeness-Theorie, die in der Arbeit ebenfalls analysiert wird, um ihre Relevanz für Klimaverhandlungen zu bewerten.
Was ist die readiness-Theorie?
Die readiness-Theorie wird einbezogen, um zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen, die den Erfolg von multilateralen Verhandlungen beeinflussen können.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Triangulation aus systematischer Literaturrecherche und qualitativen Interviews mit Expertinnen und Experten.
Welche Art von Daten werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert Forschungsliteratur, Medienberichterstattung und führt qualitative Interviews, um die genannten Theorien empirisch zu überprüfen.
Was ist das Ziel der Literaturanalyse?
Die Literaturanalyse dient dazu, den Forschungsstand zu den UN-Klimakonferenzen zu beleuchten und Muster zu identifizieren, die den Erfolg oder Misserfolg beeinflussen.
Wie werden die Interviews durchgeführt?
Die Interviewstrategie und die Auswahl der Interviewpartner werden detailliert dargestellt, um die Gültigkeit und Aussagekraft der Ergebnisse zu gewährleisten.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind UN-Klimakonferenzen, Ripeness, Readiness, völkerrechtliche Abkommen, Klimapolitik, internationale Verhandlungen, methodische Triangulation, qualitative Interviews, Literaturanalyse, Erfolgsfaktoren, Rio, Kyoto, Paris.
- Quote paper
- Sonja Ruf (Author), 2024, Über ripeness und readiness auf den UN-Klimakonferenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1563513