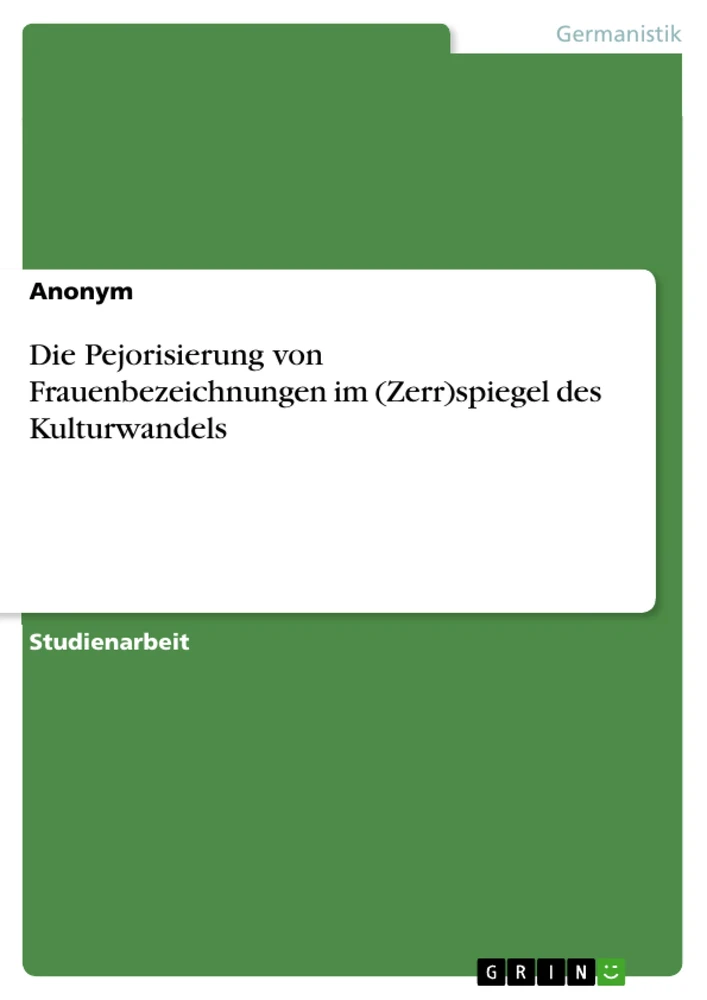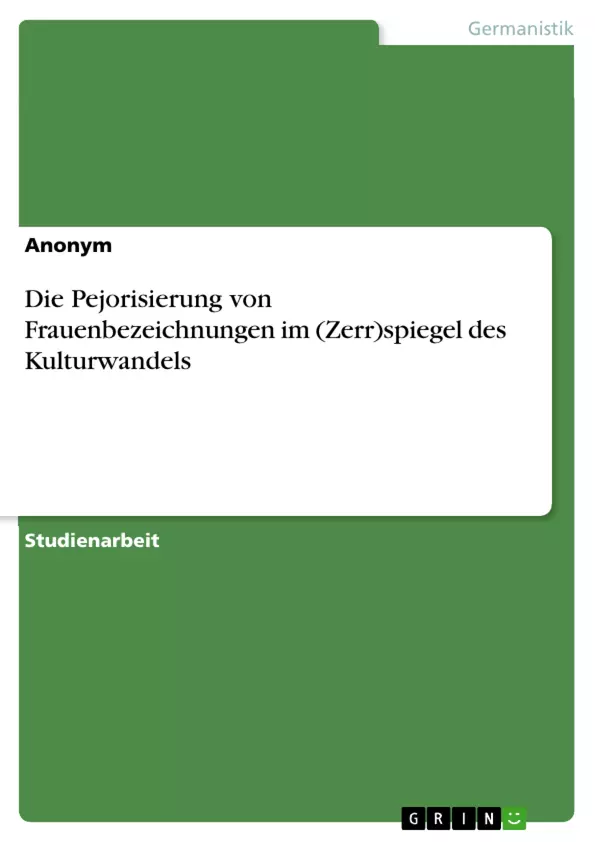Da innerhalb der Linguistik das Themenfeld um den Bedeutungswandel umstritten ist, gibt es verschiedene Ansätze, um die Pejorisierung von Frauenbezeichnungen zu erklären. Rudi Keller (1994) geht davon aus, dass die Pejorisierung von Frauenbegriffen infolge einer sprachlichen Aufwertung und Erhöhung, mit dem sog. „Galanteriegebot“, zu erklären ist und als Zerrspiegel der Kultur zu interpretieren sei. Dagegen argumentiert Nübling (2015), dass Kellers Galanteriegebot zu eindimensional sei und die Pejorisierung von Frauenbezeichnungen gesellschaftlicher Verhältnisse und männlicher Einstellungen gegenüber Frauen widerspiegelt. Dementsprechend sollen im Folgenden korpusbasiert über Kontext- und Kollokationsanalyse aus diachroner Perspektive semasiologisch untersucht werden, inwiefern Kellers Galanteriegebot bezüglich Pejorisierungen von Frauenbezeichnungen im der aktuellen Forschung, die die Pejorisierung als Spiegel kultureller Verhältnisse ansieht, noch Bestand hat. Thematisch wird zur Übersicht zunächst kurz auf den Bedeutungswandel eingegangen. Infolgedessen wird die Pejorisierung von Frauenbezeichnungen in Hinblick auf verschiedene Interpretationsansätze beleuchtet. Daraufhin wird das methodische Vorgehen in Bezug auf die empirische Studie vorgestellt, welche daraufhin anhand ausgewählter Frauenbezeichnungen in verschiedenen Zeitabschnitten dargestellt und analysiert wird. Schlussendlich werden die Ergebnisse in einem Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutungswandel
- Pejorisierung von Frauenbezeichnungen
- Kellers Galanteriegebot als Zerrspiegel des Kulturwandels
- Kritik am Galanteriegebot
- Methode: diachrone Kontext- und Kollokationsanalyse
- Korpusbasierte Analyse ausgewählter Frauenbezeichnungen
- Weib
- 1700-1750
- Frau
- 1700-1750
- 1900-1950
- Weib
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Pejorisierung von Frauenbezeichnungen im Kontext des kulturellen Wandels. Sie analysiert verschiedene Theorien zur Erklärung dieses Phänomens, insbesondere Kellers Galanteriegebot und dessen Kritik. Die empirische Studie mittels diachroner Kontext- und Kollokationsanalyse soll den aktuellen Forschungsstand überprüfen.
- Bedeutungswandel von Wörtern im Allgemeinen
- Pejorisierung von Frauenbezeichnungen als spezifische Form des Bedeutungswandels
- Kellers Galanteriegebot als Erklärungsansatz für die Pejorisierung
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Galanteriegebot und alternative Erklärungsansätze
- Korpusbasierte Analyse ausgewählter Frauenbezeichnungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Pejorisierung von Frauenbezeichnungen ein und verortet sie im Kontext aktueller gesellschaftlicher Debatten. Sie verweist auf den Artikel von Novy (2021) über die Abschaffung der Anrede „Fräulein“ und hebt die anhaltende, wenn auch ironisierte, Existenz dieser und anderer abwertender Frauenbezeichnungen hervor. Die Einleitung stellt die Problematik der Pejorisierung heraus, die durch sprachliche Abwertung gesellschaftliche Machtverhältnisse und Stereotypen reproduziert. Sie differenziert verschiedene Erklärungsansätze, vor allem Kellers Galanteriegebot und dessen Kritik, und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit: eine korpusbasierte diachrone Kontext- und Kollokationsanalyse ausgewählter Frauenbezeichnungen. Die Arbeit kündigt die Kapitelstruktur an, beginnend mit einer Betrachtung des Bedeutungswandels, gefolgt von einer Analyse der Pejorisierung von Frauenbezeichnungen, der methodischen Vorgehensweise und der anschließenden Präsentation der Ergebnisse.
Bedeutungswandel: Dieses Kapitel beleuchtet den Bedeutungswandel als alltäglichen Sprachprozess. Es werden verschiedene Definitionen und Theorien des Bedeutungswandels vorgestellt, inklusive der Differenzierung zwischen semantischen Wandel und anderen Arten von Sprachwandel. Der Fokus liegt auf den Ursachen und Mechanismen des Bedeutungswandels, einschließlich der „unsichtbaren Hand“ (Keller) und der von Blank (1993) beschriebenen Mechanismen wie Metaphorisierung, Metonymisierung, Implikatur, Euphemismus und Ellipse. Verschiedene Typen des Bedeutungswandels, wie Homonymie, Bedeutungsentwicklung, -verengung und -entleerung, werden erläutert. Schließlich wird die Pejorisierung als ein spezifischer Typ des Bedeutungswandels hervorgehoben, der besonders häufig bei Frauenbezeichnungen auftritt.
Schlüsselwörter
Pejorisierung, Frauenbezeichnungen, Bedeutungswandel, Semantik, diachrone Analyse, Kontextanalyse, Kollokationsanalyse, Galanteriegebot, Kulturwandel, Geschlechterrollen, Sprachwandel, Korpuslinguistik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter umfasst. Er untersucht die Pejorisierung von Frauenbezeichnungen im Kontext des kulturellen Wandels.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind: Bedeutungswandel im Allgemeinen, Pejorisierung von Frauenbezeichnungen als spezifische Form des Bedeutungswandels, Kellers Galanteriegebot als Erklärungsansatz für die Pejorisierung, kritische Auseinandersetzung mit dem Galanteriegebot und alternative Erklärungsansätze, sowie eine korpusbasierte Analyse ausgewählter Frauenbezeichnungen.
Welche Frauenbezeichnungen werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Wörter "Weib" und "Frau" in den Zeiträumen 1700-1750 und 1900-1950.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung der Pejorisierung von Frauenbezeichnungen im Kontext des kulturellen Wandels, die Analyse verschiedener Theorien zur Erklärung dieses Phänomens (insbesondere Kellers Galanteriegebot und dessen Kritik) und die Überprüfung des aktuellen Forschungsstandes durch eine empirische Studie mittels diachroner Kontext- und Kollokationsanalyse.
Was ist Kellers Galanteriegebot?
Kellers Galanteriegebot wird als ein möglicher Erklärungsansatz für die Pejorisierung von Frauenbezeichnungen dargestellt. Der Text beinhaltet auch eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Konzept.
Welche Methode wird in der Analyse verwendet?
Die verwendete Methode ist eine korpusbasierte diachrone Kontext- und Kollokationsanalyse.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik der Pejorisierung von Frauenbezeichnungen ein und verortet sie im Kontext aktueller gesellschaftlicher Debatten. Sie verweist auf die anhaltende Existenz abwertender Frauenbezeichnungen und stellt die Problematik der Pejorisierung heraus, die durch sprachliche Abwertung gesellschaftliche Machtverhältnisse und Stereotypen reproduziert. Sie differenziert verschiedene Erklärungsansätze und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
Was wird im Kapitel über Bedeutungswandel behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den Bedeutungswandel als alltäglichen Sprachprozess. Es werden verschiedene Definitionen und Theorien des Bedeutungswandels vorgestellt, der Fokus liegt auf den Ursachen und Mechanismen des Bedeutungswandels. Verschiedene Typen des Bedeutungswandels werden erläutert. Schließlich wird die Pejorisierung als ein spezifischer Typ des Bedeutungswandels hervorgehoben, der besonders häufig bei Frauenbezeichnungen auftritt.
Welche Schlüsselwörter werden im Text genannt?
Die Schlüsselwörter sind: Pejorisierung, Frauenbezeichnungen, Bedeutungswandel, Semantik, diachrone Analyse, Kontextanalyse, Kollokationsanalyse, Galanteriegebot, Kulturwandel, Geschlechterrollen, Sprachwandel, Korpuslinguistik.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Die Pejorisierung von Frauenbezeichnungen im (Zerr)spiegel des Kulturwandels, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1565080