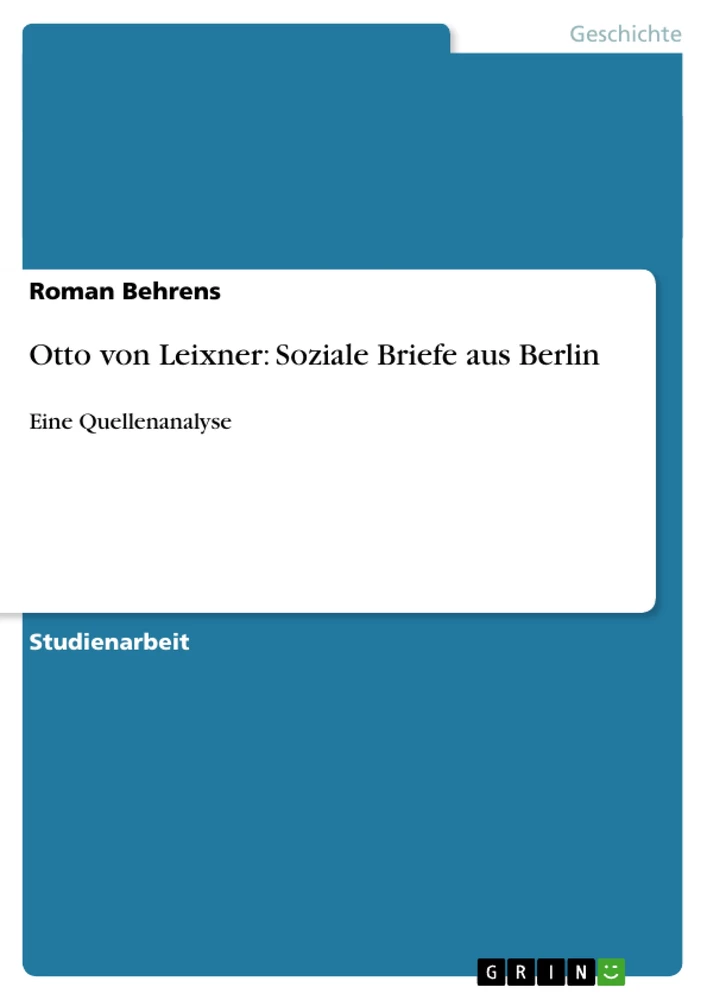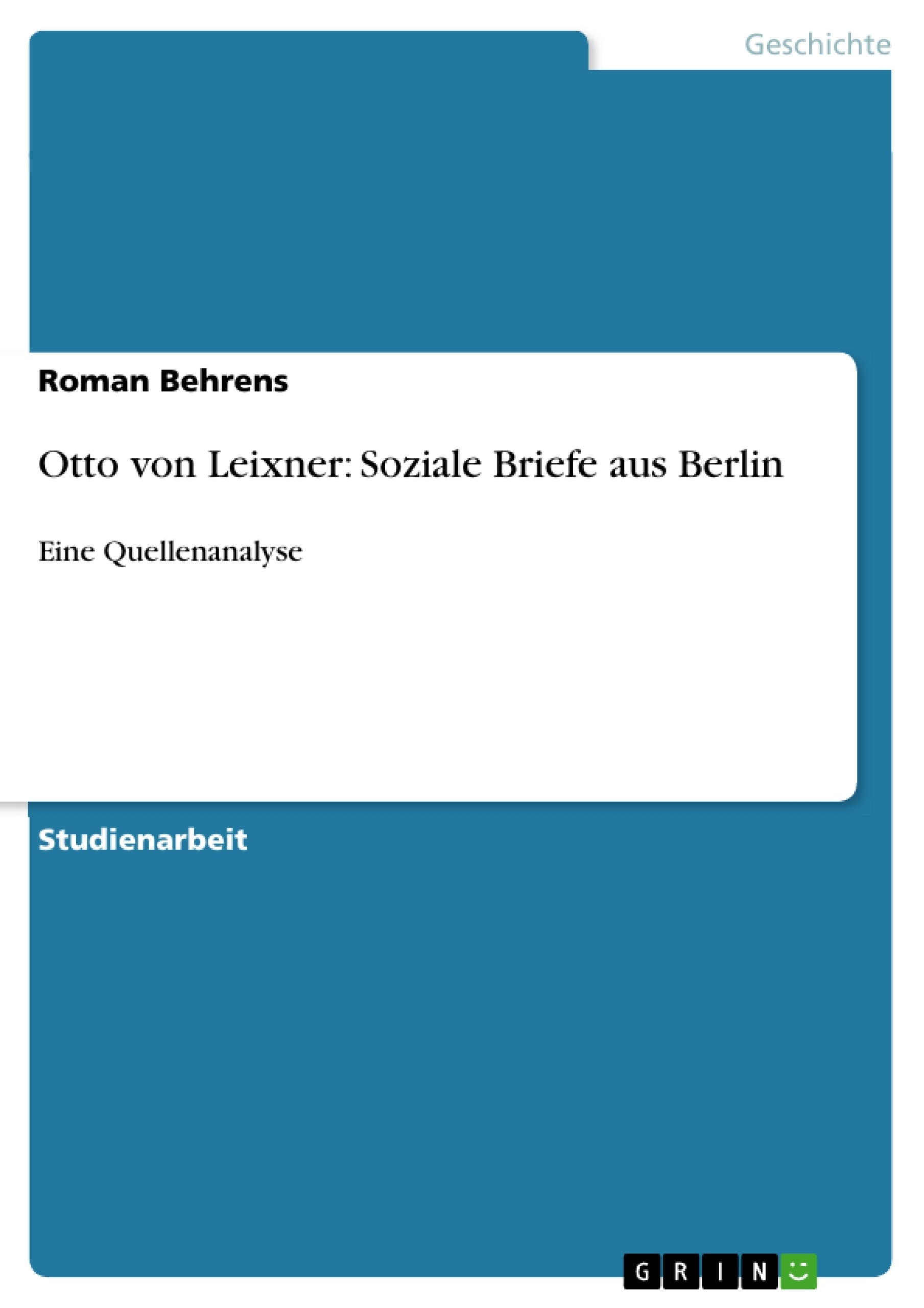"Die meisten gelehrten Frauen gleichen einem Kaufmann, der alle Waren in die Schaufenster stellt und den Laden leer hat."
Dieser Ausspruch des deutschen Historikers und Verlegers Otto von Leixner spiegelt in vielfacher Weise sein Bild des weiblichen Wesens im 19. Jahrhundert wieder. Als wichtiger Bestandteil der Familie war sie einerseits mitverantwortlich das Unternehmen Familie zu bewirtschaften und weiterhin dem Herrn des Hauses eine liebende wie folgsame Ehefrau zu sein. Aber in anderer Hinsicht belegt er damit auch, dass es einen ‚Schein’ gab, der versuchte, das eigentliche ‚Sein’ zu verdecken. Doch wie sah das Leben der Frau und damit auch als Mutter in einer mittelständischen Bürgerfamilie um 1900 in Wirklichkeit aus? Inwiefern konnte sie ihre Bildung und ihren Anspruch auf Selbstverwirklichung mit in das Leben des 19. Jahrhunderts integrieren, oder war eine Frau komplett dem Geist der Zeit unterworfen, die dadurch in ihren persönlichen Zielen zurücktreten musste und letztendlich, was war wirklich Schein und was Sein? Diese Fragestellung soll anhand einer Textquelle aus dem Jahr 1894 des deutschen Historikers Otto von Leixner (1847 – 1907) analysiert werden, der in einem Textauszug aus seinem Werk „Soziale Briefe aus Berlin. Mit besonderer Berücksichtigung der sozialdemokratischen Strömungen“ die mittelständische Familie im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts in sozialer wie gesellschaftlicher Sicht behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Bürgerliche Kernwerte wie Bildung, Selbstständigkeit und Leistung in allen Lebenszusammenhängen¹ sind auch für die Frau des ausgehenden 19. Jahrhunderts Werte, die zu erreichen sie stetig bestrebt war.
- Dieses Ideal vermittelte sie natürlich auch ihren Kindern, die sie zu beaufsichtigen und zu erziehen hatte.
- Otto von Leixner nimmt in der vorliegenden Textquelle darauf Bezug, indem er zu Beginn seiner Ausführungen den Spagat zwischen dem Ziel des weiblichen Wesens, nämlich zum einen geordnete Verhältnisse vorweisen zu können und andererseits „die Töchter zu guten Hausfrauen zu machen“, und der Realität und den damit einhergehenden Entbehrungen beschreibt.
- Sehr prägnant ist dafür die von ihm geschilderte Szene, dass die Mutter, und hier meint er die gebildete Frau des Mittelstandes, im Grunde genommen die unumstrittene und in wirtschaftlichen Dingen die tonangebende Person im Haus ist, indem sie die Töchter beim Kleidernähen anlernt, den Mann nach langem Reden zum Kauf von Kleidungsstücken überzeugt³ und die Entscheidung dann sorgfältig mit den beteiligten Personen erörtert, da solche Käufe gleich für mehrere Generationen getätigt werden.
- So ist es nicht verwunderlich, dass dem Prinzip des Auftragens hier eine sehr pragmatische Form widerfährt.
- Aber warum muss die Frau als Organisationstalent und Koordinatorin im Haus den Überblick wahren und Dinge mit Bedacht einkaufen, so dass es zu möglichst wenigen unsachgemäßen Käufen kommt?
- Der Grund dafür findet sich in der Tatsache, dass die Ehefrau aufgrund der billigeren Lebensmittel statt morgens meist abends in den Markthallen einkauft oder die Familie sich bei größeren geplanten Vorhaben wie etwas dem Ausstatten der Töchter mit Kleidern für bevorstehende Bälle in der Ernährung einschränken muss, um diese Vorhaben zu finanzieren.
- Diese kennzeichnenden Attribute wie angepasste Sparsamkeit und bewusstes Einkaufen werden in der Ernährung der behandelten mittelständischen Bürgerschicht sehr deutlich, denn bei der Oberschicht galt eine reichhaltige Mahlzeit als Nachweis des erreichten Wohlstandes und ein beleibtes Äußeres geradezu als Merkmal des sozialen Prestiges gegenüber den Hungerleidernº.
- Von Leixner handelt hieran die eingangs beschriebene Ladenmetapher ab, denn nur zu sehr war die gebildete Berliner Frau darum bemüht den Schein einer nach außen gut situierten Familie zu wahren, indem man sich bei den essentiellen Dingen des Lebens, wie hier der Ernährung einschränkte, um gesellschaftlich nicht an Ansehen zu verlieren.
- Hieran wird sehr deutlich, wie die mittelständische Bürgerfamilie mit einem Offizier, Lehrer, Beamten als Familienoberhaupt, darauf bedacht war, wirtschaftlich und im Sinne des Geldbeutels zu handeln, um das nach außen scheinende Bild einer soliden wie gutbürgerlichen Familie, die ihre Kinder auf Bälle oder auf Internate schickt, zu erhalten.
- Denn im Gegensatz dazu konnte eine Frau aus dem Kaufmannsstande diesen Typus Frau nicht erfüllen, da bei ihr lediglich eine oberflächliche Bildung vorhanden war, welcher den wichtigen Aufgaben, wie z.B. der Haushaltsführung mit ihren komplexen Eigenheiten, nicht gerecht werden konnte.
- Dieses belegt von Leixner mit einem großstädtischen Vergleich, indem er den Berliner Kaufmannsfrauen die Pariser Pendants vorzieht, da diese voneinander noch „,manches lernen könnten.\nBemerkenswert ist die vom Autor angegebene Unterscheidung von Frauen in das jüngere und das ältere Geschlecht.
- Hierbei attestiert er dem letztgenannten aufgrund der Erfahrung ein deutlich frischeres, natürlicheres, weiblicheres und geistig regsameres Auftreten.
- Besonders sind bei jenen so genannte Bildungsüberlieferungen zu finden, die bis in die späte Romantik oder gar bis in die vorrevolutionäre Zeit vor 1848 reichen 8.
- Doch von Leixner geht noch weiter, indem er dem eben beschriebenen Typus Frau eine naive Freude am Schönen, gepaart mit starkem häuslichen Sinn bescheinigt.
- Dass das Bild der in der Quelle beschriebenen Berliner Frau auch mit der Frau im Allgemeinen konform geht, passt auch zu neueren Erkenntnissen der Forschung, welche z.B. belegen, dass sich die Ehefrau im ausgehenden 19. Jahrhundert als wahre Konsumexpertin beweisen musste.
- Denn neue Fertigkeiten und Kenntnisse wurden nun verlangt, bei denen sich nicht mehr auf den reichhaltigen Erfahrungsschatz der Vorfahren berufen werden konnte.
- Dem jüngeren Geschlecht hingegen ist er nicht ganz so zugewandt, da bei ihm doch mehr die Freude an lärmenden Vergnügungen und das Blenden durch scheinbare Vielseitigkeit der Bildung im Vordergrund steht¹, als weibliche, traditionelle Attribute wie das Dasein als sorgende wie umsichtige Mutter.
- Und genau hier lässt die subtile Angst Leixners festmachen, dass die bürgerlichen Werte dem allmählichen Verfall ausgesetzt sind, stehen doch nun scheinbar andere Interessen im Mittelpunkt der jungen Frau, die mehr Sinn im Blenden und dem Schein sehen, als im Sein als Mutter und verantwortungsvolles weibliches Wesen.
- Jedoch bescheinigt er ihnen einen Drang, sich selbstständiger zu entwickeln,,,um nicht auf den Mann Jagd machen zu müssen“12.
- Dies bildet im umgekehrten Sinn eine Brücke zur eingangs aufgestellten Frage, inwiefern es der Frau im 19. Jahrhundert möglich war, Intelligenz und Selbstverwirklichung zu vereinen, denn im Zuge der beginnenden Industrialisierung war es geboten, „die Entfesselung der weiblichen Arbeitskraft voranzutreiben und auch aus politisch-\nideologischen Gesichtspunkten war es zu begrüßen, die Frau aus ihrer persönlichen Sklaverei zu befreien und sie „zur würdigen Gehilfin des Mannes und zu vollwertigem Mitgliede der Menschheit (zu) erheben“14.
- Familienpflichten und Erwerbsarbeit ließen sich im Notfall durchaus miteinander kombinieren, wobei an der Einzigartigkeit des Familienlebens nichts zu verändern sei.
- So waren diese Erkenntnisse erste Schritte in eine Richtung, die der Frau des Bürgertums nicht nur eine andere Stellung als der bisher zugedachten, nämlich als Hausfrau und Mutter tätig zu sein, ermöglichten und ihr weiterhin den Weg in eine eigene, nicht fremdbestimmte Zukunft ebneten.
- Dass sich Bürgerlichkeit neben den bereits erwähnten bürgerlichen Kernwerten auch durch öffentliches Engagement¹ manifestierte, und der Frau so die Möglichkeit bot, aus der beschriebenen Stellung zu entfliehen, zeigt sich recht deutlich in den Untersuchungen von Ute Frevert, die belegt, dass das Mitwirken an gesellschaftlich wichtigen kommunalen Aufgaben für sie eine persönliche Aufwertung war, die sich aber nicht in Mark und Pfennig ausdrückte ¹.
- Es wird z.B. das ehrenamtliche Wirken gebildeter bürgerlicher Frauen im Rahmen der Armenpflege erwähnt, in denen jene den Arbeiterfrauen vernünftige Haushaltung und Kinderpflege vorlebten und nahe brachten¹8.
- So war es den Frauen der Offiziere, Lehrer und Beamten des mittelständischen Bürgertums möglich, sich neben der Hausarbeit auch noch ehrenamtlich zu engagieren und ihr Wissen an Bevölkerungsschichten weiterzugeben, denen ein Zugang zu Bildung aufgrund der sozialen Herkunft verwehrt blieb.
- Doch wie stand es mit den Kindern der bürgerlichen Familie und inwiefern wirkte sich die Bildung der Mutter auf deren Entwicklung aus?
- Als gutes Beispiel dafür und dass ihre Töchter und Söhne mit dem in der Quelle erwähnten materialistischen Denken der Kaufmannsfamilie wenig anfangen konnten, belegt von Leixner, indem er beschreibt, dass sich die Sprösslinge der Gewerbefamilien „entschiedener nach der geistige Seite sich entwickeln und brennender Hass oder doch tiefe Abneigung gegen die nur materialistischen Lebensanschauungen der Umgebung in sich großziehen¹. Nur zu sehr wird von den Denkweisen der Eltern Abstand genommen, die sich doch nur im Wissen der Kinder sonnen, jene auf höhere Schulen schicken und sie Klavier spielen lassen.
- Die Mutter versuchte zwar ihren Kindern die eigene Lebensführung näher zu bringen und das Streben nach eigener Bildung war ebenfalls vorhanden, doch diese blieb in der Summe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Quelle von Otto von Leixner untersucht die Situation der Frau in der bürgerlichen Familie des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Berlin. Der Text analysiert die Erwartungen und Realitäten, denen Frauen in dieser Gesellschaftsschicht ausgesetzt waren, insbesondere im Hinblick auf Bildung, Selbstverwirklichung und die Rolle als Hausfrau und Mutter. Die Quelle bietet einen wertvollen Einblick in die gesellschaftlichen Normen und die Lebenswelt der Frauen in dieser Zeit.
- Die Rolle der Frau im bürgerlichen Haushalt und die Erwartungen an sie
- Bildung und Selbstverwirklichung im Spannungsfeld zwischen Tradition und Modernisierung
- Der Einfluss der gesellschaftlichen Klasse auf das Leben und die Möglichkeiten der Frau
- Der Schein und das Sein: Die Bedeutung von gesellschaftlichem Ansehen und der Präsentation des eigenen Lebens
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich für Frauen im Kontext der Industrialisierung und der sich verändernden Gesellschaftsstrukturen ergeben
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text von Otto von Leixner beleuchtet verschiedene Aspekte des Lebens der Frau im Berliner Bürgertum um 1900. Er zeichnet ein Bild von den Erwartungen und Anforderungen an die Frau als Hausfrau und Mutter, wobei die Bedeutung von Bildung und Selbstständigkeit als wichtige Werte der bürgerlichen Gesellschaft hervorgehoben werden.
Der Autor analysiert den Spagat zwischen Tradition und Modernisierung, der die Frauen dieser Zeit vor Herausforderungen stellte. Er zeigt, wie Frauen aufgrund der gesellschaftlichen Normen und der ökonomischen Realitäten in ihrer Selbstverwirklichung eingeschränkt waren. Dennoch werden auch die Bemühungen der Frauen um Bildung und ein eigenständiges Leben in den Blick genommen.
Leixner untersucht die Bedeutung von Schein und Sein im bürgerlichen Umfeld und wie die Frauen gezwungen waren, ein bestimmtes Bild nach außen zu projizieren, um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Er geht auf die Unterschiede zwischen Frauen aus dem gehobenen Bürgertum und denen aus dem Kaufmannsstand ein, wobei die Bildung und die gesellschaftliche Rolle der Frauen in den Fokus gerückt werden.
Schlüsselwörter
Die Analyse der Textquelle von Otto von Leixner konzentriert sich auf die Themenbereiche bürgerliche Werte, Frauenrolle, Bildung, Selbstverwirklichung, gesellschaftliche Normen, Schein und Sein, bürgerliche Familie, Mittelstand, Berlin, 19. Jahrhundert, Industrialisierung, Tradition, Modernisierung.
- Quote paper
- Roman Behrens (Author), 2008, Otto von Leixner: Soziale Briefe aus Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156588