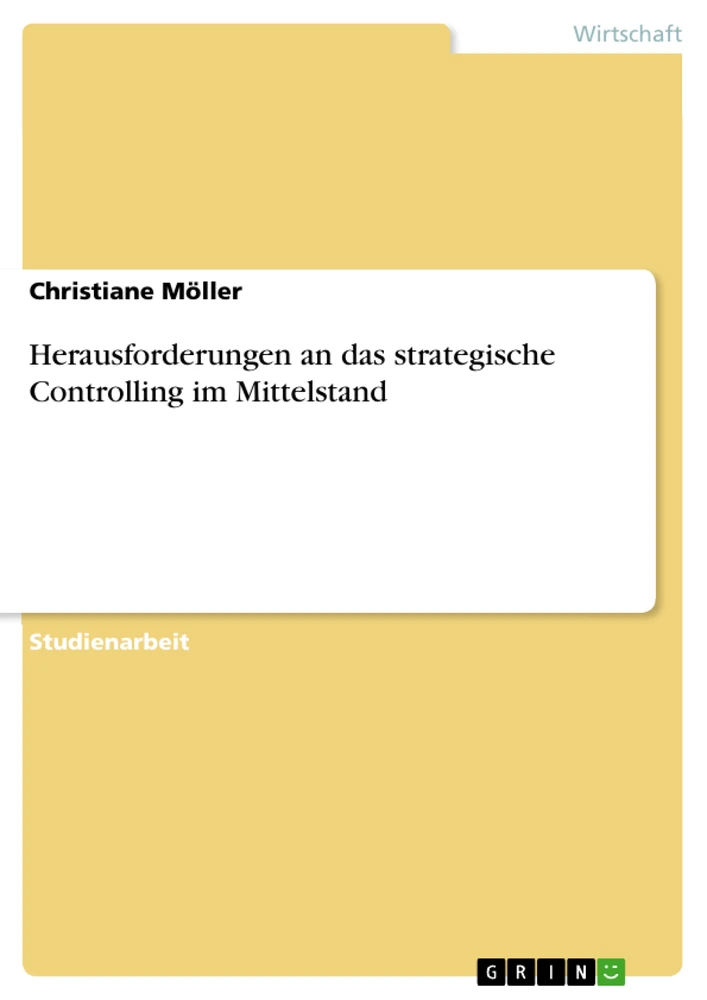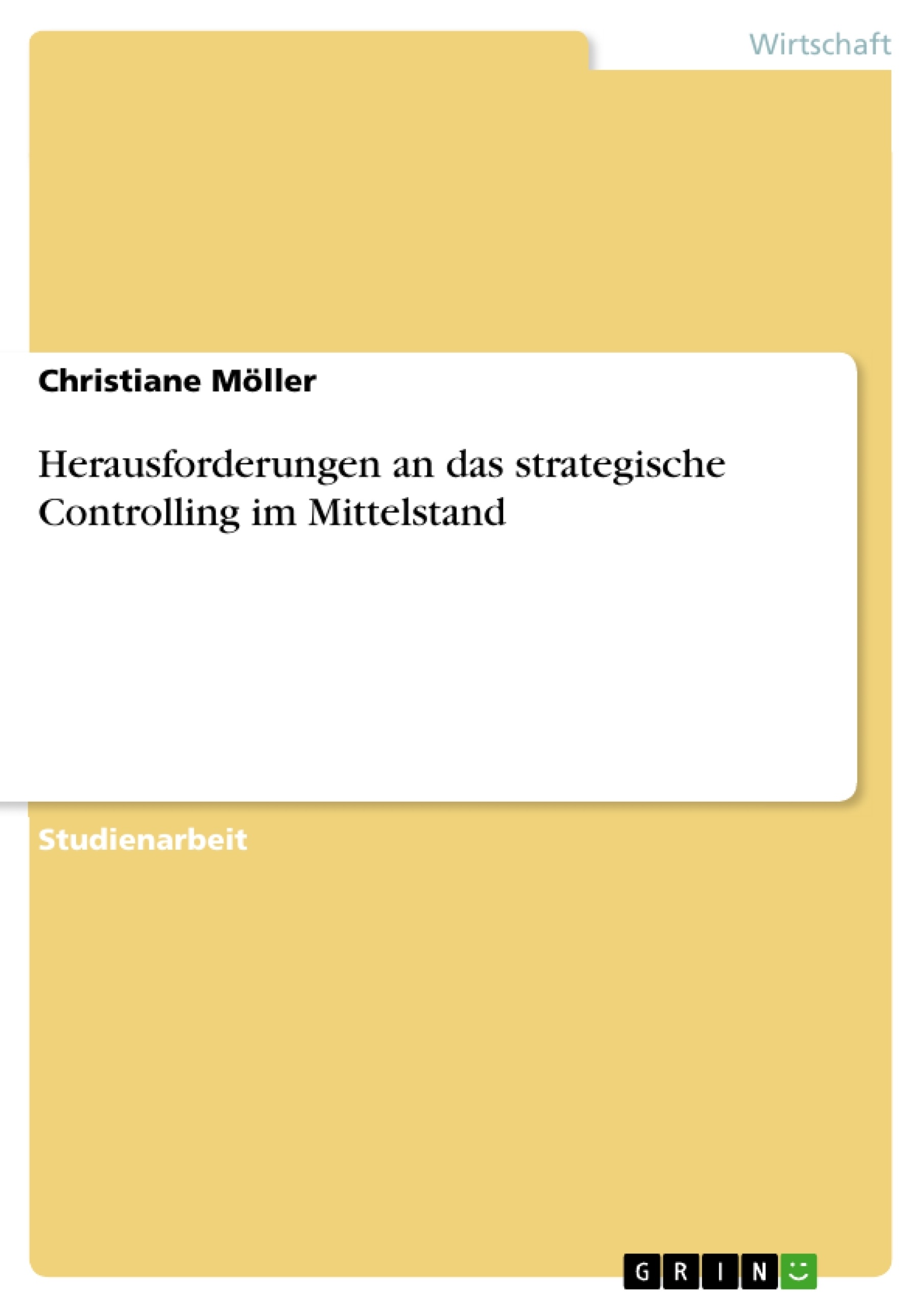Nach Erfahrung der Creditreform wird im Mittelstand immer noch zu wenig aktives Controlling betrieben. Kleineren Unternehmen fehlen die entsprechend ausgebildeten Mitarbeiter und selbst in größeren Mittelstandsbetrieben ist der Bereich Controlling schlecht entwickelt. Der Mittelstand übersieht hierbei, dass der Einsatz eines Controlling-Systems zur Existenzsicherung beiträgt.
Insbesondere das strategische Controlling findet nicht genügend Beachtung. Vor allen in guten Zeiten wird im Mittelstand keine Notwendigkeit gesehen strategische Planungen durchzuführen. Dies ist aber der falsche Ansatz, denn nur wenn ein Unternehmen sich strategisch richtig positioniert, wird gewährleistet, dass das Unternehmen auch zukünftig erfolgreich bleibt. Vor dem Hintergrund fortschreitender Globalisierung „nehmen nicht nur die möglichen Handlungsalternativen massiv zu, sondern auch deren Konsequenzen“. Mit einem Controlling-System, das sich an der Unternehmensgröße, der Struktur bzw. der Organisation des Unternehmens ausrichtet, kann das Unternehmen die Herausforderungen der Globalisierung besser bewältigen. Die Geschäftsleitung sollte die Daten monatlich analysieren und auswerten um evtl. entsprechende Maßnahmen rechtzeitig veranlassen zu können. Das Controlling hinsichtlich des Kapitalbedarfs, des Risikomanagements und die grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmensziels bedarf im Rahmen der Globalisierung einer besonderen Beachtung.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkurzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Definition Mittelstand
1.2 Problemstellung
1.3 Zielsetzung
2. Herausforderungen des Mittelstandes im Rahmen der Globalisierung
2.1 Chancen fur den Mittelstand im Rahmen der Globalisierung
2.2 Risiken fur den Mittelstand im Rahmen der Globalisierung
3. Anforderungen an das strategische Controlling
3.1 Aufgaben des strategischen Controllings im Mittelstand
3.2 Instrumente des strategischen Controllings
4. Fazit
Literaturverzeichni
Häufig gestellte Fragen
Warum ist strategisches Controlling für den Mittelstand wichtig?
Strategisches Controlling sichert die Existenz des Unternehmens, indem es langfristige Planungen ermöglicht und die Wettbewerbsfähigkeit in einer globalisierten Welt erhält.
Welche Herausforderungen bringt die Globalisierung für KMU?
Die Globalisierung erhöht die Anzahl der Handlungsalternativen, aber auch die Schwere der Konsequenzen bei Fehlentscheidungen, was ein präzises Risikomanagement erfordert.
Welche Instrumente nutzt das strategische Controlling?
Zu den Instrumenten gehören unter anderem die SWOT-Analyse, Portfolio-Analysen und die langfristige Kapitalbedarfsplanung.
Wie oft sollte die Geschäftsleitung Controlling-Daten analysieren?
Es wird empfohlen, die Daten monatlich auszuwerten, um rechtzeitig auf Marktveränderungen oder interne Fehlentwicklungen reagieren zu können.
Warum wird Controlling im Mittelstand oft vernachlässigt?
Häufig fehlen speziell ausgebildete Mitarbeiter, oder in wirtschaftlich guten Zeiten wird die Notwendigkeit für strategische Planung unterschätzt.
- Citar trabajo
- Christiane Möller (Autor), 2007, Herausforderungen an das strategische Controlling im Mittelstand, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156721