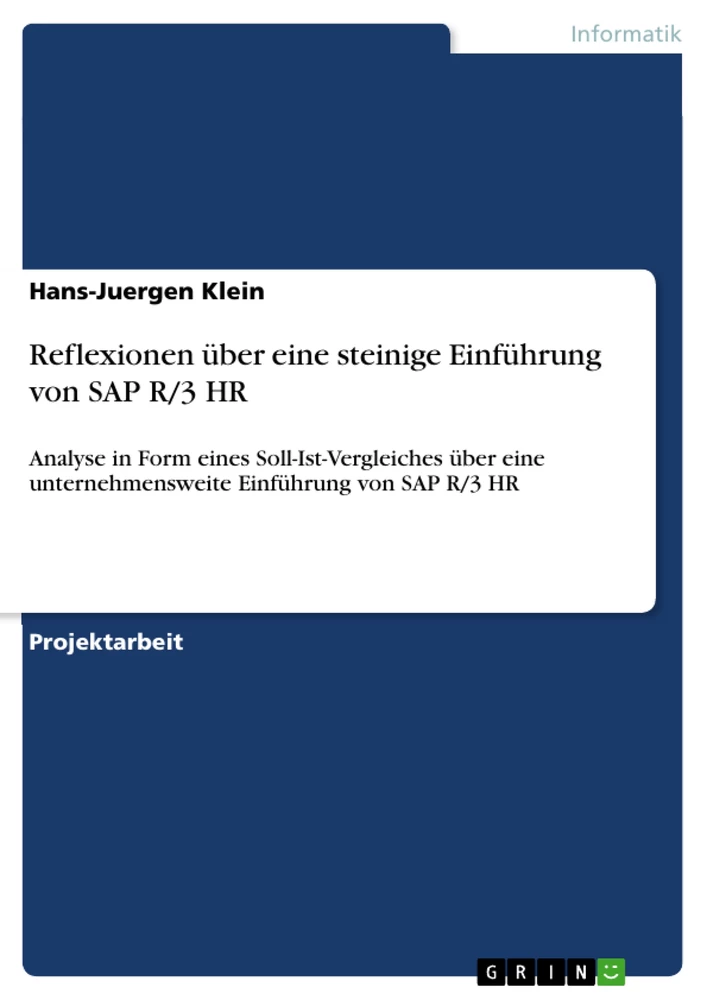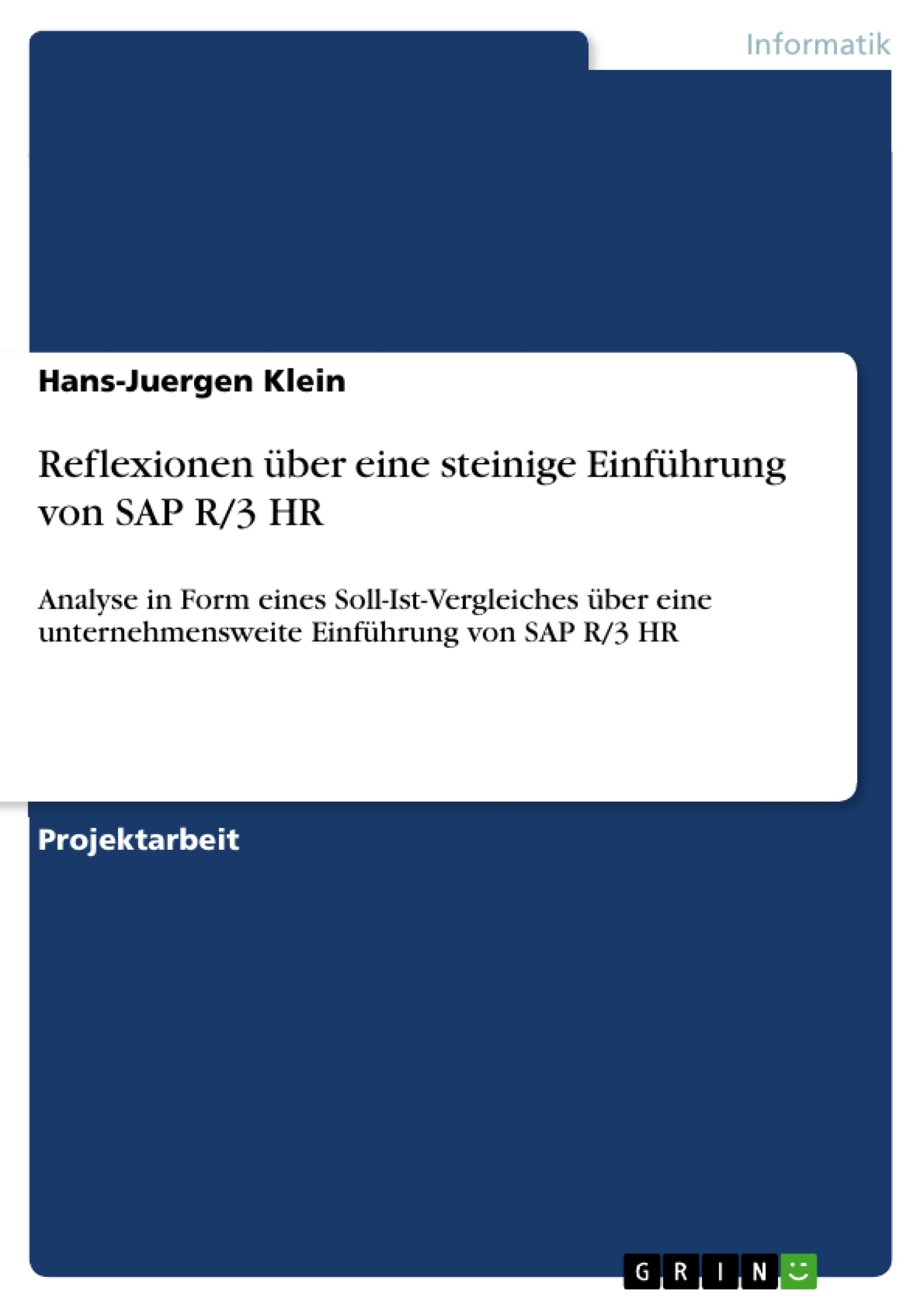Die Einführung von Projekten gestaltet sich nach wie vor in vielen Unterneh-men als schwierig.
Anhand einer Fallstudie wird eine bereits abgeschlossene Projekteinführung des SAP R/3 Moduls HR in einer Unternehmenseinheit eines Konzerns mit ca. 1.000 Mitarbeitern analysiert.
Diese Projektarbeit möchte einen Betrag zur Offenlegung von notorischen Feh-lerquellen, die im Zuge der Projektarbeit gemacht werden, leisten. Exempla-risch wird dies bei der Einführung des Moduls SAP R/3 HR diskutiert. Dabei stehen im Vordergrund die allgemeinen fachlichen Projektmanagementaufga-ben und nicht die SAP-R/3-HR spezifischen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- A Einleitende Gedanken
- A.1 Erläuterung der Vorgehensweise
- A.2 Entwicklung einer wissenschaftlichen Fragestellung
- A.3 Definition der zentralen Begriffe "Projekt" und "Projektmanagement"
- B Hauptteil
- B.1 Beschreibung des tatsächlichen Projektablaufes
- B.2 Darstellung des idealtypischen Projektablaufes
- B.2.1 Aufgaben des Projektmanagers
- B.2.2 Instrumente der Projektplanung
- B.2.3 Instrumente der Projektsteuerung
- Exkurs: Konfliktmanagement
- B.3 Fazit
- C Abschließende Gedanken
- D Abbildungsverzeichnis
- E Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit analysiert die Einführung des SAP R/3 Moduls HR in einer Unternehmenseinheit anhand einer Fallstudie. Die Arbeit zielt darauf ab, gängige Fehlerquellen bei Projektarbeiten aufzudecken und diese anhand des Beispiels der SAP R/3 HR-Einführung zu diskutieren. Der Fokus liegt dabei auf allgemeinen fachlichen Projektmanagementaufgaben und nicht auf SAP-R/3-HR-spezifischen Aspekten.
- Analyse der Fehlerquellen bei der Einführung von SAP R/3 HR
- Vergleich des tatsächlichen Projektablaufs mit dem idealtypischen Projektablauf
- Identifizierung von Instrumentarien, die in bestimmten Phasen des Projekts hilfreich gewesen wären
- Bedeutung des Projektmanagements für den Unternehmenserfolg
- Anwendung von Methoden der nicht-experimentellen empirischen Sozialforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A stellt die Vorgehensweise der Projektarbeit und die wissenschaftliche Fragestellung vor. Kapitel B analysiert den tatsächlichen Projektablauf im Vergleich zum idealtypischen Projektablauf. Die Unterkapitel B.2.1 bis B.2.3 beleuchten die Aufgaben des Projektmanagers, die Instrumente der Projektplanung und die Instrumente der Projektsteuerung. Der Exkurs widmet sich dem Konfliktmanagement. Kapitel C bietet abschließende Gedanken zur Bedeutung des Projektmanagements für Unternehmen.
Schlüsselwörter
Die Projektarbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Projektmanagement, SAP R/3 HR-Einführung, Soll-Ist-Vergleich, Fehlerquellen, Instrumentarien, Projektplanung, Projektsteuerung und Konfliktmanagement.
Häufig gestellte Fragen zur SAP R/3 HR Einführung
Was sind die häufigsten Fehlerquellen bei SAP-Projekten?
Oft liegen die Probleme nicht in der Technik, sondern im Projektmanagement: mangelnde Planung, unzureichende Kommunikation, fehlende Ressourcen und Defizite in der Projektsteuerung.
Warum ist ein Soll-Ist-Vergleich im Projektmanagement wichtig?
Er ermöglicht es, Abweichungen vom idealen Projektablauf frühzeitig zu erkennen und mit geeigneten Instrumenten gegenzusteuern, um Zeit- und Budgetüberschreitungen zu vermeiden.
Welche Rolle spielt Konfliktmanagement bei der Software-Einführung?
Die Einführung neuer Systeme wie SAP R/3 HR führt oft zu Widerständen bei Mitarbeitern. Ein aktives Konfliktmanagement hilft, diese Barrieren abzubauen und die Akzeptanz zu erhöhen.
Was sind die zentralen Aufgaben eines Projektmanagers laut Fallstudie?
Zu den Aufgaben gehören die Definition von Meilensteinen, die Koordination der Teams, die Überwachung der Fortschritte und die Sicherstellung der Informationsflüsse zwischen den Abteilungen.
Wie beeinflusst die Unternehmenskultur den Erfolg einer SAP-Einführung?
Eine offene Kultur, die Veränderungen unterstützt, ist entscheidend. In starren Strukturen scheitern Projekte oft an internen Machtkämpfen oder mangelnder Transparenz.
- Quote paper
- BA in Politik- und Verwaltungswissenschaften und Dipl.-Betrw. FH Hans-Juergen Klein (Author), 2010, Reflexionen über eine steinige Einführung von SAP R/3 HR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156726