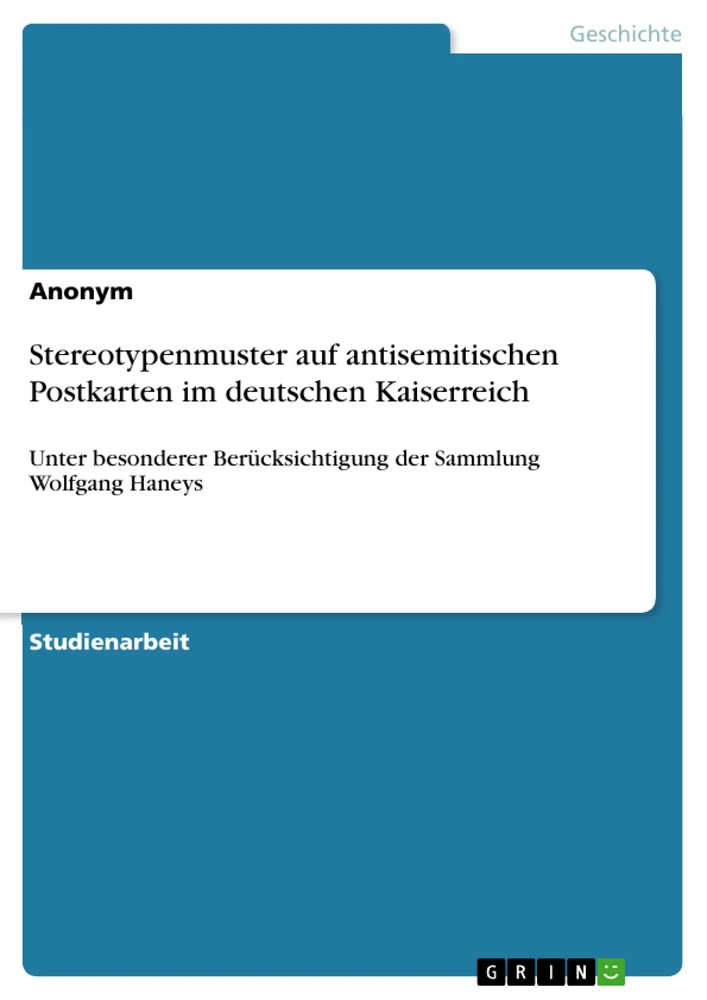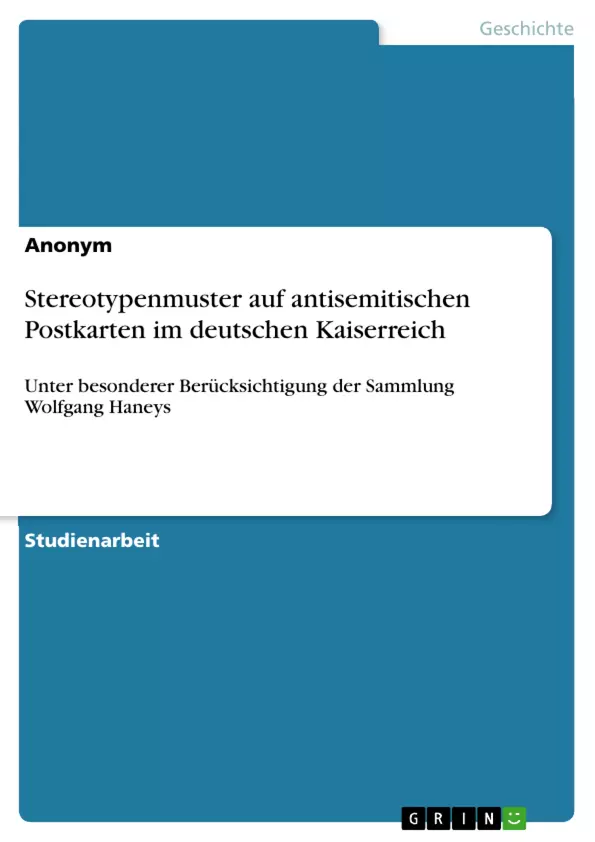Antijüdische Stereotypen wirken wie ein kleiner Teil im Kosmos der antisemitischen Geschichte, dennoch wird mit ihnen eine Grundlage gebildet, die versucht den Antisemitismus zu rechtfertigen und z.T. auf scheinbar humoristische Art alltagstauglich zu machen. Im Folgendem geht es um diese Stereotypen, welche sich insbesondere an der Postkartensammlung Haneys orientieren, und durch welche darstellerischen Mittel diese konstruiert wurden. Darüber hinaus wird die Intention dieser Karten thematisiert sowie die Reaktion der Adressaten, die das jüdische und nicht-jüdische Publikum mit einbeziehen. Dabei wird auch die Rolle und Stellung des Staates deutlich. Die Resultate, die die Karten erzielen, werden dabei nur angeschnitten, da sie vor allem die alltägliche, von der Normalbevölkerung gelebte Judenfeindlichkeit vor Augen führen. Das führt dazu, dass Teilbereiche, die den modernen Antisemitismus förderten, keine Berücksichtigung finden, wie etwa die aggressiven Schriften gegen das Judentum Fries‘ und Fritschs oder den politischen Antisemitismus, welcher v.a. durch Stöcker repräsentiert wird.
Während der Antisemitismus in Deutschland bis 1945 zur Alltagskultur gehörte, wurde er danach - eingedenk der nationalsozialistischen Gräueltaten - tabuisiert und aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt. Relevant ist das Thema auch heute noch, da der Antisemitismus tatsächlich noch immer nicht vollständig von der Bildfläche und damit aus den Köpfen vieler Menschen verschwunden ist. Man hat den Eindruck, dass gerade die Anonymität des Internets und der sozialen Medien eine Renaissance rassistischen bzw. antisemitischen Gedankenguts begünstigt. Die Mittel, derer man sich dazu heute bedient, sind im Prinzip die gleichen wie vor über einhundert Jahren: Herabsetzung, Ausgrenzung und Entmenschlichung. Dabei soll beispielhaft anhand antisemitischer Postkarten aus der Kaiserzeit gezeigt werden, welche Rolle dabei Medien spielen, Vorurteile zu tradieren und einzubürgern. Es gilt diese Bilder und Darstellungen zu hinterfragen, da ihr Inhalt auch in der jetzigen Zeit als Fundament der Vorurteile gilt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellerische Mittel anhand von Bildbeispielen
- Stereotypen in der Darstellung
- Althergebrachte Stereotypen
- Neuere Stereotypen
- Mögliche Zielsetzungen/Motivation
- Reaktionen in der jüdischen und der nichtjüdischen Bevölkerung bzw. staatlicher Institutionen
- Zusammenfassung/Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht antisemitische Stereotypen auf Postkarten aus der Kaiserzeit, basierend auf der Postkartensammlung von Wolfgang Haney. Die Zielsetzung ist es, die darstellerischen Mittel aufzuzeigen, mit denen diese Stereotypen konstruiert wurden, ihre Intention zu beleuchten und die Reaktionen des jüdischen und nicht-jüdischen Publikums sowie staatlicher Institutionen zu analysieren. Der Fokus liegt auf der alltäglichen Judenfeindlichkeit, ohne den modernen Antisemitismus umfassend zu behandeln.
- Darstellung antisemitischer Stereotypen auf Postkarten der Kaiserzeit
- Analyse der verwendeten darstellerischen Mittel (Körperverzerrung, Dehumanisierung etc.)
- Untersuchung der Intentionen hinter der Produktion und Verbreitung dieser Postkarten
- Behandlung der Reaktionen der Bevölkerung und staatlicher Stellen
- Die Rolle der Medien bei der Tradierung von Vorurteilen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik antisemitischer Stereotypen ein und betont deren Rolle bei der Rechtfertigung und Alltäglichmachung von Antisemitismus. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Analyse antisemitischer Postkarten aus der Kaiserzeit unter Berücksichtigung der verwendeten Darstellungsmittel, der Intentionen und der Reaktionen des Publikums und des Staates. Die Arbeit beschränkt sich dabei auf die alltägliche Judenfeindlichkeit und lässt Aspekte des modernen Antisemitismus außer Acht.
Darstellerische Mittel anhand von Bildbeispielen: Dieses Kapitel analysiert die typischen gestalterischen Mittel in den antisemitischen Postkarten. Es beschreibt die Verwendung von Körperverzerrungen (übertriebene Nasen, Kleinwuchs, Unförmigkeit), die Schaffung von Kontrasten zwischen jüdischen und christlichen Darstellungen, und die Dehumanisierung von Juden durch Vergleiche mit Tieren (Schweine, Geier). Der Vergleich mit dem Geier wird im Detail erläutert, wobei die Assoziation von Gier und berechnender Gefühlslosigkeit hervorgehoben wird, die im „modernen Antisemitismus“ im Judenbild vereint sind. Der Vergleich mit dem Schwein wird im Kontext des jüdischen Speisegesetzes diskutiert. Des Weiteren wird die Rolle der bürgerlichen Gleichberechtigung der Juden und der daraus resultierenden Zunahme jüdischer Studenten und Akademiker als Auslöser von Judenhass thematisiert. Die Darstellung von Juden als „Halsabschneider“ und „Wucherer“ wird anhand von Beispielen aus den Postkarten erläutert.
Stereotypen in der Darstellung: Dieses Kapitel befasst sich mit den auf den Postkarten dargestellten Stereotypen. Es werden althergebrachte Stereotypen, die sich auf körperliche Merkmale und Sitten beziehen, beschrieben. Es wird die Funktion von Stereotypen als Mittel der Gruppeneinteilung und der schnellen, unfundierten Urteilsbildung erläutert.
Schlüsselwörter
Antisemitische Stereotypen, Postkarten, Kaiserzeit, Darstellungsmittel, Körperverzerrung, Dehumanisierung, Vorurteile, Judenfeindlichkeit, Medien, Propaganda, Gesellschaftliche Reaktionen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Arbeit "Inhaltsverzeichnis"?
Die Arbeit untersucht antisemitische Stereotypen auf Postkarten aus der Kaiserzeit, basierend auf der Postkartensammlung von Wolfgang Haney. Der Fokus liegt auf der alltäglichen Judenfeindlichkeit, ohne den modernen Antisemitismus umfassend zu behandeln.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die darstellerischen Mittel aufzuzeigen, mit denen antisemitische Stereotypen auf Postkarten der Kaiserzeit konstruiert wurden, ihre Intention zu beleuchten und die Reaktionen des jüdischen und nicht-jüdischen Publikums sowie staatlicher Institutionen zu analysieren.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Themenschwerpunkte sind: die Darstellung antisemitischer Stereotypen auf Postkarten der Kaiserzeit, die Analyse der verwendeten darstellerischen Mittel (Körperverzerrung, Dehumanisierung etc.), die Untersuchung der Intentionen hinter der Produktion und Verbreitung dieser Postkarten, die Behandlung der Reaktionen der Bevölkerung und staatlicher Stellen, sowie die Rolle der Medien bei der Tradierung von Vorurteilen.
Was untersucht das Kapitel "Darstellerische Mittel anhand von Bildbeispielen"?
Dieses Kapitel analysiert die typischen gestalterischen Mittel in den antisemitischen Postkarten, wie die Verwendung von Körperverzerrungen (übertriebene Nasen, Kleinwuchs, Unförmigkeit), die Schaffung von Kontrasten zwischen jüdischen und christlichen Darstellungen, und die Dehumanisierung von Juden durch Vergleiche mit Tieren (Schweine, Geier).
Was beinhaltet das Kapitel "Stereotypen in der Darstellung"?
Dieses Kapitel befasst sich mit den auf den Postkarten dargestellten Stereotypen. Es werden althergebrachte Stereotypen, die sich auf körperliche Merkmale und Sitten beziehen, beschrieben. Es wird die Funktion von Stereotypen als Mittel der Gruppeneinteilung und der schnellen, unfundierten Urteilsbildung erläutert.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Antisemitische Stereotypen, Postkarten, Kaiserzeit, Darstellungsmittel, Körperverzerrung, Dehumanisierung, Vorurteile, Judenfeindlichkeit, Medien, Propaganda, Gesellschaftliche Reaktionen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Stereotypenmuster auf antisemitischen Postkarten im deutschen Kaiserreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1568398