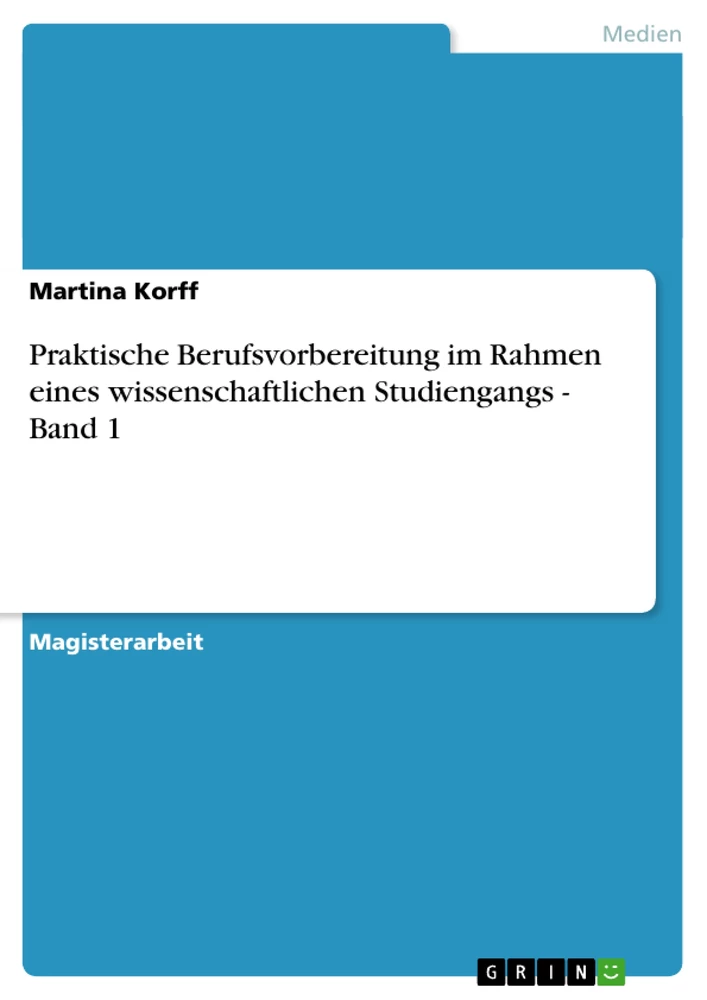„Kommunikationswissenschaft?! Was macht man denn damit?“ – wie oft musste
ich in den letzten fünf Jahren diese Frage beantworten. Inhalt und Nachdruck
meiner Antwort haben sich über die Jahre verändert: Am Anfang war es eher ein
unbeholfenes „Alles, was mit Kommunikation zu tun hat.“ Das „Glaube ich“
habe ich mir dazu gedacht. Nach dem dritten Semester, die Zeit meiner Zwischenprüfung,
stellte ich mir die Sinnfrage: „Nichts!“, „Bücher lesen und dumme
Theorien lernen!“ oder „Bald gar nichts mehr!“ war in diesem Moment der Verlorenheit
zwischen Erwartung und Realität aus meinem Mund zu hören. Ich
nutzte ein Auslandspraktikum, um mir darüber klar zu werden, ob ich überhaupt
weiter studieren werde, ob ich nicht lieber eine Ausbildung machen sollte,
endlich die Ärmel hochkrempeln und richtig was tun. Wie man sieht, habe ich
weitergemacht – und auch eine neue Antwort parat: „Professionell kommunizieren,
was denn sonst!?“.
Die Frage, was man mit dem gewählten Studium später einmal anfangen möchte
oder kann, muss jeder Student irgendwann beantworten. Tatsache ist, dass ein
Studium eine Station auf dem Weg in die Berufstätigkeit ist – die konkrete Stellung
allerdings, die es dabei einnimmt, hängt sowohl von dem persönlichen
Weg, als auch von (hochschul-) politischen, gesellschaftlichen und arbeitsmarktbezogenen
Faktoren ab.
So hat sich gerade im 19. und 20. Jahrhundert die Funktion der Hochschule einschneidend
verändert: von einer geistigen Bildungsinstitution für soziale Eliten
hat sie sich mittlerweile zu einem multifunktionalen Dienstleistungsunternehmen
entwickelt.1 Weitgehende Akademisierung der Berufswelt und die gleichzeitige
Vergesellschaftung der Wissenschaft machen eine immer stärkere Verzahnung
von Berufspraxis und Wissenschaft unumgänglich. Eine Folge davon ist,
dass berufsorientierte, wissenschaftlich basierte Ausbildung mittlerweile eine
zentrale Aufgabe der Hochschule beschreibt. Historie und gegenwärtige Konzeption
vor allem wissenschaftlicher Studiengänge stehen diesem Anspruch jedoch
derzeit noch entgegen. Gleichzeitig werden Stimmen laut, die sich deutlich gegen eine Koppelung wissenschaftlicher Ausbildung an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes
wenden.
Vor diesem Hintergrund, der im Laufe meiner Arbeit eingehend beleuchtet wird,
stellt sich die Frage, welche Rolle berufs- oder praxisorientierte Aspekte im Rahmen
eines wissenschaftlichen Studiengangs spielen und welche Erwartungen
damit verbunden sind.[...]
1Vgl.Schneekloth,Ulrich,Hochschulen,1990.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mehr Praxisbezug! Das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis
- Funktionswandel der Hochschulen
- Historische Aspekte zum Praxisbezug
- Vorgaben des Hochschulgesetzes
- „Praxisbezug“
- Motive für Praxisbezug
- Legitimation
- Weg in die Profession
- Marketing- und Motivationsargument
- Studentische Prioritäten
- Herausforderungen im Kontext von Praxisbezug
- Missachtung des Bildungsauftrages
- Fremde Kompetenzen
- Einzelinitiativen statt umfassender Studiumsreformen
- Instrumentalisierung
- Und zu guter Letzt: „Entthematisierung“?
- Fragmente einer Definition
- Fazit und Versuch einer Definition
- Hochschule als Qualifikationsinstanz
- Studiumskonzeptionen und -abschlüsse
- Ausbildung von Schlüsselqualifikationen
- Integration in wissenschaftliche Arbeit
- Praxisinitiativen, Simulationen und Praktika
- Kooperationen und Praxisveranstaltungen
- Zusammenfassung
- Angebotsformen
- Das Praxisreferat am IfKW
- Entstehung
- Entwicklung bis heute
- Finanzierung
- Kommunikation und Vermarktung
- Studien zum Praxisreferat
- 3 Studienperspektiven nach Reinhard Gawatz
- Der Funktionswandel der Hochschulen im Kontext von Praxisbezug
- Die Erwartungen von Kommunikationswissenschafts-Studierenden an ihren Studiengang und deren Bedeutung für die Berufsvorbereitung
- Die Akzeptanz des Praxisreferats als Instrument der Praxisorientierung am IfKW
- Die verschiedenen Studienperspektiven von Kommunikationswissenschafts-Studierenden und deren Einfluss auf das Verhältnis von Studium und Beruf
- Die Bedeutung des Bachelor-/Master-Systems für die Praxisorientierung im Kommunikationswissenschaftsstudium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Studierende der Kommunikationswissenschaft den Praxisbezug ihres Studiums wahrnehmen und welche Rolle das Praxisreferat am Institut für Kommunikationswissenschaft (IfKW) in diesem Kontext spielt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik „Praktische Berufsvorbereitung im Rahmen eines wissenschaftlichen Studiengangs“ ein und beleuchtet den Funktionswandel der Hochschulen im Kontext von Praxisbezug. Sie stellt verschiedene Motive für die Integration von Praxisbezug in den Studiengang sowie die damit verbundenen Herausforderungen dar.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Praxisreferat am IfKW, seiner Entstehung, Entwicklung und den verschiedenen Studien, die sich mit seiner Image- und Akzeptanzanalyse beschäftigt haben.
Das dritte Kapitel analysiert die 3 Studienperspektiven nach Reinhard Gawatz und deren Relevanz für die Berufsvorbereitung der Kommunikationswissenschafts-Studierenden.
Das vierte Kapitel beschreibt die Forschungsfragen und die Methodik der Untersuchung, die auf einer Studentenbefragung am IfKW basiert.
Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studentenbefragung, die sich mit den soziodemographischen Daten, der Studienentscheidung, dem Verhältnis von Studium und Beruf, dem Bachelor-/Master-System und der Wahrnehmung des Praxisreferats auseinandersetzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Praxisbezug, Berufsvorbereitung, Kommunikationswissenschaftsstudium, Praxisreferat, IfKW, Studentenbefragung, Studienperspektiven, Bachelor-/Master-System und Akzeptanz.
Häufig gestellte Fragen
Wie wichtig ist der Praxisbezug im Studium der Kommunikationswissenschaft?
Die Arbeit zeigt, dass eine Verzahnung von Wissenschaft und Praxis für die Berufsvorbereitung unumgänglich ist, da Hochschulen sich zunehmend zu Qualifikationsinstanzen für den Arbeitsmarkt entwickeln.
Was ist die Aufgabe des Praxisreferats am IfKW?
Das Praxisreferat dient als Schnittstelle zwischen Studenten und Berufsfeld. Es unterstützt bei Praktika, vermittelt Kontakte und bietet Praxisveranstaltungen zur Berufsorientierung an.
Welchen Einfluss hat das Bachelor-/Master-System auf die Praxisorientierung?
Die Umstellung auf Bachelor und Master verfolgte das Ziel einer stärkeren Arbeitsmarktorientierung, wird jedoch auch kritisch hinsichtlich der Verschulung und der Vernachlässigung des klassischen Bildungsauftrags diskutiert.
Was sind "Schlüsselqualifikationen" im Studium?
Dazu gehören fachübergreifende Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Zeitmanagement und professionelle Kommunikation, die neben dem theoretischen Wissen für den Berufseinstieg entscheidend sind.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Integration von Praxis in die Wissenschaft?
Kritiker warnen vor einer Instrumentalisierung der Wissenschaft durch den Arbeitsmarkt und einer "Entthematisierung" wissenschaftlicher Tiefe zugunsten reiner Anwendungskompetenz.
- Quote paper
- Martina Korff (Author), 2002, Praktische Berufsvorbereitung im Rahmen eines wissenschaftlichen Studiengangs - Band 1, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15693