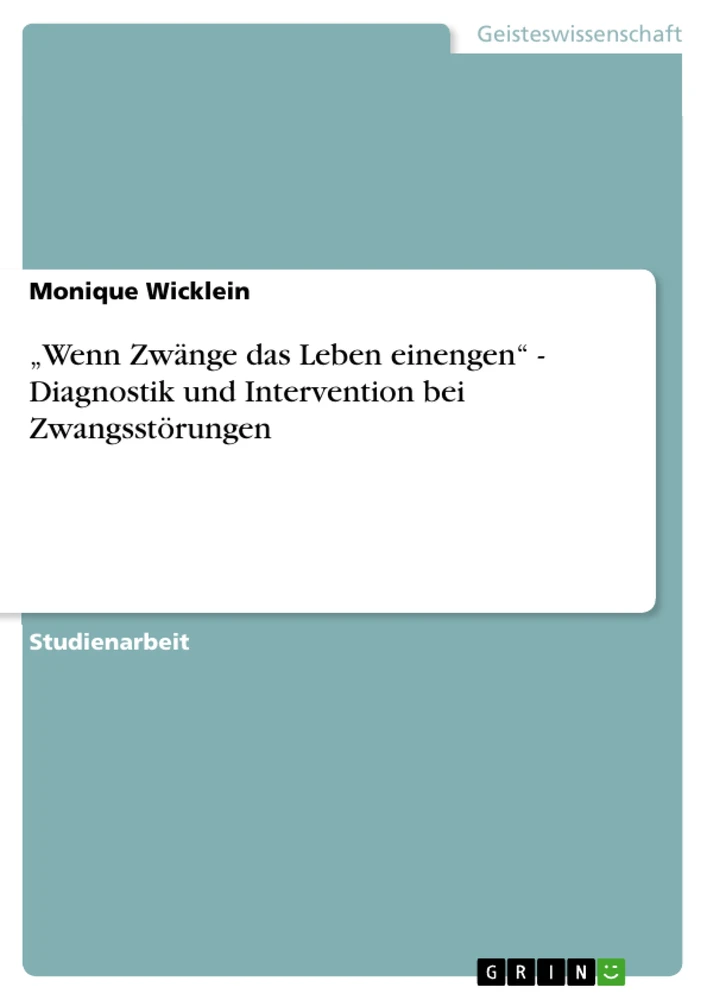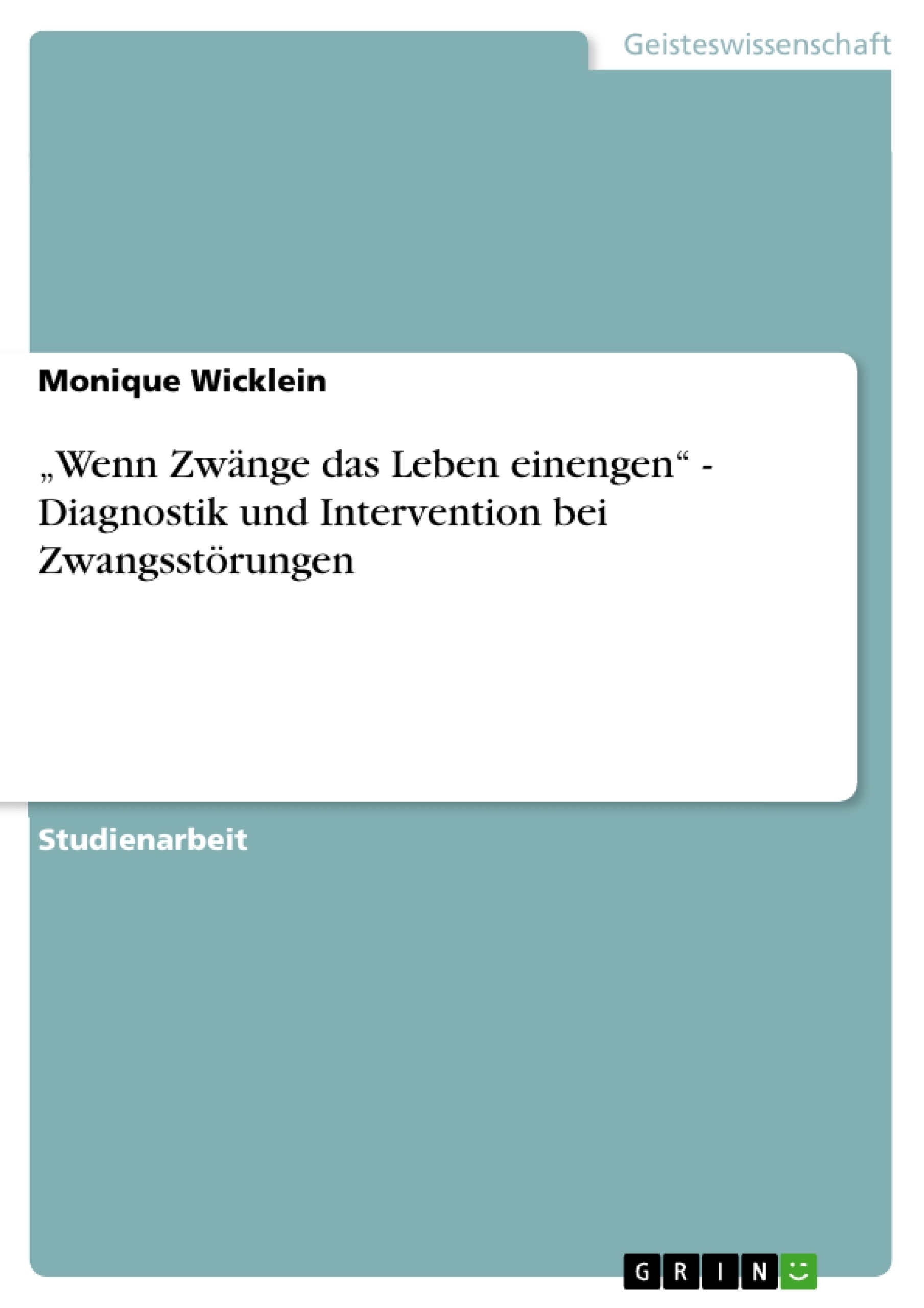Alle Menschen kennen harmlose Formen eines Zwangs, die man im Alltag immer wieder antreffen kann. So werden Dinge immer wieder in der gleichen Reihenfolge erledigt, nochmals geschaut, ob der Herd auch wirklich aus ist oder es wird vermieden, mit bestimmten Symbolen, welche Unglück bringen sollen, in Berührung zu kommen. Diese Gedanken und Handlungen kommen häufig vor, behindern allerdings das Alltagsgeschehen kaum. Anders ist es bei Menschen mit einer psychischen Störung – einer Zwangsstörung:
„Immer wieder kommt dieser Gedanke. Er ist einfach da. Ich kann nichts dagegen tun.“
„Ich schaue nach ob ich den Wasserhahn abgedreht habe. Bevor ich zum Einkaufen gegangen bin, habe ich das heute schon neunmal getan.“
„Ich kann meine Handlungen nicht abschalten. Ich habe keine Kontrolle. Ich weiß, dass es unnütz ist, aber ich tue es trotzdem.“
Diese oder andere Zitate kann man oft von Menschen mit Zwangsstörungen innerhalb ihrer Therapie hören. Negative Gedanken, die Angst und Unruhe auslösen, werden von Zwangspatienten immer wieder gedacht, oft wird die Angst durch Zwangshandlungen neutralisiert. Die Zwangsstörung zählt zu den häufigsten psychischen Störungen im Erwachsenenalter, wird aber dennoch von vielen Menschen als unverständlich betrachtet, da die meisten Ängste so unnötig scheinen, dass man sich nicht vorstellen kann, wie ein Mensch solch massive Angst vor dieser Sache entwickeln kann. Zwänge nehmen im Leben der Patienten einen zentralen Stellenwert ein, sodass der Alltag von vielen Zwangspatienten nicht mehr in seinem normalen Ablauf bewältigt werden kann. Der Zwang bestimmt den Tagesrhythmus und nimmt erheblich viele Stunden (wenn nicht gar den ganzen Tag) in Anspruch. Mittlerweile wurden effektive Möglichkeiten der Behandlung von Zwängen entwickelt, die in folgender Arbeit ebenso vorgestellt werden sollen, wie die Störung selbst. Die Ursachen für Zwangsstörungen sind (noch) nicht hinreichend genau geklärt, sodass auf diese nur spekulativ eingegangen werden kann. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf Diagnostik und Intervention liegen soll, wird diesen Punkten der meiste Inhalt gewidmet. In der Vergangenheit wurden zahlreiche diagnostische Methoden zur Feststellung einer Zwangsstörung entwickelt, die ebenso vorgestellt werden sollen, wie klinische Interviews oder Verhaltensbeobachtungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Vorgehensweise
- Definition und Diagnosekriterien
- Kriterien nach ICD-10
- Kriterien nach DSM-IV
- Zwangsgedanken und Zwangshandlungen
- Makro-Aspekte: Epidemiologie, Komorbidität, Verlauf
- Epidemiologie
- Komorbidität
- Verlauf
- Mögliche Ursachen
- Subtypen von Zwangsstörungen
- Diagnostik
- Probleme bei der Diagnosestellung
- Diagnostische Verfahren
- Klinische und strukturierte Interviews
- Verhaltensbeobachtung
- Differentialdiagnosen
- Problemanalyse
- Interventionsmöglichkeiten
- Pharmakologische Behandlung
- Verhaltenstherapie: Konfrontation und Reaktionsvermeidung
- Kognitive Therapie
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik der Zwangsstörungen und widmet sich insbesondere den Aspekten der Diagnostik und Intervention. Ziel ist es, die Komplexität dieser psychischen Störung aufzuzeigen und einen Einblick in die aktuellen diagnostischen Verfahren und Behandlungsmöglichkeiten zu bieten.
- Definition und Diagnosekriterien von Zwangsstörungen nach ICD-10 und DSM-IV
- Epidemiologie, Komorbidität und Verlauf von Zwangsstörungen
- Mögliche Ursachen von Zwangsstörungen
- Diagnostische Verfahren und Probleme bei der Diagnosestellung
- Interventionsmöglichkeiten wie Pharmakotherapie und Verhaltenstherapie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Vorgehensweise: Die Einleitung führt in die Thematik der Zwangsstörungen ein, indem sie alltägliche Formen von Zwangsphänomenen beleuchtet und die besondere Bedeutung von Zwangsstörungen im Leben von Betroffenen hervorhebt. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt den Schwerpunkt auf Diagnostik und Intervention.
- Definition und Diagnosekriterien: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Zwangsstörung und stellt die Diagnosekriterien nach ICD-10 und DSM-IV vor. Es werden die Unterscheidung zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen sowie deren Verknüpfung erläutert.
- Makro-Aspekte: Epidemiologie, Komorbidität, Verlauf: Das Kapitel beleuchtet wichtige Aspekte der Zwangsstörung im größeren Kontext. Es behandelt die Häufigkeit (Epidemiologie), das gleichzeitige Auftreten mit anderen Störungen (Komorbidität) und die Entwicklung der Störung über die Zeit (Verlauf).
- Mögliche Ursachen: Dieses Kapitel befasst sich mit den möglichen Ursachen von Zwangsstörungen, wobei zu betonen ist, dass diese bisher nicht vollständig geklärt sind. Die Arbeit legt den Fokus auf Diagnostik und Intervention, daher wird auf die Ursachen nur spekulativ eingegangen.
- Subtypen von Zwangsstörungen: Das Kapitel widmet sich verschiedenen Unterformen der Zwangsstörungen, wobei das genaue Spektrum nicht näher benannt wird.
- Diagnostik: Dieses Kapitel stellt die Diagnostik von Zwangsstörungen in den Mittelpunkt. Es behandelt Probleme bei der Diagnosestellung, verschiedene diagnostische Verfahren wie klinische Interviews und Verhaltensbeobachtungen sowie Differentialdiagnosen.
- Interventionsmöglichkeiten: Das Kapitel widmet sich den Behandlungsmöglichkeiten von Zwangsstörungen. Es werden pharmakologische Behandlungen sowie verhaltenstherapeutische Interventionen wie Konfrontation und Reaktionsvermeidung und kognitive Therapie vorgestellt.
Schlüsselwörter
Zwangsstörungen, Diagnostik, Intervention, ICD-10, DSM-IV, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, Epidemiologie, Komorbidität, Verlauf, Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie, Kognitive Therapie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Alltagszwängen und einer Zwangsstörung?
Während harmlose Alltagszwänge den Ablauf kaum behindern, nehmen Zwangsstörungen massiv Zeit in Anspruch, verursachen Leid und beeinträchtigen den normalen Tagesrhythmus erheblich.
Wie werden Zwangsstörungen diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt nach Kriterien des ICD-10 oder DSM-IV durch klinische Interviews, strukturierte Fragebögen und Verhaltensbeobachtungen.
Was sind Zwangsgedanken und Zwangshandlungen?
Zwangsgedanken sind sich aufdrängende, angstauslösende Ideen; Zwangshandlungen sind Rituale (z. B. Waschen, Prüfen), die ausgeführt werden, um diese Angst kurzfristig zu neutralisieren.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Effektiv sind vor allem die kognitive Verhaltenstherapie mit Konfrontation und Reaktionsvermeidung sowie eine begleitende pharmakologische Behandlung.
Was bedeutet Komorbidität bei Zwangsstörungen?
Es beschreibt das häufige gleichzeitige Auftreten der Zwangsstörung mit anderen psychischen Erkrankungen, wie Depressionen oder anderen Angststörungen.
- Citation du texte
- Monique Wicklein (Auteur), 2010, „Wenn Zwänge das Leben einengen“ - Diagnostik und Intervention bei Zwangsstörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156943