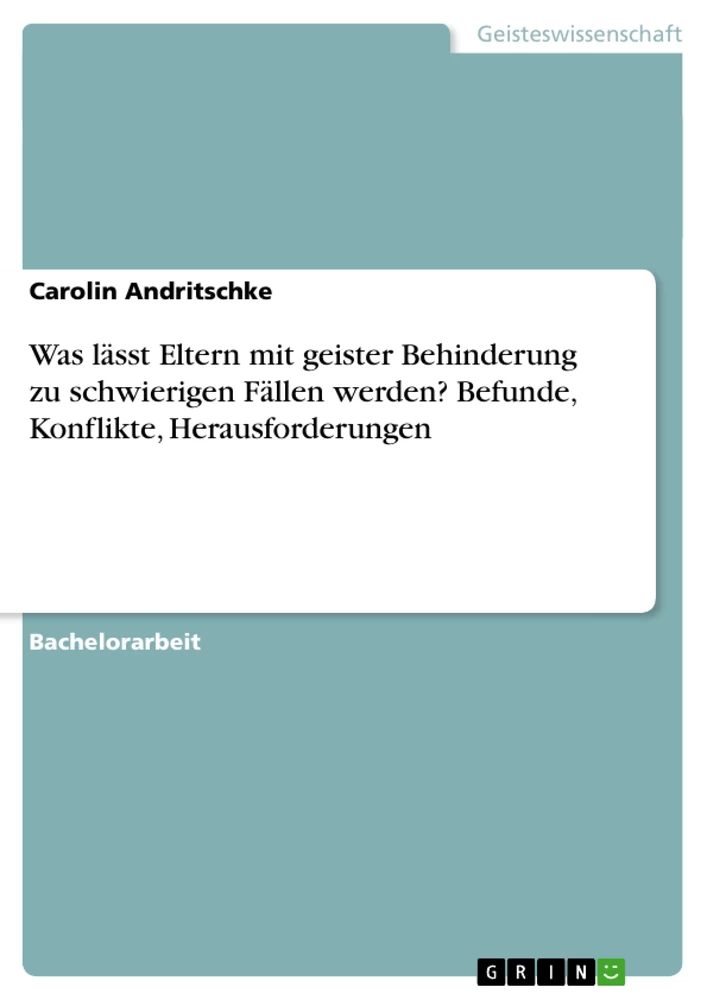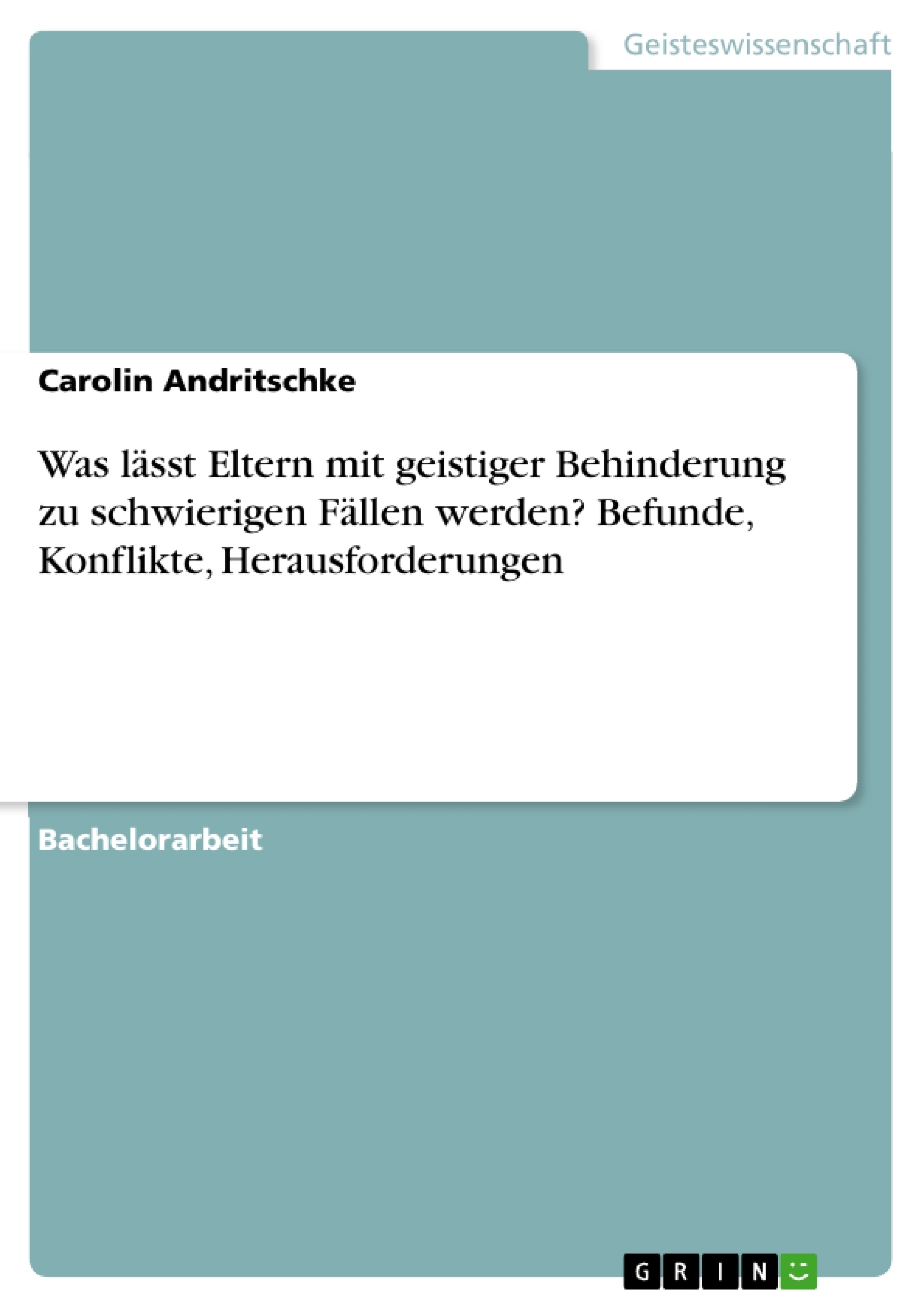Auf den ersten Blick scheinen die Begriffe Elternschaft und Familie Kennzeichen eines „normalen“ Lebenslaufes zu sein. Auf Grund der demographischen Entwicklung in Deutschland ist es sogar erwünscht Nachkommen zu zeugen, die dann die Fortführung des Generationsvertrages gewährleisten. In Verbindung mit geistiger Behinderung scheinen Elternschaft und Familie jedoch das Gegenteil zu sein: unerwünscht, paradox.
on einer solchen Sichtweise konnte ich mich während meines Fremdpraktikums im JA (Jugendamt) selbst überzeugen. Meine Beobachtungen und Erfahrungen mündeten schließlich in der Frage, was Eltern mit geistiger Behinderung sowie deren Kinder offenkundig zu schwierigen Fällen werden lässt. Wertvolle Anregungen hierzu fand ich unter anderem in dem überaus instruktiven Buch von S. Ader „Was leitet den Blick? Wahrnehmung, Deutung und Intervention in der Jugendhilfe“.
Die vorliegende Bachelorarbeit greift einige Kerngedanken, Untersuchungsergebnisse sowie Untersuchungsmethoden auf und konkretisiert diese im Hinblick auf die Elternschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung. Die zentrale Fragestellung lautet: Was lässt Eltern mit geistiger Behinderung sowie deren Kinder zu schwierigen Fällen werden, welche Risikofaktoren haben Anteil an diesen Fallverläufen und welche Konflikte und Herausforderungen ergeben sich für die Soziale Arbeit.
Um diese komplexe Fragestellung beantworten zu können, widmet sich das zweite Kapitel zunächst der Diskussion um die Begriffe „geistige Behinderung“ und „Lernbehinderung“ so-wie „elterliche Kompetenz“. Im Zentrum steht dabei das PSM (Parental Skills Model), vor dessen Hintergrund ausführlich die gängigen Mythen über Eltern mit geistiger Behinderung diskutiert werden.
Anknüpfend an diese Ausführungen beschäftigt sich das darauffolgende Kapitel mit dem methodischen Zugang zum Einzelfall. Zunächst gibt das dritte Kapitel einen kurzen Einblick in die Forschungsmethode der Aktenanalyse. Im Anschluss werden die Kennzeichen schwieriger Fallverläufe in Form von Risikofaktoren im Hilfe- und Klientensystem beleuchtet. Diese Ausführungen bilden die Grundlage für das vierte Kapitel, in welchem mittels Analyse der Jugendhilfeakten herausgestellt werden soll, wie aus Familie Schulz ein schwieriger Fall wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Elternschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 2.1 Geistige Behinderung und Lernbehinderung
- 2.1.1 Begriffsbestimmung geistige Behinderung
- 2.1.1.1 Ursachen
- 2.1.1.2 Soziologische Sichtweise
- 2.1.1.3 Die ICD-10
- 2.1.2 Einordnung der Lernbehinderung
- 2.2 Kennzeichen elterlicher Kompetenz
- 2.2.1 Das Parental Skills Model
- 2.2.1.1 Lebenspraktische Fähigkeiten
- 2.2.1.2 Familiärer Hintergrund
- 2.2.1.3 Zugang zu Unterstützungsmöglichkeiten
- 2.2.1.4 Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung
- 2.2.2 Das erweiterte Parental Skills Model
- 2.3 Vorurteile gegenüber der Elternschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 2.3.1 Vererbung der geistigen Behinderung
- 2.3.2 Hohe Kinderzahl
- 2.3.3 Missbrauch der Kinder
- 2.3.4 Vernachlässigung der Kinder
- 2.3.5 Unangemessenes Elternverhalten
- 3. Methodischer Zugang zum Fall
- 3.1 Grundlagen der Aktenanalyse
- 3.2 Kennzeichen „schwieriger“ Fälle – Risikofaktoren
- 3.2.1 Risikofaktoren im Hilfesystem
- 3.2.1.1 Mangelnde Kooperation der Hilfesysteme
- 3.2.1.1.1 Kooperation zwischen den Hilfesystemen
- 3.2.1.1.2 Kooperation innerhalb der Hilfesysteme
- 3.2.1.2 Dominanz der Interessen der Hilfesysteme
- 3.2.1.2.1 Minimaler Eingriff
- 3.2.1.2.2 Ausgrenzung
- 3.2.1.2.3 Orientierung an verfügbaren Hilfen
- 3.2.1.2.4 Kurzsichtigkeit
- 3.2.1.3 Mangelnde Selbstreflexion
- 3.2.1.4 Symptomorientierung
- 3.2.1.5 Unreflektierte Identifikation mit dem Klientensystem
- 3.2.1.6 Ausblendung des „subjektiven Faktors“
- 3.2.1.7 Fehlende Partizipation der Klienten
- 3.2.1.8 Mangelnde Fachlichkeit
- 3.2.2 Risikofaktor „geistige Behinderung der Eltern“?
- 4. Wie aus Familie Schulz ein schwieriger Fall wurde – Analyse der Jugendhilfeakten
- 4.1 Überblick über den Hilfeverlauf
- 4.2 Darstellung und Analyse der Lebens- und Hilfegeschichte
- 4.2.1 Familiärer Hintergrund der Kindesmutter
- 4.2.2 Beginn und Verlauf der ersten Hilfe (11/2001 bis 02/2004)
- 4.2.2.1 Der erste Hilfeplan: Beginn der Hilfe
- 4.2.2.2 Der zweite Hilfeplan: Reflexion und Konkretisierung
- 4.2.2.3 Der dritte Hilfeplan: Konflikte und Krisen
- 4.2.2.4 Der vierte Hilfeplan: Fortführung der Hilfe
- 4.2.2.5 Der fünfte Hilfeplan: Wechsel der Familienhelfer
- 4.2.2.6 Der sechste Hilfeplan: neuer Helfer neue Ängste
- 4.2.2.7 Die Geburt des zweiten Kindes
- 4.2.3 Änderung der Hilfeart und Umzug (02/2004 bis 06/2004)
- 4.2.3.1 Gründe für die stationäre Betreuung der Familie
- 4.2.3.2 Beginn der stationären Hilfe (03/2004)
- 4.2.3.3 Abbruch der Hilfe von Seiten der Kindesmutter
- 4.2.3.4 Erneute Aufnahme der Familie in die Einrichtung
- 4.2.4 Das Leben in B-Stadt (07/2004 bis 02/2006)
- 4.2.4.1 Die sozialstrukturelle Situation im Hilfeverlauf
- 4.2.4.2 Die Familiensituation
- 4.2.4.2.1 Die Entwicklung der Tochter
- 4.2.4.2.2 Die Entwicklung des Sohnes
- 4.2.4.3 Das soziale Umfeld der Familie
- 4.2.4.4 Ressourcen der Kindesmutter
- 4.2.5 Umzug und Leben in E-Stadt (03/2006 bis 07/2007)
- 4.2.5.1 Familiendiagnose
- 4.2.5.2 Der erste Hilfeplan in E-Stadt
- 4.2.5.3 Fortführung der Hilfe im Haushalt des Vaters
- 4.2.5.4 Fortführung der Hilfe in der neuen Wohnung
- 4.2.5.5 Antrag auf Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf das Jugendamt
- 4.2.5.6 Vorbereitung eines erneuten Umzuges
- 4.2.6 Umzug und Leben in A-Stadt (07/2007 bis 02/2008)
- 4.2.6.1 Beginn der neuen Hilfe
- 4.2.6.2 Die ersten Wochen in der neuen Wohnung
- 4.2.6.3 Der weitere Verlauf der Hilfe (12/2007 bis 02/2008)
- 4.2.6.3.1 Die Wohnsituation
- 4.2.6.3.2 Die Lebenssituation der Kindesmutter
- 4.2.6.3.3 Die Beziehung der Kindesmutter zum Partner
- 4.2.6.3.4 Die Situation der Kinder
- 4.2.6.3.5 Das Hilfeplangespräch
- 4.2.7 Zuspitzung des Hilfeverlaufs und Eskalation (03/2008 bis 06/2008)
- 4.2.7.1 Der Hilfeverlauf bis 05/2008
- 4.2.7.1.1 Die alltägliche Lebensführung
- 4.2.7.1.2 Soziales Netzwerk
- 4.2.7.1.3 Psychische Belastungen
- 4.2.7.2 Abbruch der Hilfe von Seiten des Trägers (06/2008)
- 4.2.7.2.1 Gründe für den Abbruch der Hilfe
- 4.2.7.2.2 Klärung der Perspektive der Familie
- 4.2.8 Das Leben der Familie seit 07/2008
- 4.2.8.1 Die Entwicklung der Tochter
- 4.2.8.2 Die Entwicklung des Sohnes
- 4.3 Ergebnisse der Analyse
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Herausforderungen und Komplexitäten der Elternschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung anhand eines Fallbeispiels. Ziel ist es, die im Hilfesystem auftretenden Probleme und Risikofaktoren zu identifizieren und zu diskutieren. Der Fokus liegt auf der Analyse eines konkreten Falls und der kritischen Betrachtung des Umgangs mit solchen Familien durch das Jugendhilfesystem.
- Elterliche Kompetenz bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Vorurteile und Diskriminierung im Kontext der Elternschaft
- Risikofaktoren im Jugendhilfesystem und deren Auswirkungen
- Analyse eines konkreten Fallbeispiels aus der Jugendhilfe
- Möglichkeiten der Unterstützung und Förderung von Familien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Elternschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung ein und skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext von Inklusion und sozialer Gerechtigkeit hervorgehoben und der methodische Ansatz der Fallstudie begründet.
2. Elternschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung: Dieses Kapitel beleuchtet die Begriffsbestimmung von geistiger und Lernbehinderung, unter Berücksichtigung der ICD-10 Klassifikation und soziologischer Perspektiven. Es werden verschiedene Modelle elterlicher Kompetenz vorgestellt (Parental Skills Model und erweiterte Version), die die relevanten Faktoren für erfolgreiche Elternschaft analysieren, wie Lebenspraktische Fähigkeiten, familiärer Hintergrund und Zugang zu Unterstützungsmöglichkeiten. Weiterhin werden weit verbreitete Vorurteile gegenüber Eltern mit geistiger Behinderung kritisch beleuchtet, wie etwa die Befürchtung von Vererbung, hoher Kinderzahl, Missbrauch oder Vernachlässigung.
3. Methodischer Zugang zum Fall: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Grundlagen der durchgeführten Aktenanalyse. Es werden die spezifischen Herausforderungen der Analyse von Jugendhilfeakten erörtert und die verwendeten Kriterien zur Identifizierung von "schwierigen" Fällen und Risikofaktoren im Hilfesystem detailliert dargelegt. Besonderes Augenmerk liegt auf den systemischen Aspekten, wie mangelnde Kooperation, Dominanz der Interessen des Hilfesystems, fehlende Selbstreflexion und unzureichende Partizipation der Klienten.
4. Wie aus Familie Schulz ein schwieriger Fall wurde – Analyse der Jugendhilfeakten: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse des Hilfeverlaufs der Familie Schulz. Es werden die verschiedenen Phasen der Hilfe, von den ersten Hilfeplänen bis hin zur Zuspitzung der Situation, chronologisch nachvollzogen und kritisch analysiert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Interaktionen zwischen der Familie, dem Jugendhilfesystem und den beteiligten Akteuren. Die Analyse umfasst den familiären Hintergrund der Mutter, den Verlauf der Hilfen, die Veränderungen der Lebenssituation der Familie, sowie die sozialen, psychischen und strukturellen Faktoren, die zum "schwierigen Fall" beigetragen haben. Es werden die jeweiligen Hilfepläne im Detail beleuchtet, um die Entscheidungen und Maßnahmen des Jugendhilfesystems nachzuvollziehen und zu bewerten.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Lernbehinderung, Elternschaft, Jugendhilfe, Hilfesystem, Risikofaktoren, Aktenanalyse, Fallstudie, Parental Skills Model, Vorurteile, Inklusion, soziale Teilhabe, Familiendiagnose, Hilfeplanung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Elternschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung - Analyse eines Fallbeispiels
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Herausforderungen und Komplexitäten der Elternschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung anhand eines konkreten Fallbeispiels (Familie Schulz). Sie untersucht die im Hilfesystem auftretenden Probleme und Risikofaktoren und beleuchtet kritisch den Umgang des Jugendhilfesystems mit solchen Familien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die elterliche Kompetenz bei Menschen mit geistiger Behinderung, Vorurteile und Diskriminierung in diesem Kontext, Risikofaktoren im Jugendhilfesystem und deren Auswirkungen, sowie Möglichkeiten der Unterstützung und Förderung betroffener Familien. Die Begriffsbestimmung von geistiger und Lernbehinderung (inkl. ICD-10) und verschiedene Modelle elterlicher Kompetenz (Parental Skills Model) werden ebenfalls erläutert.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer detaillierten Aktenanalyse des Fallbeispiels Familie Schulz. Die Methodik beschreibt die Herausforderungen der Aktenanalyse und die Kriterien zur Identifizierung von "schwierigen" Fällen und Risikofaktoren im Hilfesystem. Systemische Aspekte wie mangelnde Kooperation, Dominanz der Interessen des Hilfesystems und fehlende Partizipation der Klienten werden besonders berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Elternschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung (inkl. Begriffsbestimmung, Modelle elterlicher Kompetenz und Vorurteile), Methodischer Zugang zum Fall (Aktenanalyse), Analyse des Fallbeispiels Familie Schulz (detaillierter chronologischer Verlauf der Hilfen, Analyse der Interaktionen zwischen Familie und Jugendhilfesystem), und Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Fallstudie Familie Schulz?
Die Fallstudie Familie Schulz zeigt detailliert den komplexen und langwierigen Hilfeverlauf einer Familie, in der die Mutter eine geistige Behinderung hat. Die Analyse beleuchtet die Interaktionen zwischen der Familie, dem Jugendhilfesystem und den beteiligten Akteuren, und identifiziert verschiedene Faktoren, die zu einer Eskalation der Situation beigetragen haben. Diese Faktoren umfassen u.a. mangelnde Kooperation im Hilfesystem, fehlende Selbstreflexion, und unzureichende Berücksichtigung der Bedürfnisse der Familie.
Welche Risikofaktoren im Hilfesystem werden identifiziert?
Die Arbeit identifiziert verschiedene Risikofaktoren im Hilfesystem, wie mangelnde Kooperation zwischen und innerhalb der Hilfesysteme, Dominanz der Interessen des Hilfesystems (Minimaler Eingriff, Ausgrenzung, Orientierung an verfügbaren Hilfen, Kurzsichtigkeit), mangelnde Selbstreflexion, Symptomorientierung, unreflektierte Identifikation mit dem Klientensystem, Ausblendung des „subjektiven Faktors“, fehlende Partizipation der Klienten und mangelnde Fachlichkeit.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit verdeutlicht die komplexen Herausforderungen bei der Unterstützung von Familien, in denen ein Elternteil eine geistige Behinderung hat. Sie betont die Notwendigkeit einer verbesserten Kooperation im Hilfesystem, einer stärkeren Fokussierung auf die Bedürfnisse der Familien und einer umfassenderen Berücksichtigung der Ressourcen und Stärken der betroffenen Eltern. Die kritische Reflexion der eigenen Rolle im Hilfesystem und eine verbesserte Partizipation der Familien sind ebenfalls zentrale Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter: Geistige Behinderung, Lernbehinderung, Elternschaft, Jugendhilfe, Hilfesystem, Risikofaktoren, Aktenanalyse, Fallstudie, Parental Skills Model, Vorurteile, Inklusion, soziale Teilhabe, Familiendiagnose, Hilfeplanung.
- Citation du texte
- Carolin Andritschke (Auteur), 2009, Was lässt Eltern mit geistiger Behinderung zu schwierigen Fällen werden? Befunde, Konflikte, Herausforderungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156991