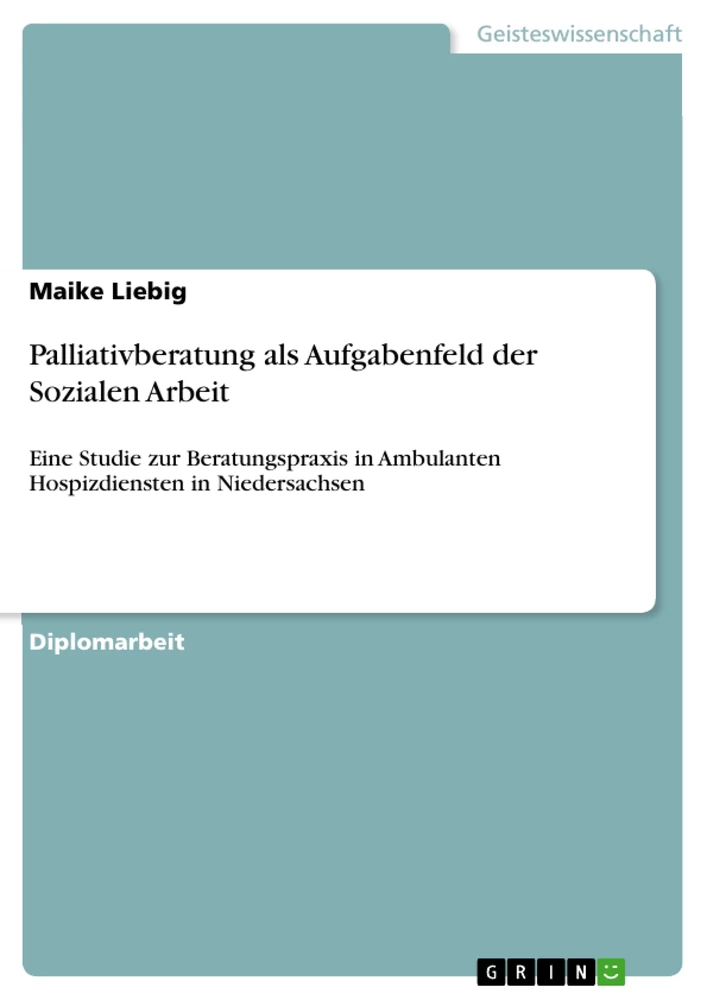In der Hospizarbeit, speziell in der Palliativberatung, soll laut Definition der WHO und den Standards des Dachverbands Hospiz (angelehnt an die Standards des Dachverbandes Hospiz Österreich) sozialpädagogisch beraten werden. Tatsächlich können dies aber bisher nur wenige Ambulante Hospizdienste leisten.
Bundesweit wird von dem Missstand gesprochen, dass die Palliativversorgung in Niedersachsen den Bedarf nicht abdecken kann (vgl. Buser/ Amelung 2004). Palliativstationen in Krankenhäusern und institutionenübergreifende Palliativstützpunkte befinden sich im Aufbau. Das Ministerium für Familie, Frauen, Gesundheit und Soziales hat ein reges Interesse an der Weiterentwicklung der Palliativlandschaft in Deutschland. Ebenso involviert in die Diskussion sind deutsche Hochschulen, die um angemessene Ausbildungsstandards in Medizin und Sozialpädagogik bemüht sind.
Jedoch fehlen gesetzliche Grundlagen, anhand derer eine Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche vorgenommen werden könnte. In Deutschland existieren bislang keine Standards, nach denen Palliativsozialarbeit sich richten kann. Dies wird im Kontext von Sozialer Arbeit in Hospiz und Palliative Care diskutiert und besteht demzufolge in der Sozialpädagogik als ein Teilbereich der Sozialen Arbeit.
In Bezug auf die Soziale Arbeit in Palliative Care gibt es bereits einige wenige Publikationen, die sich zumeist mit dem weiten Feld der Hospizarbeit auseinandersetzen und wenig konkret werden. Zudem finden sich diese oft im Rahmen von Sammelbänden zu Palliative Care als Unterkapitel wieder. Auch die Forschung hat sich bis jetzt diesem Thema wenig angenommen: Zumeist handelt es sich um Studien zu Belastungsfaktoren und Copingstrategien im Kontext von Palliative Care, wobei vor allem die Psychologie als forschende Disziplin eine Vorreiterposition vor der Sozialen Arbeit eingenommen hat.
Die Bedeutung der von mir erstellten Studie liegt demnach vor allem in ihrer Aktualität. Sie ist thematisch eingebettet in die aktuelle Diskussion um Palliativmedizin und Palliativberatung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ambulante Palliativberatung
- Der Palliative Kontext: Definitionen und Begriffsklärungen zum Konzept von Palliative Care
- Inhalte, Ziele und gesetzliche Grundlage der Palliativberatung in Niedersachsen
- Die Palliative Care Ausbildung
- Das interdisziplinäre Team
- Rolle, Bedeutung und Aufgaben der Sozialen Arbeit in der Palliativberatung
- Zur Bedeutung der psychosozialen Beratung in der Palliativberatung
- Sterben und Tod als kritisches Lebensereignis
- Aufgaben und Inhalte der Sozialpädagogischen Beratung in der Palliativberatung
- Diagnose und Hilfeplanung
- Symptome und ihr pädagogischer Auftrag
- Arbeit mit der Familie und Bezugspersonen
- Ethische und sozialrechtliche Beratung
- Trauer und Trauerarbeit
- Weitere Aufgaben im Rahmen der Palliativberatung
- Methodische Arbeitsansätze in der Palliativberatung
- Beratungsansätze
- Exkurs Ressourcenorientierung, Empowerment und Care-Case-Management
- Kompetenz der SozialpädagogInnen in der Palliativberatung
- Kompetenz in der Palliativberatung
- Grenzerfahrungen, Konfliktfelder und spezifische Berufsprobleme
- Studie zur aktuellen Beratungspraxis in Ambulanten Hospizdiensten in Niedersachen
- Quantitative Forschungsmethoden in den Sozialwissenschaften und die Auswahl der Methode
- Hypothesengewinnung und Theoriebildung
- Forschungskontext
- Hypothesenbildung
- Fragebogen
- Forschungsdesign
- Untersuchungsmethode
- Ergebnisse der Studie
- Beschreibung der Untersuchungsgruppe
- Fragestellung 2: Inhaltliche Schwerpunkte während der letzten Palliativberatung mit PatientInnen
- Fragestellung 3: Was zählen Sie zu Ihren Aufgaben?
- Fragestellung 4: Wie häufig führen Sie folgende Aufgaben aus?
- Vergleich der Fragestellungen 3 und 4
- Fragestellungen 11 und 13
- Hypothesenprüfung
- Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die aktuelle Beratungspraxis in ambulanten Hospizdiensten in Niedersachsen mit dem Fokus auf die Rolle der Sozialen Arbeit in der Palliativberatung. Die Arbeit analysiert die Aufgaben, Inhalte und Herausforderungen der sozialpädagogischen Beratung im Kontext der Palliativversorgung.
- Die Bedeutung der psychosozialen Beratung in der Palliativberatung
- Die spezifischen Aufgaben und Inhalte der Sozialpädagogischen Beratung
- Die methodischen Arbeitsansätze in der Palliativberatung
- Die Kompetenzen von SozialpädagogInnen in der Palliativberatung
- Die Ergebnisse einer empirischen Studie zur aktuellen Beratungspraxis in ambulanten Hospizdiensten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Palliativberatung und die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext ein. Sie erläutert die Bedeutung der Arbeit und die Forschungsfragen, die in dieser Diplomarbeit behandelt werden.
- Kapitel 1 definiert den Begriff der Palliativberatung und erläutert den palliativen Kontext. Es werden die Inhalte, Ziele und die gesetzliche Grundlage der Palliativberatung in Niedersachsen beleuchtet, sowie die Palliative Care Ausbildung und das interdisziplinäre Team im Kontext der Palliativversorgung.
- Kapitel 2 analysiert die Rolle, Bedeutung und Aufgaben der Sozialen Arbeit in der Palliativberatung. Es werden die Bedeutung der psychosozialen Beratung im Kontext des Sterbens und Todes sowie die spezifischen Aufgaben und Inhalte der Sozialpädagogischen Beratung detailliert dargestellt.
- Kapitel 3 befasst sich mit den methodischen Arbeitsansätzen in der Palliativberatung und beleuchtet verschiedene Beratungsansätze und deren Anwendung in der Praxis.
- Kapitel 4 untersucht die Kompetenzen von SozialpädagogInnen in der Palliativberatung und analysiert spezifische Herausforderungen und Konflikte im Arbeitsalltag.
- Kapitel 5 beschreibt die empirische Studie, die durchgeführt wurde, um die aktuelle Beratungspraxis in ambulanten Hospizdiensten in Niedersachsen zu untersuchen. Die Studie beinhaltet die Auswahl der Forschungsmethode, die Hypothesenbildung und das Forschungsdesign.
- Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Studie und analysiert die Daten aus den Fragebögen, die an SozialpädagogInnen in ambulanten Hospizdiensten in Niedersachsen versandt wurden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Palliativberatung, Soziale Arbeit, Hospiz, Palliative Care, psychosoziale Beratung, Sterben und Tod, Trauerarbeit, Beratungskompetenz, empirische Studie, ambulante Hospizdienste, Niedersachsen.
- Citation du texte
- Maike Liebig (Auteur), 2007, Palliativberatung als Aufgabenfeld der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156998