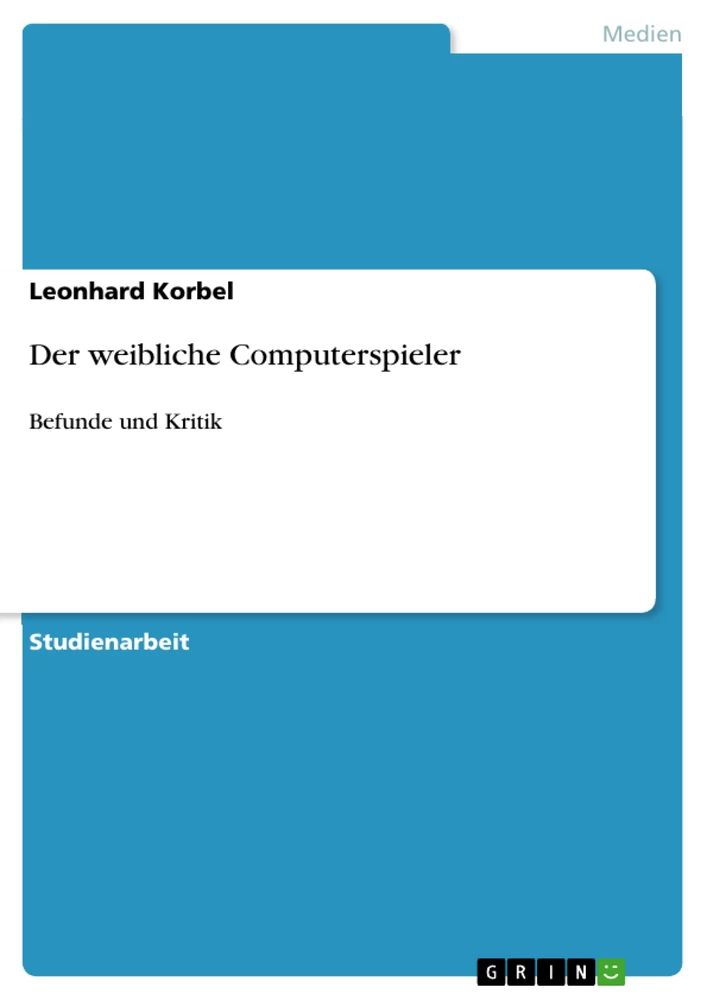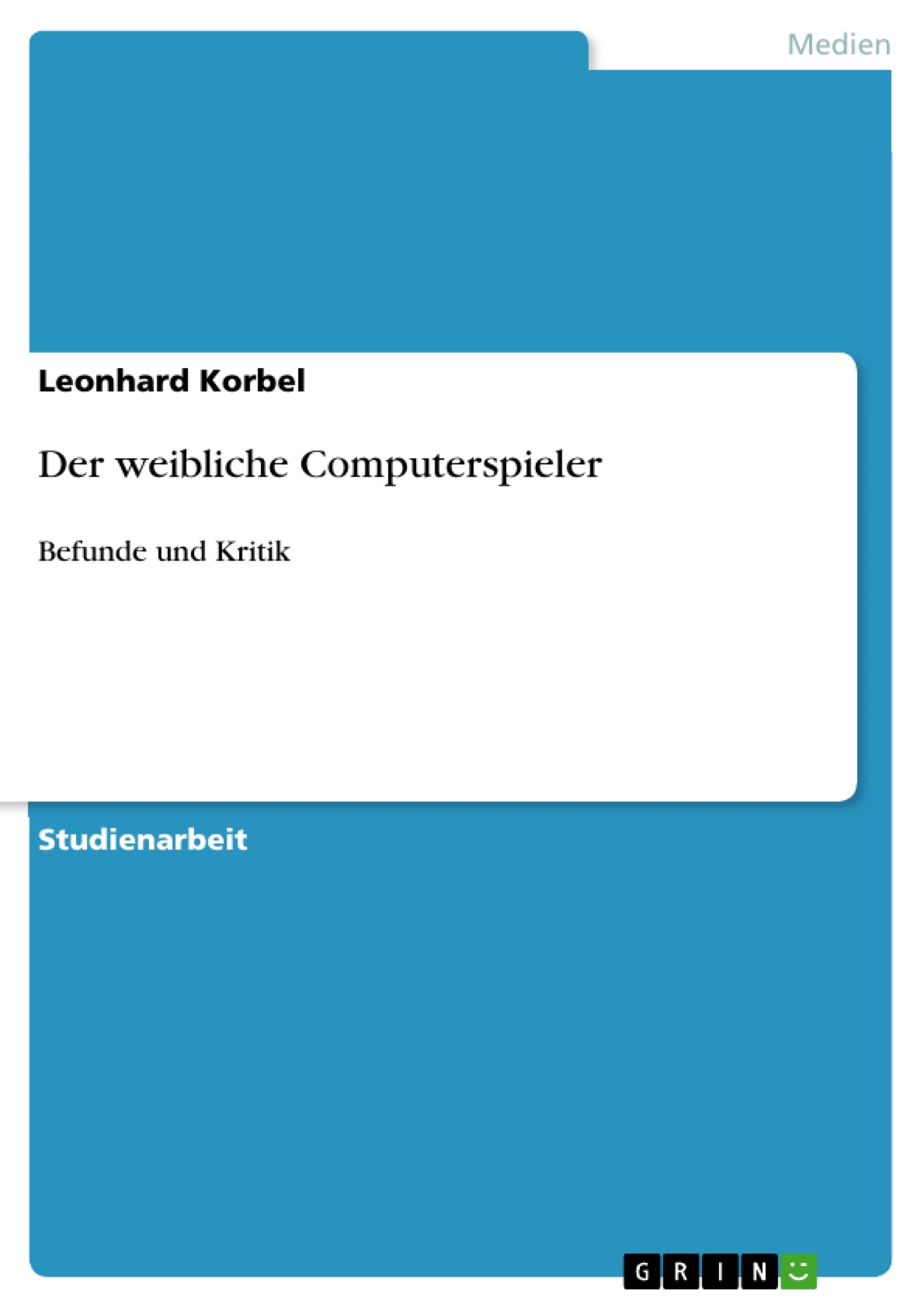Jungen und Männer spielen häufiger und länger als Mädchen und Frauen. Als Erklärung für diese Unterschiede werden häufig Spielinhalte herangezogen, von denen angenommen wird, dass sie auf ein männliches Publikum ausgerichtet sind und von einer weiblichen Spielerschaft abgelehnt werden (Kapitel 2). Doch reichen inhaltliche Aspekte nicht aus, um die scheinbaren Geschlechtsunterschiede zu begründen. Aspekte der Sozialisation und der bislang angewandten Forschungsmethodik sind dabei zu bedenken.
In der vorliegenden Arbeit soll gezeigt werden, dass Geschlechtsunterschiede in Untersuchungsergebnissen der Spieleforschung mit Vorsicht zu genießen sind. Stereotypisierungen in Forschung, Industrie und Gesellschaft führen dazu, dass man von
festen männlichen und weiblichen Interessen ausgeht, die auch durchaus von Kindern internalisiert worden sein können.
Eine Unterscheidung von Spielern allein aufgrund ihres Geschlechts ist jedoch nicht ausreichend und macht ein differenzierteres Bild von Spielerpersönlichkeiten, ihren Interessen und ihren Motivationen erforderlich. Auch über den Bereich der Spiele hinaus wäre es wünschenswert, wenn gesamtgesellschaftlich mehr Wert
auf Diversifikation gelegt werden würde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1: Die Erzeugung von Geschlechtsunterschieden durch Forschung, Industrie und Gesellschaft
- 1.1 Mangelnde Differenzierungen in Forschung und Industrie
- 1.2 Eine konservative Industrie im Wandel?
- 1.3 Die Sozialisierung von Frauen in Bezug auf Computer(spiele)
- Kapitel 2: Die Präferenzen weiblicher Spieler
- 2.1 Bevorzugte Genres
- 2.2 Realistische Settings
- 2.3 Vielfältige Handlungsoptionen
- 2.4 Kommunikation
- 2.5 Kooperation
- 2.6 Einstieg, Bedienung und Schwierigkeitsgrad
- 2.7 Belohnungen und Bestrafungen
- 2.8 Gewalt
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die vermeintlichen Unterschiede im Spielverhalten zwischen Frauen und Männern im Kontext von Computerspielen. Sie analysiert die Ursachen für diese Unterschiede und hinterfragt die Gültigkeit der traditionellen Forschungsansätze in diesem Bereich. Dabei werden sowohl die Einflüsse der Spieleindustrie als auch die Rolle der Sozialisation in den Fokus genommen.
- Kritische Analyse der Geschlechterstereotypisierung in Forschung, Industrie und Gesellschaft
- Untersuchung der Präferenzen von weiblichen Spielern
- Hinterfragung der Determiniertheit von Spielvorlieben durch biologisches Geschlecht
- Diskussion der Rolle der Sozialisation bei der Ausbildung von Spielpräferenzen
- Analyse der „Pink Games" und deren Einfluss auf die Wahrnehmung von weiblichen Spielern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und führt in die Thematik ein. Kapitel 1 analysiert die Ursachen für die vermeintlichen Geschlechtsunterschiede im Spielverhalten. Es zeigt auf, wie Forschung, Industrie und Gesellschaft die Geschlechter stereotypisieren und wie dies zu einer Verzerrung der Realität führt. Kapitel 2 beleuchtet die Präferenzen von weiblichen Spielern und hinterfragt die Annahme, dass diese ausschließlich von stereotypen Faktoren wie Kommunikation und Kooperation geprägt seien.
Schlüsselwörter
Computerspiele, Geschlechtsunterschiede, Spielverhalten, Sozialisation, Stereotypisierung, Pink Games, Game Grrlz, Casual Games, Online-Spiele, Forschung, Industrie, Gender, Medien
- Citar trabajo
- Magister Leonhard Korbel (Autor), 2008, Der weibliche Computerspieler, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157006