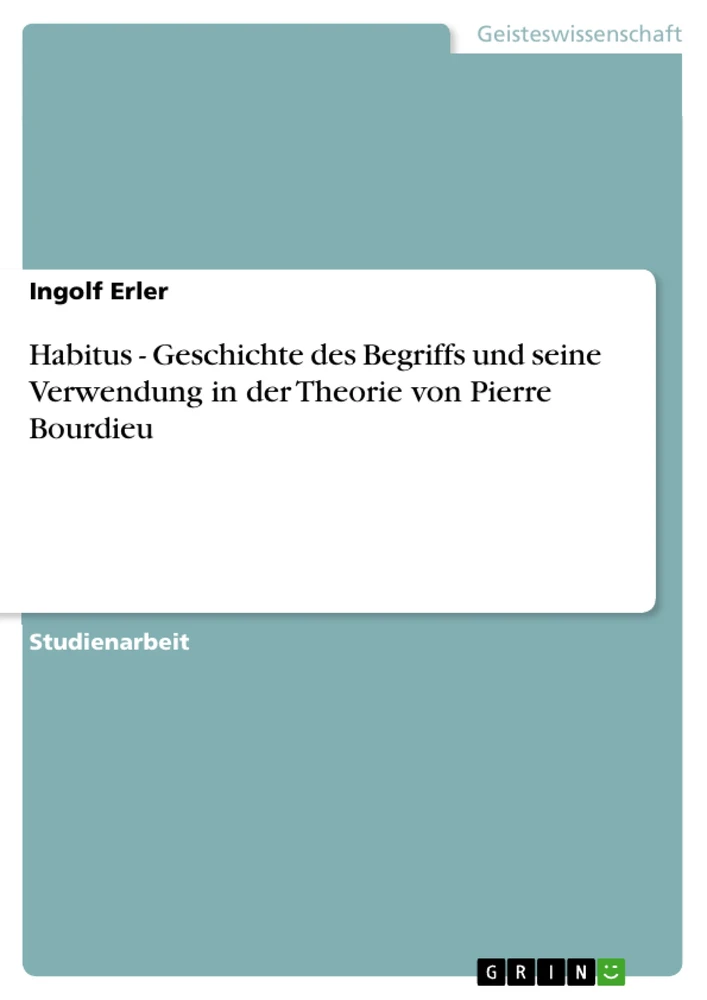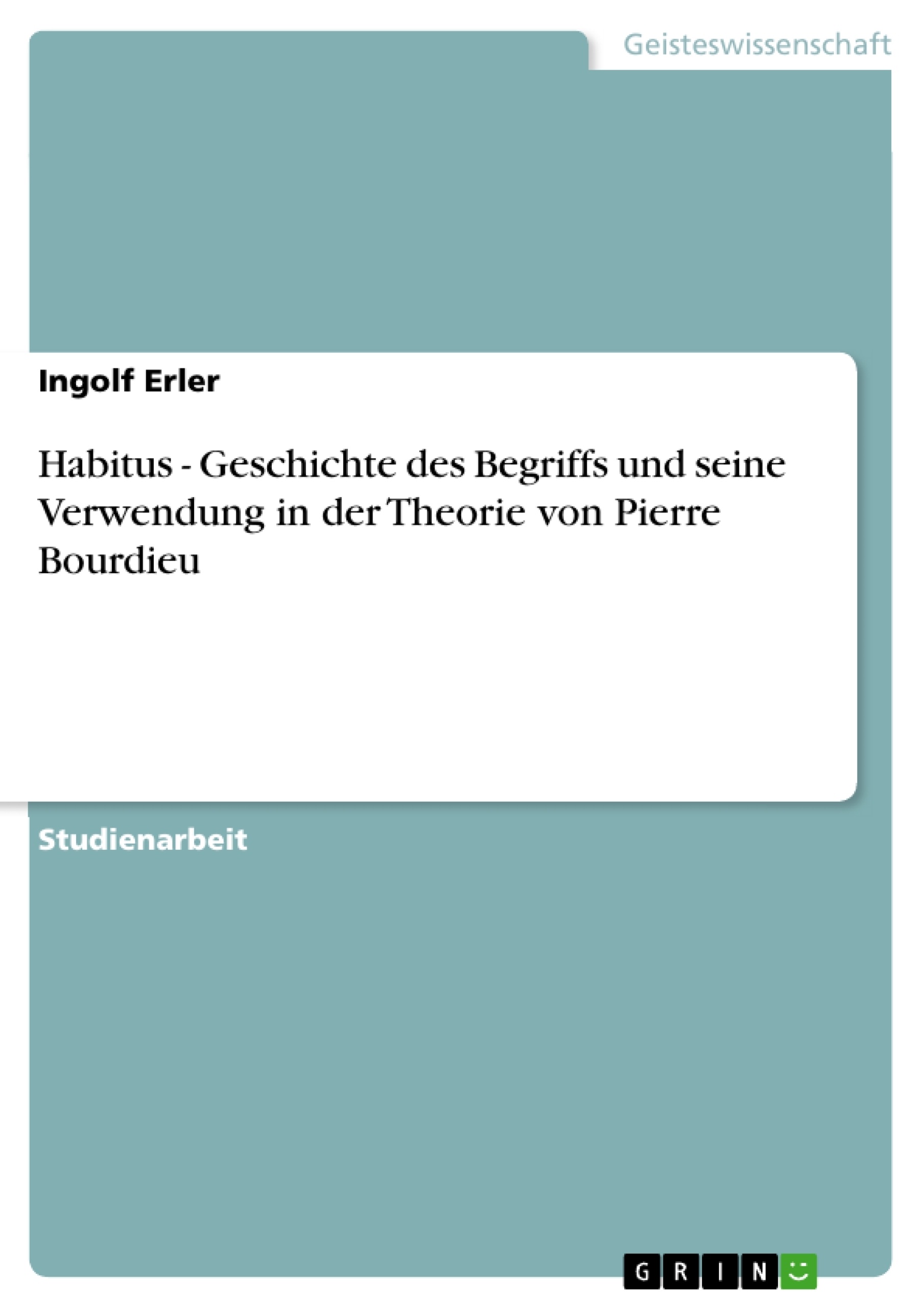Die vorliegende Arbeit führt in eines der zentralen Konzepte des Werks von Pierre Bourdieu ein, seinem Begriff des Habitus. Es unterteilt sich in folgende Kapitel:
Geschichte des Habitusbegriffs: Ursprünge in der Philosophie, Wiederentdeckung bei Durkheim und Weber, Arnold Gehlen, Peter Berger und Thomas Luckmann, der Habitusbegriff bei Norbert Elias.
Der Habitusbegriff bei Pierre Bourdieu: Entstehen des Bourdieu'schen Habituskonzepts, Funktionsweisen des Habitus, Beispiel: Männliche Herrschaft, Kritik.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- EINLEITUNG
- GESCHICHTE DES BEGRIFFS
- URSPRÜNGE IN DER PHILOSOPHIE
- WIEDERENTDECKUNG BEI DURKHEIM UND WEBER
- ARNOLD GEHLEN
- PETER BERGER UND THOMAS LUCKMANN
- DER HABITUSBEGRIFF BEI NORBERT ELIAS
- DER HABITUSBEGRIFF BEI BOURDIEU
- ENTSTEHUNG DES BOUDIEU'SCHEN HABITUSKONZEPTS
- FUNKTIONSWEISE DES HABITUS
- BEISPIEL: MÄNNLICHE HERRSCHAFT (DOMINATION MASCULINE)
- KRITIK
- LITERATUR
- ANHANG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, den Habitusbegriff von Pierre Bourdieu näher zu beleuchten und seinen Stellenwert im Gesamtwerk des französischen Sozialwissenschafters aufzuzeigen. Der Habitus, als ein zentrales Konzept, zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und seine Bedeutung in verschiedenen Forschungsfeldern aus.
- Die Entwicklung des Habitusbegriffs in der Geschichte der Soziologie
- Die Funktionsweise des Habitus und seine Bedeutung für individuelles Handeln und gesellschaftliche Strukturen
- Die Kritik am Habituskonzept und alternative Perspektiven
- Die Verbindung zwischen dem Habituskonzept und Bourdieus Theorie der gesellschaftlichen Reproduktion
- Die Anwendung des Habitusbegriffs in verschiedenen Forschungsbereichen wie Bildung, Kultur, Kunst und Geschlecht
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort bietet einen Überblick über das Werk von Pierre Bourdieu und die zentralen Themen, die in seiner Forschung eine Rolle spielen. Die Einleitung führt in die Entstehungsgeschichte der Soziologie als Wissenschaft ein und stellt den Habitusbegriff als eine alternative Denkweise zum Rollenkonzept vor. Der Abschnitt über die Geschichte des Habitusbegriffs verfolgt dessen Entwicklung von den Ursprüngen in der Philosophie bis hin zu den sozialwissenschaftlichen Konzepten bei Durkheim, Weber, Gehlen, Berger/Luckmann und Elias. Im Anschluss wird der Habitusbegriff von Pierre Bourdieu im Detail analysiert, wobei die Entstehung des Bourdieu'schen Habituskonzepts, seine Funktionsweise und Kritikpunkte beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Arbeit sind Habitus, Pierre Bourdieu, Sozialstruktur, Gesellschaftskritik, symbolisches Kapital, Praxis, Handlung, Reproduktion, Macht, Domination, Distinktion und Kultur.
- Quote paper
- Ingolf Erler (Author), 2003, Habitus - Geschichte des Begriffs und seine Verwendung in der Theorie von Pierre Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157165