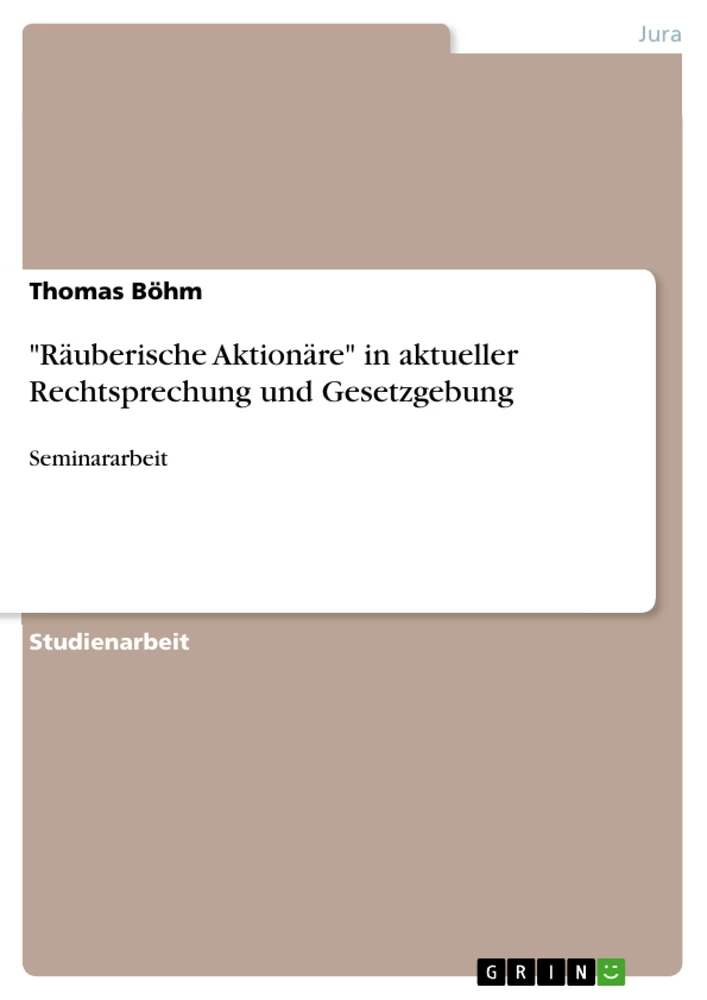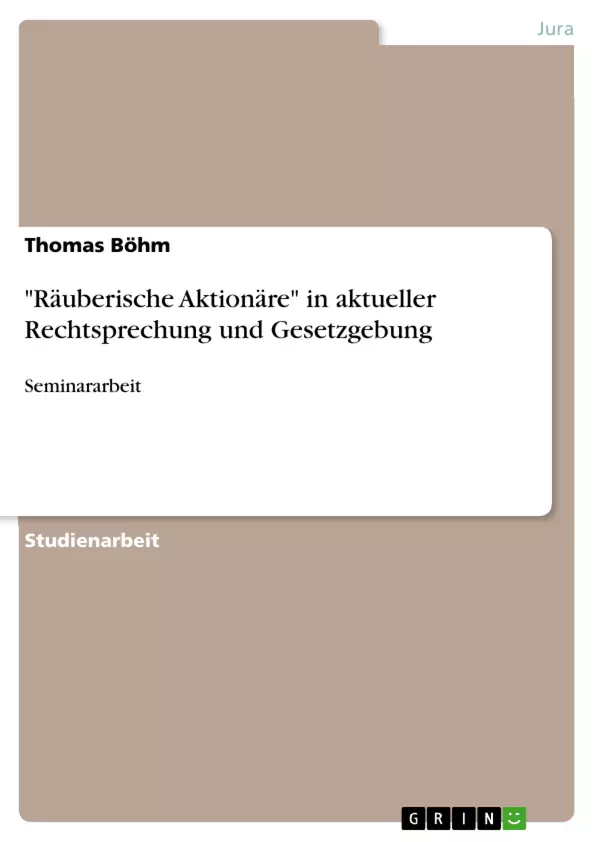Ziel dieser Arbeit ist es, das Phänomen der „räuberischen Aktionäre“ im Rahmen des deutschen Rechts darzustellen, unter Einbeziehung und Diskussion der aktuellen rechtspolitischen Entwicklungen.
Zum Zweck des besseren Gesamtverständnisses soll zunächst ein Überblick über die Aktionärsrechte gegeben werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Anfechtungsrecht, insbesondere der Anfechtungsklage, weil diese das Hauptinstrument der „räuberischen Aktionäre“ darstellt. Im Anschluss daran wird der Missbrauch der Anfechtungsklage näher erläutert. Dazu wird zunächst der Beweis des Vorliegens missbräuchlicher Anfechtungsklagen erbracht um anschließend die Vorgehensweise der „räuberischen Aktionäre“ näher zu erläutern. Danach reihen sich die Maßnahmen der Rechtsprechung und Gesetzgebung zur Bekämpfung missbräuchlicher Aktionärsklagen, die den Hauptteil der Untersuchung darstellen. Den Schluss bildet ein Fazit zum Thema.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemaufriss
- II. Gang der Untersuchung
- B. Aktienrechtliche Grundlagen
- I. Aktionärsrechte
- II. Anfechtungsrecht
- 1. Anfechtbarkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen durch Aktionäre
- 2. Bedeutung und Funktion des Anfechtungsrechts
- C. Missbrauch der Anfechtungsklage
- I. Evidenz
- II. Vorgehensweise „räuberischer Aktionäre“
- 1. Allgemeines
- 2. Exkurs: Vorstandshaftung
- III. Betriebs- und volkswirtschaftlicher Schaden
- D. Maßnahmen zur Bekämpfung missbräuchlicher Aktionärsklagen
- I. Rechtsprechung
- 1. Einwand des Rechtsmissbrauchs
- 2. Haftung des „räuberischen Aktionärs“
- II. Gesetzgebung
- 1. Das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG)
- 2. Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)
- 3. Weiterer Reformbedarf und Reformvorschläge
- I. Rechtsprechung
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Problem des Missbrauchs von Anfechtungsklagen durch Aktionäre in der deutschen Rechtsprechung und Gesetzgebung. Das Ziel ist es, die Vorgehensweise von sogenannten "räuberischen Aktionären" zu beleuchten, die Anfechtungsklagen strategisch einsetzen, um eigene Interessen durchzusetzen, selbst wenn diese den Interessen des Unternehmens und der Allgemeinheit widersprechen.
- Missbrauch von Anfechtungsklagen
- Strategisches Vorgehen "räuberischer Aktionäre"
- Rechtliche Grundlagen des Anfechtungsrechts
- Maßnahmen zur Bekämpfung von Anfechtungsmissbrauch
- Reformvorschläge zur Stärkung des Unternehmensrechts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Problem des Anfechtungsmissbrauchs einführt und den Gang der Untersuchung skizziert. Anschließend werden die relevanten aktienrechtlichen Grundlagen, insbesondere Aktionärsrechte und das Anfechtungsrecht, erläutert. Im nächsten Kapitel wird der Missbrauch der Anfechtungsklage im Detail untersucht, indem die Vorgehensweise "räuberischer Aktionäre" und die möglichen Folgen für Unternehmen und die Wirtschaft dargestellt werden. Schließlich werden Maßnahmen zur Bekämpfung des Anfechtungsmissbrauchs, sowohl aus rechtlicher Sicht (Rechtsprechung) als auch aus gesetzlicher Sicht (Gesetzgebung), diskutiert. Hier werden wichtige Reformen wie das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) und das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) beleuchtet.
Schlüsselwörter
Anfechtungsklage, Aktionär, Aktionärsrechte, Unternehmensintegrität, Rechtsmissbrauch, strategische Klage, "räuberische Aktionäre", Anfechtungsrecht, UMAG, ARUG, Unternehmensrecht, Rechtsprechung, Gesetzgebung.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind "räuberische Aktionäre"?
Dies sind Aktionäre, die geringfügige Beteiligungen erwerben, um Hauptversammlungsbeschlüsse mit Anfechtungsklagen zu blockieren und das Unternehmen zu Abfindungszahlungen zu nötigen.
Welches Instrument nutzen räuberische Aktionäre primär?
Das Hauptinstrument ist die Anfechtungsklage gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, da diese oft eine aufschiebende Wirkung hat (z.B. bei Fusionen).
Was ist das Ziel des Gesetzes UMAG?
Das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) wurde eingeführt, um den Missbrauch von Anfechtungsklagen durch strengere Zulassungsvoraussetzungen zu erschweren.
Welchen Schaden verursachen missbräuchliche Klagen?
Sie führen zu erheblichen betriebs- und volkswirtschaftlichen Schäden durch Verzögerungen bei wichtigen Unternehmensentscheidungen und hohen Rechtskosten.
Welche Rolle spielt das ARUG in diesem Kontext?
Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) ergänzt die Maßnahmen zur Bekämpfung des Rechtsmissbrauchs und stärkt gleichzeitig die Transparenz in Aktiengesellschaften.
- Quote paper
- Thomas Böhm (Author), 2009, "Räuberische Aktionäre" in aktueller Rechtsprechung und Gesetzgebung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157180