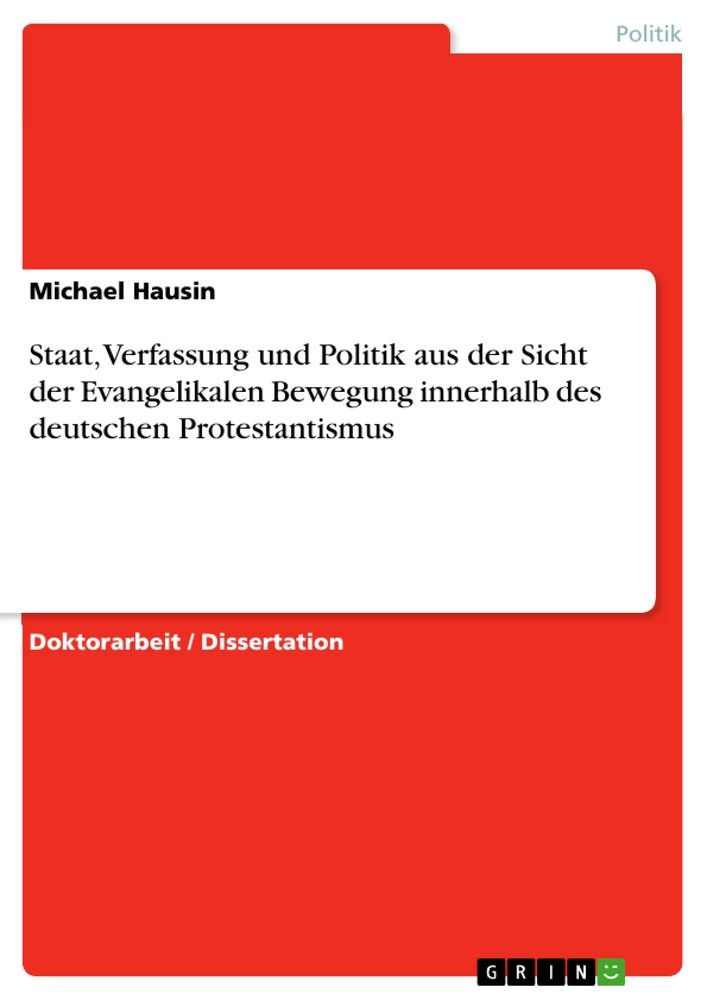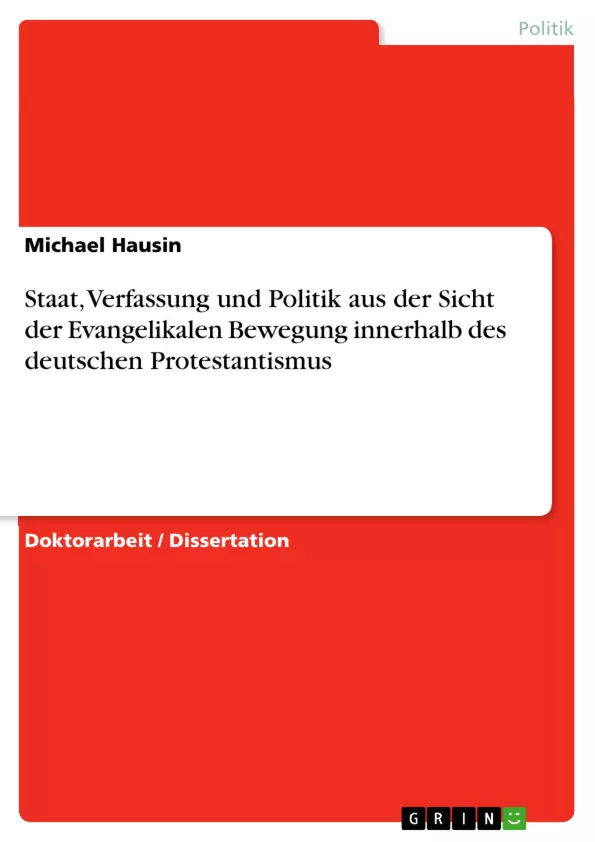Die vorliegende Dissertation untersucht die Einstellungen, die sich in der Evangelikalen Bewegung in Deutschland zu Staat, Verfassung und Politik finden.
Bei der Untersuchung ist es hilfreich, sich an den Leitfragen der politischen Philosophie zu orientieren. Zunächst geht es um die Frage nach dem Menschenbild: Welche Voraussetzungen bringt der Mensch für ein politisches Dasein mit? Welche politischen Ordnungen sind seiner Natur angemessen und können mit Aussicht auf Erfolg und Stetigkeit verfolgt werden? Die politische Anthropologie bestimmt den Stellenwert des Individuums und regelt das Verhältnis der Individuen untereinander, sowie des Einzelnen zum Ganzen und ist die Grundlage der politischen Ethik. Weiter geht es um die Frage nach der Legitimation politischer Herrschaft, damit zusammen hängend, um die Auseinandersetzung um die zweifelsfrei beste Form des Staates. Gibt es – aus der Sicht der Evangelikalen- zur parlamentarischen Demokratie eine diskussionswürdige Alternative? Wann endet die Loyalität der Unterordnung unter die verfassten, positiven Gesetze? Gibt es in der theoretischen Diskussion ein Widerstandsrecht und wenn es befürwortet wird, wann gilt es in welcher Form Widerstand zu leisten?
Sodann ist die Frage nach dem Umfang und den Grenzen staatlichen Handelns zu thematisieren. Wer darf in wessen Namen mit welchem Recht handeln? Wie müssen staatliche Organe agieren? Wie weit reichen die Kompetenzen des Staates gegenüber nichtpolitischen Räumen, gerade der Familien, der Religionsgemeinschaften und der Wirtschaft? Gibt es Bereiche, die von ‚Natur‘ aus unpolitisch sind und nicht der öffentlichen Regelung bedürfen?
Auch nach den Zielen des politischen Handelns ist zu fragen: Liegen die Ziele deduktiv definiert, geradezu als ‚vollkommen‘ vor jeder Handlung oder ergeben sie sich durch das vor Augen liegende Mögliche? Schließlich geht es um die Durchsetzung politischer Ziele: Die Mittelwahl und damit die Rolle der Gewalt im politischen Prozess, so wie ihrer Anwendung bzw. Rechtfertigung zur Durchsetzung politischer Ansichten.
Auch die klassischen, immerwährenden Fragen des politischen Denkens werden zu beachten sein: Das Zueinander von Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Welchen Stellenwert genießen diese Tugenden? In welchem Verhältnis stehen sie zueinander und inwieweit obliegt ihre Verwirklichung dem politischen Prozess? Hierhin gehört auch die Frage nach dem Zusammenhang zwischen öffentlichem Handeln und persönlichem Glück.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG.
- I. Die Evangelikale Bewegung.
- 1. Begriffsbestimmung...
- 2. Evangelikale und Fundamentalisten.
- 3. Evangelikale Charakteristik
- a) Individuelle Bekehrung und Wiedergeburt..
- b) Autorität der Bibel
- c) Gemeinschaft.
- d) Persönliche Lebensführung und Mission..
- e) Herkunftsverständnis
- 4. Evangelikale Typologie.
- 4.1. Die Evangelikale Fraktion..
- 4.2. Vorstellung der Gruppen….
- a) Pietisten .......
- b) Allianzevangelikale........
- c) Bekenntnisevangelikale.
- d) Charismatiker.
- e) Fundamentalisten..
- 5. Evangelikale und Kirche.
- II. Hintergrund der Untersuchung.
- 1. Die christliche Bedingtheit des modernen Verfassungsstaates..
- 2. Die religiöse Situation in Deutschland...
- 2.1. Der Wandel in der religiösen Landschaft...
- 2.2. Religion und Politik
- 3. Die politische Lage.....
- 4. Zusammenfassung und Methodik
- III. Historisch-theologischer Rahmen
- 1. Protestantische Staatslehre im 20. Jahrhundert.
- 1.1. Grundlage: Die Reformatoren...
- 1.2. Die Entwicklung bis zur Barmer Synode 1934.
- 1.3. Die Entwicklung von 1934 bis 1998 ..
- 2. Zusammenfassung..
- 3. Die politischen Entwürfe der historischen Vorläufer der Evangelikalen …………....
- 3.1. Der klassische Pietismus im 18. Jahrhundert.
- a) Distanziert-ablehnend
- b) Distanziert-gleichgültig..
- c) Aktivistisch
- 3.2. Die Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert..
- 3.3. In Demokratie und Totalitarismus..
- 4. Zusammenfassung..
- B. HAUPTTEIL
- I. Zwischen Quietismus und Aktivismus.
- 1. Die quietistische Versuchung..
- 2. Die aktivistische Haltung.
- 2.1. Die Forderungen der evangelikalen Wortführer
- 2.2. Gründe für die politische Mobilisierung.
- a) Die Reformphase der BRD.
- b) Die Initialzündung: Lausanne 1974.
- c) Unmittelbare Gegenwart.
- 2.3. Aktionsforen .........
- a) Die christlichen Kleinparteien.……….....
- b) Die 'Aktion: Die Wende'.
- c) Kommunitäten ……………………..
- d) Themenbezogene Gruppen.
- e) Bündnissuche
- 3. Zusammenfassung..
- II. Die politischen Axiome einer evangelikalen Sozialethik.
- 1. Politische Anthropologie..
- 1.1. Der pessimistische Grundtenor
- 1.2. Der optimistische Aspekt.
- 1.3. Menschenbild und Politik..
- 1.4. Überblick: Menschenbild.
- 2. Die transzendente Stiftung der politischen Ordnung
- 3. Verhältnisbestimmungen der Zwei-Reiche-Lehre
- 3.1. Staat und Religion .......
- 3.2. Staat und Kirche.
- 4. Die Souveränität Gottes
- 5. Zusammenfassung..
- III. Evangelikale Variationen in der Bestimmung von Staat und Politik.
- 1. Kennzeichnungen ………..
- 1.1. Begriffsbestimmungen
- 1.2. Schematische Übersicht:
- 2. Ordo- Evangelikalismus.
- 2.1. Leitmotiv: Adiaphora.
- 2.1.1. Die bedingte Geltung der Gebote Gottes
- 2.1.2. Staatstheoretische Indifferenz
- 2.1.3. Politik im Zeichen der Vernunft..
- 2.1.4. Widerspruch und Widerstand...
- 2.1.5. Die Eigenschaften 'rechter Obrigkeit❜
- 2. 2. Leitmotiv: Das ganze Gesetz Gottes: Theonomie..
- 2.2.1. Die unbedingte Geltung der Gebote Gottes
- 2.2.2. Biblische Staatsformenlehre.……………..
- 2.2.3. Politik im Zeichen der Gesetze Gottes....
- 2.2.4. Biblisches Widerstandsrecht.
- 2.3. Ordo-Betonung und Normenstrenge.
- 2.3.1. Ordo-Vorstellungen….…………......
- a) Macht, Autorität und der starke Staat
- b) Meta-Normen.
- c) Das Votum für die Demokratie.
- d) Parteinahme für die normsetzenden Ansprüche des Grundgesetzes.....
- e) Die Bewahrung der Schöpfung
- 2.3.2. Gefährdungen der Ordnung..
- a) Das Anomiepotential der Moderne und der Wertewandel..
- b) Nation und Multikulturelle Gesellschaft...
- c) Demokratisierung und ausgedehnte Staatstätigkeit
- d) Die Negierung des Allgemeinwohls.
- 2.3.3. (Wieder)herstellung der Ordnung.
- e) Politikwandel und der Verlust des Primats der Politik
- a) Erweckung und ‘geistig-moralische Wende'
- b) Wahlempfehlungen
- 2.3.4. Wirtschaftsordnung.
- a) Soziale Marktwirtschaft
- b) Arbeit.
- c) Eigentum
- d) Der Sozialstaat.
- 2.4. EXKURS: Günter Rohrmoser.
- a) Analyse der Moderne.
- b) Der Weg aus der Krise: Die Forderung nach einer geistigen Wende. _
- 3. Emanzipativer Evangelikalismus
- 3.1. Leitmotiv: Das Reich Gottes
- 3.2. Staatsaufgaben im Lichte des Reiches Gottes
- 3.3. Politik im Lichte des Reiches Gottes
- a) Gegenwartsanalyse...
- b) Politikgestaltung.
- 3.4. Widerstandsrecht..
- 3.5. Wirtschaftsordnung.
- 3.6. Demokratie und Reich Gottes
- 3.7. EXKURS: Die Vordenker des emanzipativen Evangelikalismus.
- 4. Zusammenfassung.
- 5. Übersicht: Evangelikales Staats- und Politikverständnis..
- C. SCHLUSSTEIL
- 1. Die Axiome evangelikaler Sozialethik..
- 2. Die politische Heteronomität der Evangelikalen Bewegung
- a) Das unterschiedliche Staatsverständnis..
- b) Das unterschiedliche Politikverständnis.
- c) Das unterschiedliche Demokratieverständnis
- d) Politischer Mobilisierungsgrad.
- e) Parteibindung.
- 3. Die Chancen der Evangelikalen ....
- 4. Was den Evangelikalen im Wege steht.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit der politischen Haltung der evangelikalen Bewegung innerhalb des deutschen Protestantismus. Ziel ist es, das Staats- und Politikverständnis dieser Bewegung zu analysieren und zu beschreiben, indem die verschiedenen Positionen und Strömungen innerhalb des Evangelikalismus beleuchtet werden.
- Das Verhältnis zwischen Staat und Religion im Kontext der evangelikalen Bewegung
- Die Rolle des Staates und der Politik in der evangelikalen Sozialethik
- Die unterschiedlichen Positionen innerhalb des Evangelikalismus zum Thema Staat und Politik
- Die politischen Strategien und Aktionen der evangelikalen Bewegung
- Die historische Entwicklung der evangelikalen Staatslehre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen umfassenden Überblick über die evangelikale Bewegung und ihre Geschichte. Sie beleuchtet die verschiedenen Strömungen des Evangelikalismus und stellt dessen theologische und soziologische Kennzeichen dar.
Kapitel I geht der Frage nach, wie sich die evangelikale Bewegung in Bezug auf politische Engagements positioniert. Es werden die verschiedenen Positionen zwischen einer quietistischen und einer aktivistischen Haltung analysiert.
Kapitel II beschäftigt sich mit den politischen Grundprinzipien und Axiomen einer evangelikalen Sozialethik. Es werden Themen wie Anthropologie, Staatslehre, Verhältnisbestimmungen zwischen Staat und Kirche sowie die Souveränität Gottes beleuchtet.
Kapitel III stellt unterschiedliche Variationen innerhalb des evangelikalen Staats- und Politikverständnisses dar. Es werden die Positionen des Ordo- und des Emanzipativen Evangelikalismus sowie die politischen Implikationen dieser Positionen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Dissertation behandelt zentrale Themen wie Evangelikalismus, Staats- und Politikverständnis, Sozialethik, Zwei-Reiche-Lehre, Ordo- und Emanzipativer Evangelikalismus, politische Anthropologie, Widerstandsrecht, Demokratie, Reich Gottes, religiöse Politik, politische Mobilisierung und christliche Kleinparteien. Die Forschungsarbeit befasst sich insbesondere mit der Frage, wie sich die evangelikale Bewegung in der deutschen Gesellschaft und Politik positioniert und welche Rolle sie in Bezug auf Staat und Politik spielt.
- Citar trabajo
- Michael Hausin (Autor), 1999, Staat, Verfassung und Politik aus der Sicht der Evangelikalen Bewegung innerhalb des deutschen Protestantismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157200