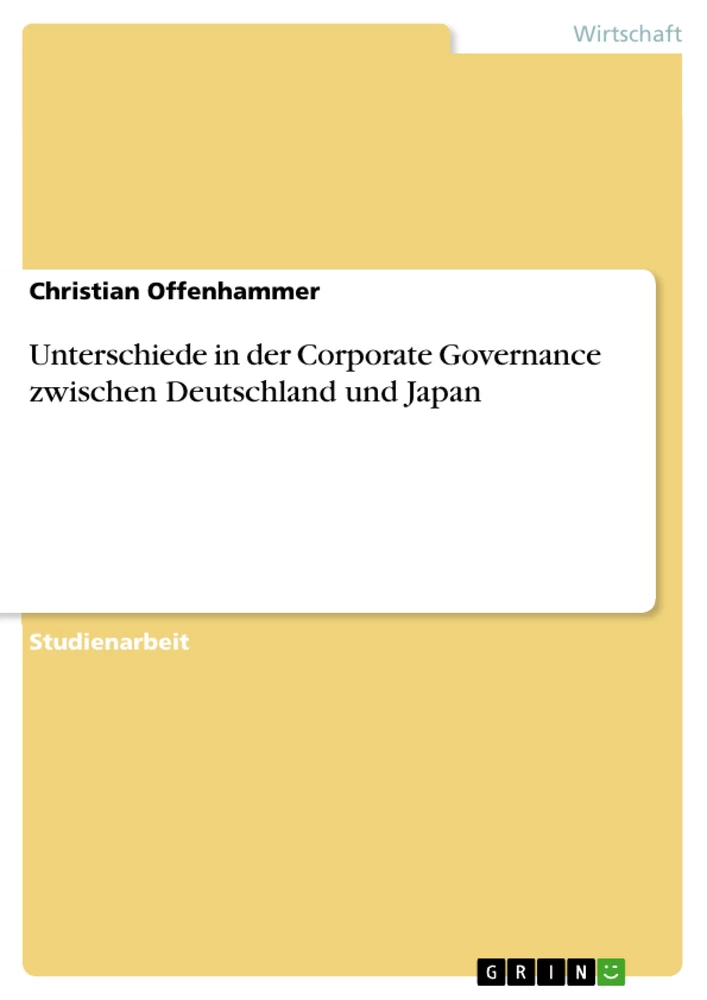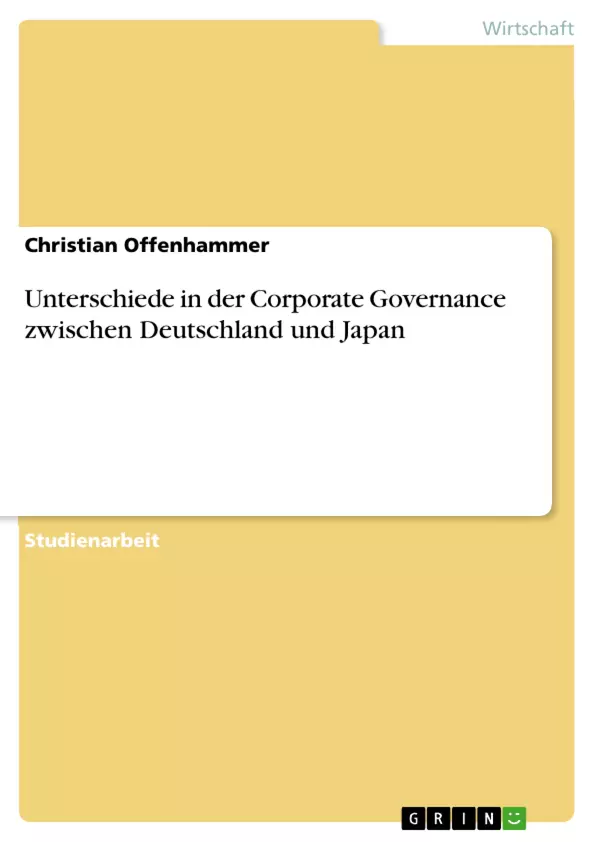In der Theorie der Unternehmensführung sind die Aufgaben der Leitung und Kontrolle erfolgskritische Faktoren. Fehlt eine klare Regelung oder wird eine solche missachtet können sich schwerwiegende Konsequenzen ergeben. Vor diesem Hintergrund scheint eine Beschäftigung mit dem Thema der Corporate Governance auch im internationalen Kontext angebracht. Die vorliegende Arbeit untersucht die Elemente und Einflüsse auf die Corporate Governance in den Ländern Deutschland und Japan und vergleicht diese anhand verschiedener Kriterien.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabenstellung und Zielsetzung
- Begriff der Corporate Governance
- Interessengruppen des Unternehmens
- Idealtypische Ausrichtung von Unternehmenszielen
- Shareholder Value-Ansatz
- Stakeholder Value-Ansatz
- Corporate Governance als Teil eines nationalen bzw. kulturellen Systems
- Corporate Governance-System in Deutschland
- Vorstands-/Aufsichtsratmodell der Aktiengesellschaft
- Mitbestimmungsmodell
- Rechtlicher Rahmen und Deutscher Corporate Governance Kodex
- Corporate Governance-System in Japan
- Keiretsu-System der Unternehmensverflechtungen
- Rolle der Hauptbanken
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Vergleich der Corporate Governance-Systeme
- Kapitalmarkteinfluss
- Bedeutung von personellen Verflechtungen
- Rechtliche Regelungen
- Fazit und Entwicklung der Corporate Governance
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Unterschieden in der Corporate Governance zwischen Deutschland und Japan. Sie untersucht die verschiedenen Modelle der Unternehmensführung und -kontrolle in beiden Ländern und beleuchtet die spezifischen Einflüsse von Kultur, Recht und Kapitalmarkt auf die jeweiligen Corporate Governance-Systeme.
- Vergleich der Corporate Governance-Modelle in Deutschland und Japan
- Analyse des Einflusses von Kultur und Recht auf die Unternehmensführung
- Bedeutung von Kapitalmärkten und Stakeholdern in der Corporate Governance
- Untersuchung von spezifischen Merkmalen wie Mitbestimmung und Keiretsu-System
- Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den beiden Systemen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Aufgabenstellung und Zielsetzung: Dieses Kapitel führt in das Thema Corporate Governance ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung von Unterschieden zwischen Deutschland und Japan. Es wird auf die Bedeutung von effektiver Führung und Kontrolle im Kontext von Unternehmensverantwortung und internationalem Wettbewerb hingewiesen.
- Kapitel 2: Begriff der Corporate Governance: Dieses Kapitel liefert eine Definition von Corporate Governance und beleuchtet die verschiedenen Interessengruppen, die an der Unternehmensführung beteiligt sind. Es werden die beiden zentralen Ansätze des Shareholder Value und Stakeholder Value vorgestellt und die Bedeutung von Corporate Governance als Teil eines nationalen und kulturellen Systems hervorgehoben.
- Kapitel 3: Corporate Governance-System in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt das deutsche Corporate Governance-System und stellt das Vorstands-/Aufsichtsratmodell sowie das Mitbestimmungsmodell vor. Zudem wird der rechtliche Rahmen und der Einfluss des Deutschen Corporate Governance Kodex beleuchtet.
- Kapitel 4: Corporate Governance-System in Japan: Dieses Kapitel behandelt das japanische Corporate Governance-System und fokussiert auf das Keiretsu-System der Unternehmensverflechtungen, die Rolle der Hauptbanken sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen.
- Kapitel 5: Vergleich der Corporate Governance-Systeme: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Corporate Governance-Systeme anhand von Kriterien wie Kapitalmarkteinfluss, Bedeutung personeller Verflechtungen und rechtlichen Regelungen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und der Einfluss von Kultur und Recht auf die jeweiligen Systeme beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Aspekten der Corporate Governance, insbesondere im Kontext von Deutschland und Japan. Wesentliche Themen sind die Unternehmensverfassung, Stakeholder Value, Shareholder Value, Mitbestimmung, Keiretsu-System, Kapitalmarkteinfluss, rechtliche Rahmenbedingungen und kulturelle Einflüsse.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede in der Corporate Governance zwischen Deutschland und Japan?
Deutschland nutzt ein dualistisches System (Vorstand/Aufsichtsrat) mit starker Mitbestimmung, während Japan traditionell durch das Keiretsu-System und die Rolle der Hauptbanken geprägt ist.
Was bedeutet „Shareholder Value“ vs. „Stakeholder Value“?
Shareholder Value fokussiert auf die Interessen der Aktionäre, während Stakeholder Value alle Interessengruppen (Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) einbezieht.
Was ist das Keiretsu-System in Japan?
Ein Netzwerk aus eng miteinander verflochtenen Unternehmen und Banken, die durch gegenseitige Beteiligungen und langfristige Geschäftsbeziehungen verbunden sind.
Welche Rolle spielt die Mitbestimmung in Deutschland?
Sie ist ein zentrales Element der deutschen Corporate Governance, das Arbeitnehmern Mitspracherechte im Aufsichtsrat großer Unternehmen einräumt.
Wie beeinflusst die Kultur die Unternehmensführung?
Nationale Werte und rechtliche Rahmenbedingungen bestimmen maßgeblich, wie Kontrolle, Transparenz und Verantwortung in Unternehmen gelebt werden.
- Quote paper
- Christian Offenhammer (Author), 2007, Unterschiede in der Corporate Governance zwischen Deutschland und Japan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157224