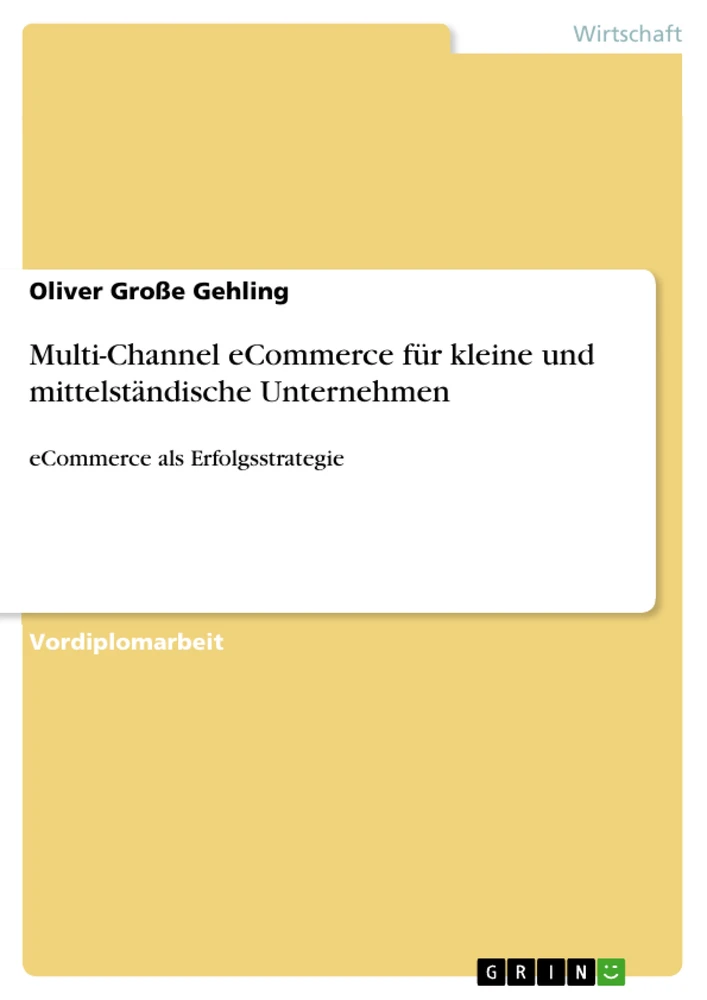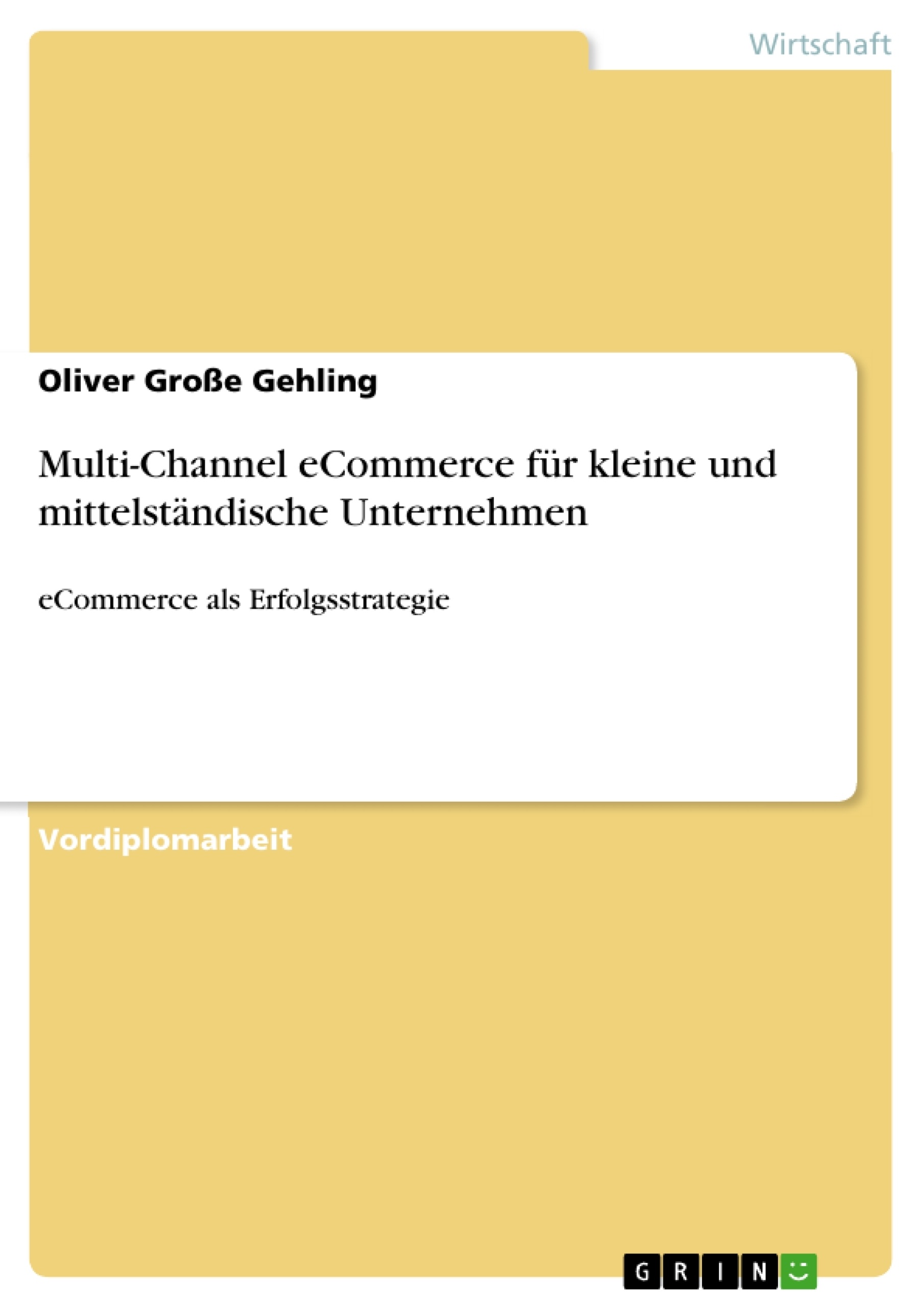Die fortschreitende Entwicklung und Verbreitung der Informations- und Telekommunikationstechnologien (IuK) führen dazu, dass das Internet und der elektronische Handel (e-Commerce) in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft immer weiter an Bedeutung gewinnen. Die Umsätze der im Internet gehandelten Waren und Dienstleistungen steigen weiter kontinuierlich an und konnten auch 2009, das Jahr der Wirtschaftskrise, mit einem zweistelligen Wachstum von 14 Prozent aufwarten. Es verwundert daher nicht, dass es kaum noch ein großes Handelsunternehmen gibt, welches auf ein entsprechendes e-Commerce Angebot verzichtet oder keine Ambitionen in diesem Bereich hat. Waren die großen Handelsunternehmen anfänglich noch zögerlich was ihre e-Commerce Aktivitäten anging, sind sie heute umso aktiver und nutzen ihr Know-How, ihre Kapitalstärke und ihre bekannten eingeführten Marken, um sich im Wettbewerb mit den reinen e-Commerce Unternehmen zu behaupten. Diese Entwicklung führt insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen zu einer massiven Verschärfung des Wettbewerbs und kann zu einer existenziellen Bedrohung für diese Unternehmen werden. Es stellt sich daher für diese Unternehmen die Frage, wie es möglich ist, trotz verschärften Wettbewerbs und geringer Kapitalausstattung, ein erfolgreiches e-Commerce Konzept zu betreiben.
Eine mögliche Antwort auf diese Frage lautet: „Multi-Channel e-Commerce“. Die Nutzung unterschiedlicher Marktplätze, Auktionsplattformen oder Webshops für die eigenen Produkte stellt insbesondere für KMU ein erhebliches Potential dar und ermöglicht es, die Reichweite des eigenen Angebotes um ein Vielfaches zu potenzieren ohne einen erheblichen Anstieg der Marketing- und Vertriebskosten.
Diese Arbeit hat zum Ziel, das Multi-Channel e-Commerce Konzept zu erläutern und Möglichkeiten aufzeigen, eine erfolgreiche Multi-Channel Strategie im elektronischen Geschäftsverkehr umzusetzen. Dabei sollen insbesondere die Punkte „Vertriebskanalauswahl“ und „verfügbare Softwareansätze“ näher betrachtet werden. Weiterhin wird diese Arbeit die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Multi-Channel e-Commerce Strategie vorstellen und mit einem entsprechenden Fazit abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- BEGRIFFLICHKEITEN
- BEGRIFFSDEFINITIONEN
- ELECTRONIC COMMERCE
- MULTI-CHANNEL E-COMMERCE
- VERTRIEBSKANÄLE
- UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON VERTRIEBSKANÄLEN
- Webshop
- Elektronische Marktplätze
- Auktionsplattformen
- AUSWAHL DER RICHTIGEN VERTRIEBSKANÄLE
- METHODISCHES VORGEHEN BEI DER VERTRIEBSKANALAUSWAHL
- UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON VERTRIEBSKANÄLEN
- MULTI-CHANNEL E-COMMERCE SOFTWAREANSÄTZE
- SOFTWAREANFORDERUNGEN
- TEILINTEGRIERTE MULTI-CHANNEL E-COMMERCE LÖSUNGEN
- INTEGRIERTE MULTI-CHANNEL E-COMMERCE LÖSUNGEN
- ERFOLGSFAKTOREN FÜR MULTI-CHANNEL E-COMMERCE
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Multi-Channel eCommerce für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Sie analysiert verschiedene Vertriebskanäle und zeigt die Vorteile und Herausforderungen einer Multi-Channel-Strategie auf.
- Definition und Abgrenzung von Multi-Channel eCommerce
- Analyse verschiedener Vertriebskanäle im Kontext von eCommerce
- Bewertung von Softwarelösungen für Multi-Channel eCommerce
- Erfolgsfaktoren für Multi-Channel eCommerce
- Zusammenfassende Betrachtung der Relevanz von Multi-Channel eCommerce für KMU
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Einleitung des Themas Multi-Channel eCommerce und Darstellung der Relevanz für KMU.
- Kapitel 2: Begrifflichkeiten: Definition und Abgrenzung wichtiger Begriffe wie Electronic Commerce und Multi-Channel eCommerce.
- Kapitel 3: Vertriebskanäle: Analyse verschiedener Vertriebskanäle wie Webshops, elektronische Marktplätze und Auktionsplattformen.
- Kapitel 4: Multi-Channel eCommerce Softwareansätze: Betrachtung von Softwareanforderungen und verschiedenen Softwarelösungen für Multi-Channel eCommerce.
- Kapitel 5: Erfolgsfaktoren für Multi-Channel eCommerce: Identifizierung und Diskussion wichtiger Erfolgsfaktoren für Multi-Channel eCommerce-Strategien.
Schlüsselwörter
Multi-Channel eCommerce, Vertriebskanäle, Webshop, elektronische Marktplätze, Auktionsplattformen, Softwarelösungen, Erfolgsfaktoren, KMU.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Multi-Channel eCommerce für KMU wichtig?
Es ermöglicht kleinen Unternehmen, ihre Reichweite massiv zu erhöhen und auf verschiedenen Plattformen präsent zu sein, um gegen große Konzerne wettbewerbsfähig zu bleiben.
Welche Vertriebskanäle werden im Multi-Channel-Ansatz genutzt?
Dazu gehören der eigene Webshop, elektronische Marktplätze (wie Amazon) und Auktionsplattformen (wie eBay).
Was sind die Anforderungen an eine Multi-Channel-Software?
Die Software muss Bestände zentral verwalten, Bestellungen aus verschiedenen Kanälen bündeln und eine Schnittstelle zu Versand- und Bezahlsystemen bieten.
Was sind kritische Erfolgsfaktoren im Multi-Channel-Handel?
Wichtige Faktoren sind eine konsistente Markenführung, effiziente Logistikprozesse und die Auswahl der für die Zielgruppe passenden Kanäle.
Wie unterscheiden sich integrierte von teilintegrierten Softwarelösungen?
Integrierte Lösungen bieten eine Komplettverwaltung in einem System, während teilintegrierte Lösungen oft über Plugins oder Brücken mit bestehenden Systemen kommunizieren.
- Arbeit zitieren
- Oliver Große Gehling (Autor:in), 2010, Multi-Channel eCommerce für kleine und mittelständische Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157241