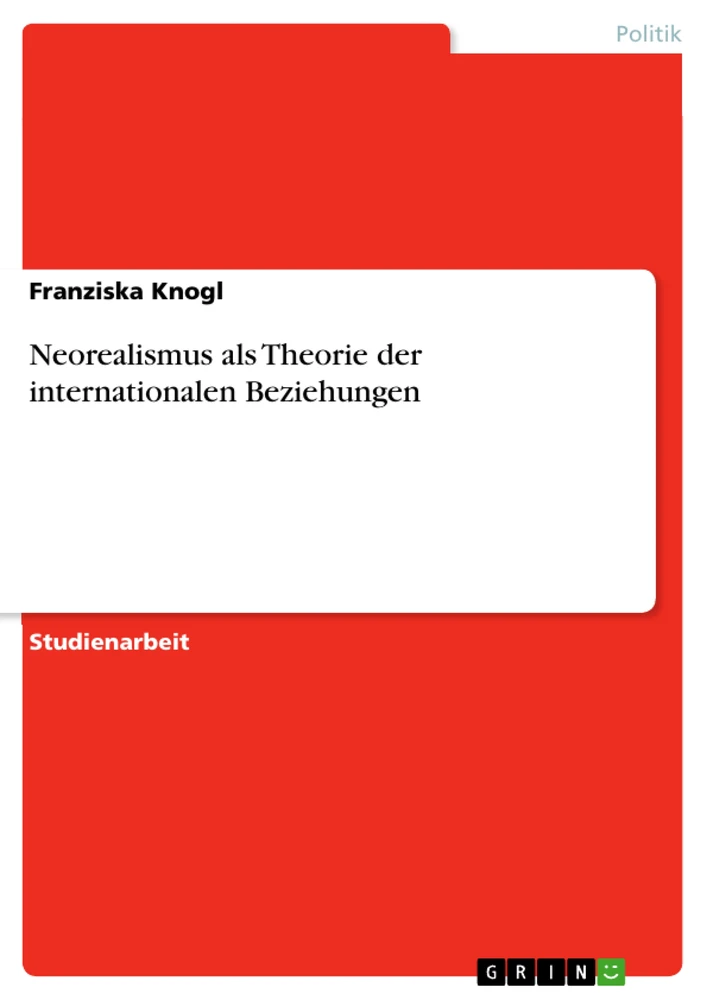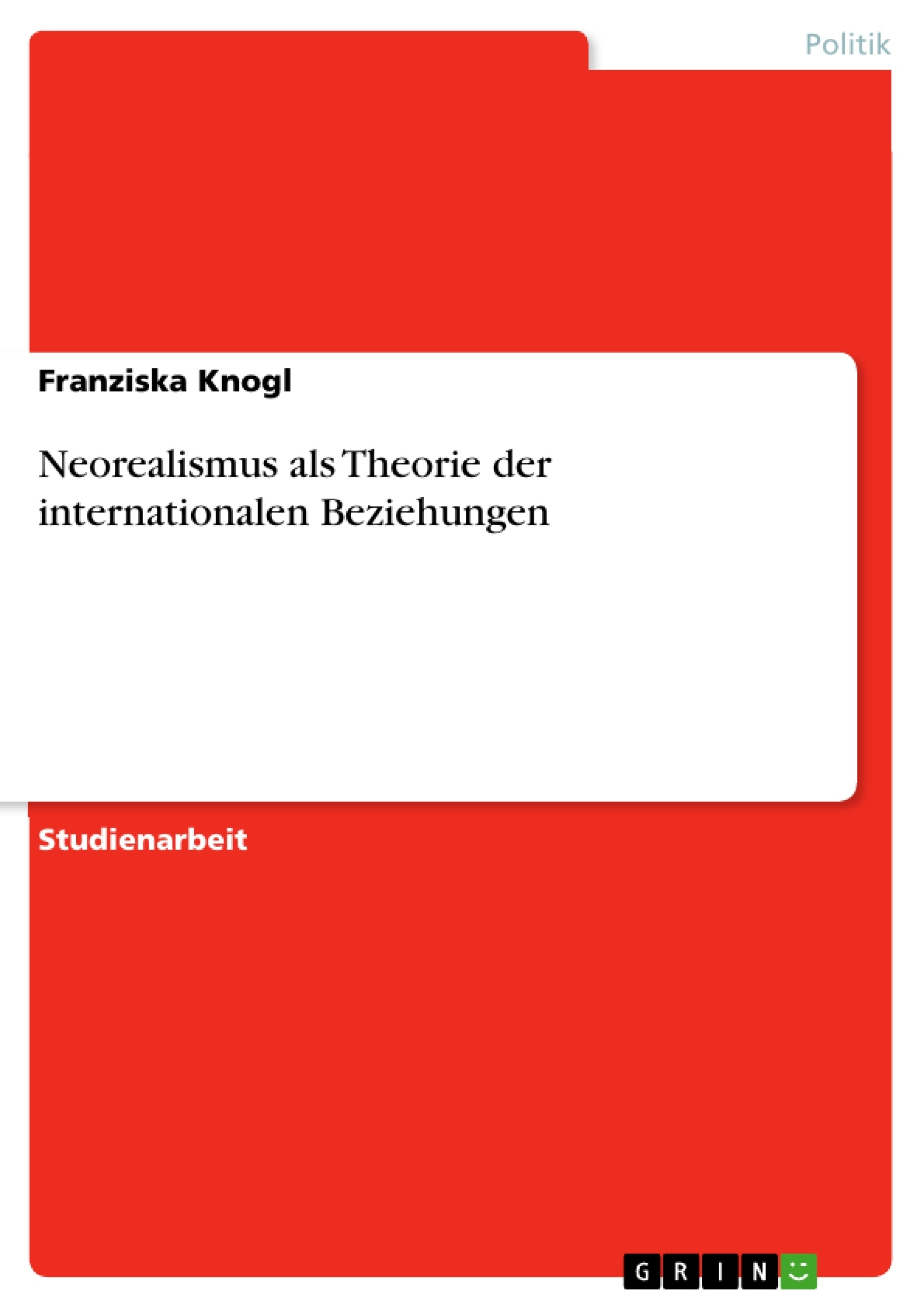Schlägt man in einer allgemeinen Enzyklopädie den Begriff ,Neorealismus’ nach, so findet sich meist nur die Erklärung, es handle sich hierbei um einen Epochenbegriff für die italienische Literatur nach dem zweiten Weltkrieg oder um eine Stilrichtung im modernen Film. Doch die Verwendung des Begriffs für einen
Theorieansatz in der politikwissenschaftlichen Forschung internationaler Beziehungen wird so gut wie nie erwähnt. Dabei handelt es sich um eine der wichtigsten und einflußreichsten Theorien in diesem Bereich.
Sie entwickelte sich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und hat ihre Wurzeln im realistischen Paradigma, welches in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg die bedeutendste Theorie der internationalen Beziehungen bildete.
Alexander Siedschlag definiert ,Neorealismus’ folglich so: „Als speziell neorealistisch sind solche Ansätze zu bezeichnen, die sich zwar ausdrücklich in die Tradition des (klassischen) Realismus stellen, diesen aber methodisch und auch theoretisch entscheidend revidieren und weiterentwickeln“. Es ist daher unumgänglich, auch auf die Ideen des klassischen Realismus einzugehen, wenn man das Konzept der Neorealisten begreifen möchte. Sie werden deshalb in Kapitel 2.1 kurz umrissen, um die Grundlage für die Darstellung der neorealistischen Theorie in Kapitel 2.3 zu liefern.
Die Anwendung des Begriffs ,Neorealismus’ für diesen ,neuen’ realistischen Denkansatz stammt von Robert W. Cox und läßt sich leicht nachvollziehen. Doch woher rührt die Bezeichnung ,Realismus’? Sie erklärt sich aus der Abgrenzung zur idealistischen Schule, welche dem Realismus vorausging: „Während die idealistische Denkschule danach fragte, wie die internationale Politik beschaffen
sein sollte (Zukunftsorientierung), analysiert die realistische Denkschule die internationale Politik so, wie sie beschaffen ist (Gegenwartsorientierung)“. Ob die neorealistische Schule dem Anspruch ihres Vorgängers auf Realitätsnähe und Anwendbarkeit hier und heute immer noch gerecht wird, soll in einem zweiten Teil dieser Arbeit untersucht werden. Dabei beziehe ich mich auf die Außenpolitik
Deutschlands nach der Wiedervereinigung. Ich werde die praktischen Folgerungen aus der neorealistischen Theorie und einige Vorraussagen der Neorealisten am konkreten Verhalten Deutschlands auf ihre Tauglichkeit überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Neorealismus? Definition und Herkunft des Begriffes
- Die Theorie des Neorealismus
- Der klassische Realismus als Vorläufer zum Neorealismus
- Vom klassischen Realismus zum Neorealismus
- Die Grundannahmen des Neorealismus
- Anarchie als Ausgangspunkt
- Die strukturelle Sichtweise von Waltz
- Der veränderte Machtbegriff
- Kooperation
- Die Anwendbarkeit des Neorealismus auf die deutsche Außenpolitik der 90er Jahre
- Die Erwartungen der Neorealisten
- Das tatsächliche Verhalten Deutschlands
- Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Theorie des Neorealismus in der internationalen Politik. Sie untersucht die Ursprünge des Neorealismus im klassischen Realismus und erläutert die wichtigsten Grundannahmen der neorealistischen Theorie. Darüber hinaus wird die Anwendbarkeit des Neorealismus auf die deutsche Außenpolitik nach der Wiedervereinigung beleuchtet.
- Die Entwicklung des Neorealismus aus dem klassischen Realismus
- Die Grundannahmen des Neorealismus, insbesondere die Annahme der Anarchie
- Die strukturelle Sichtweise von Waltz und der veränderte Machtbegriff
- Die Anwendbarkeit des Neorealismus auf die deutsche Außenpolitik der 90er Jahre
- Die Erwartungen der Neorealisten und das tatsächliche Verhalten Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff Neorealismus und beleuchtet seine Herkunft im klassischen Realismus. Es werden die wichtigsten Unterschiede zwischen dem klassischen Realismus und dem Neorealismus herausgestellt. Kapitel zwei erläutert die Theorie des Neorealismus, wobei zunächst der klassische Realismus als Vorläufer vorgestellt wird. Anschließend werden die Grundannahmen des Neorealismus, wie die Annahme der Anarchie und die strukturelle Sichtweise von Waltz, dargestellt. Kapitel drei untersucht die Anwendbarkeit des Neorealismus auf die deutsche Außenpolitik der 90er Jahre. Hierbei werden die Erwartungen der Neorealisten und das tatsächliche Verhalten Deutschlands analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit wichtigen Begriffen wie Neorealismus, klassischer Realismus, Anarchie, strukturelle Sichtweise, Macht, Kooperation, deutsche Außenpolitik und die 90er Jahre.
- Quote paper
- Franziska Knogl (Author), 2004, Neorealismus als Theorie der internationalen Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157287