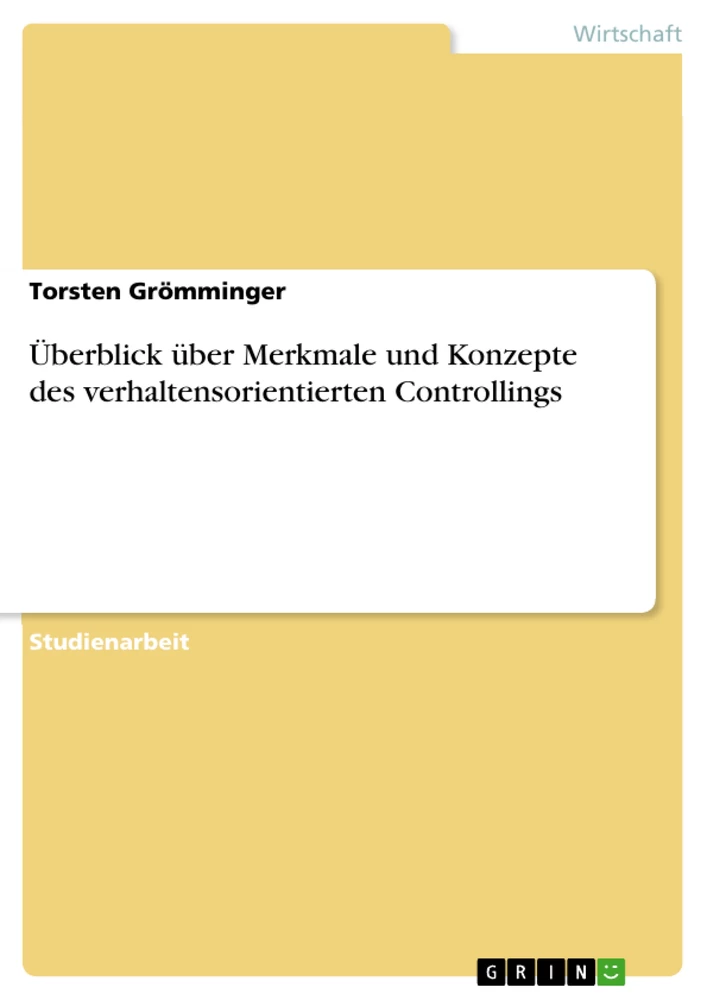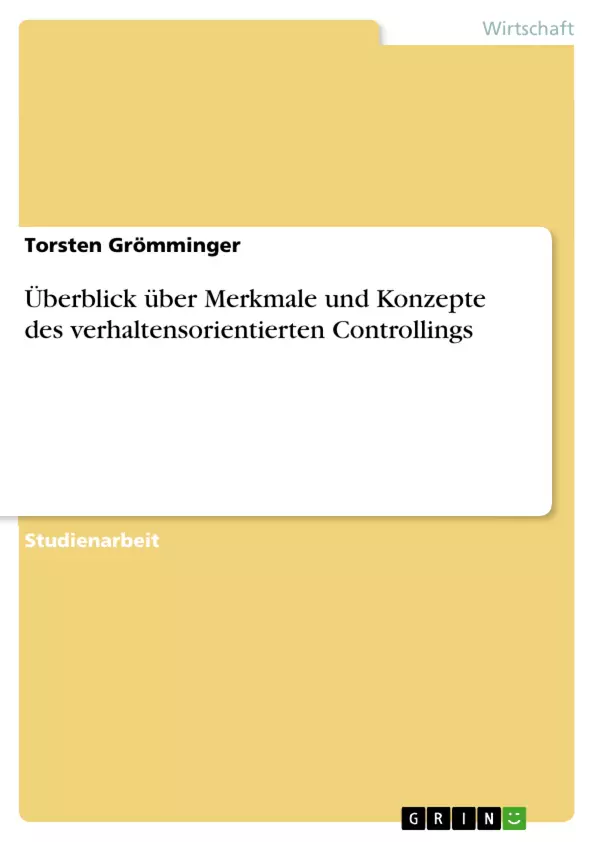„Quo vadis Controlling?“
Das Controlling ist ein noch sehr junges betriebswirtschaftliches Forschungsgebiet mit praxisorientiertem Ursprung. Es ist seit jeher einem steten Wandel unterworfen, es befindet sich quasi in einem Selbstfindungsprozess. Der Alltag ist voller Phänomene die mit den bisherigen Erkenntnissen und Methoden nicht mehr adäquat erklärt werden können. Bisher wird Controlling mit Rationalität, Nüchternheit, Analytik und stringenter Zahlenfixiertheit assoziiert. Neben den Fakten besteht kein Platz für Emotionen oder Intuition. Doch der Controller muss nicht nur allgemeingültige Messinstrumente als Grundlage einer Orientierung oder Koordination zur Verfügung stellen, vielmehr muss er auch auf Eigenschaften, Präferenzen oder Zielvorstellungen der Manager eingehen können. Dies alles differiert von Mensch zu Mensch, da jeder einen individuellen Charakter besitzt. Je nach Situation muss der Controller in der Lage sein, abzuschätzen ob es sich um ein eigenes Ziel des Managers oder um ein Unternehmensziel handelt und die Menge und Komplexität der grundlegenden Informationen dementsprechend anzupassen.
Mit dieser Thematik befasst sich der verhaltensorientierte Controlling Ansatz. Denn jedes Unternehmen ist abhängig von den Entscheidungen, die ein Mensch zu treffen hat. Ein Mensch, der wie alle anderen über limitierte Fähigkeiten und menschliche Eigenschaften verfügt. Doch in der Controlling Forschung, speziell hierzulande, wurde das Thema Mensch viel zu lange vernachlässigt. Dies wird nun langsam im Zuge einer Bewusstseinserweiterung nachgeholt. Ein Bewusstsein darüber, dass ein Controller neben dem Rechenschieber auch Konfliktlösung und Kommunikationsinstrumente beherrschen muss. Jedoch sollte nichtsdestotrotz der sichere Grund des entscheidungsorientierten Modells nicht vorschnell verlassen oder gar aufgegeben werden. Es muss ein geeignetes Mittelmaß gefunden werden, dass die reine Analytik mit dem Wesen Mensch und seinem Charakter vereint.
Die folgende Ausarbeitung befasst sich mit einem Controlling Ansatz, der in der aktuell in der Controllingpraxis und –forschung in Deutschland für Aufsehen sorgt und in Zukunft sicher eine wichtige Rolle spielen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Merkmale und Problemfelder des traditionellen Controllings
- Klassisches Verständnis des Controllings
- Der ökonomische Ansatz
- Homo Oeconomicus als Basis des traditionellen Controllings
- Der Ansatz im Detail
- Problemfelder
- Probleme des konventionellen Ansatzes
- Information Overload als spezifisches Problem
- Begriffserläuterung und Ursachen
- Konsequenzen für das Controlling
- Konsequenzen für das Management
- Psychologie & Controlling als Bezugsrahmen verhaltensorientierten Controllings
- Der Mensch im psychologischen Verständnis
- Soziale Einflüsse
- Verhaltensorientierung im Controlling
- Konzeptionen des verhaltensorientierten Controllings
- Principal-Agent-Theorie
- Grundlagen
- Annahmen
- Auftretende Probleme
- Das interne/mentale Modell
- Transaktionskostenansatz
- Grundlagen
- Grundbegriffe
- Annahmen über Akteure und Rahmenbedingungen
- Determinanten der Transaktionskostenhöhe
- Kurze Historie
- Hauptaussagen
- Möglichkeiten und Grenzen des verhaltensorientierten Controllings
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem verhaltensorientierten Controlling-Ansatz, der in der aktuellen Controlling-Praxis und -Forschung in Deutschland für Aufsehen sorgt. Die Arbeit analysiert die Grenzen des traditionellen, entscheidungsorientierten Controllings, das auf dem „Homo Oeconomicus“ basiert und die Bedeutung des menschlichen Faktors in Controlling-Prozessen hervorhebt. Die Arbeit untersucht psychologische Aspekte und soziale Einflüsse, die Entscheidungen beeinflussen, und stellt verschiedene Konzeptionen des verhaltensorientierten Controllings vor, darunter die Principal-Agent-Theorie und den Transaktionskostenansatz.
- Kritik am traditionellen, entscheidungsorientierten Controlling
- Psychologische Aspekte und soziale Einflüsse in Controlling-Prozessen
- Das verhaltensorientierte Controlling-Modell
- Konzeptionen des verhaltensorientierten Controllings: Principal-Agent-Theorie und Transaktionskostenansatz
- Möglichkeiten und Grenzen des verhaltensorientierten Controllings
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt die Problemstellung dar, dass das traditionelle Controlling dem komplexen menschlichen Verhalten nicht gerecht wird. Der erste Teil der Arbeit beleuchtet die Merkmale und Problemfelder des traditionellen Controllings, basierend auf dem ökonomischen Ansatz und dem „Homo Oeconomicus“. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Problemen des konventionellen Ansatzes, insbesondere dem „Information Overload“. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Psychologie im verhaltensorientierten Controlling und analysiert die psychologischen Aspekte des menschlichen Entscheidungsverhaltens und die Rolle sozialer Einflüsse. Der dritte Teil stellt das Konzept der Verhaltensorientierung im Controlling vor und diskutiert verschiedene Konzeptionen, darunter die Principal-Agent-Theorie, das interne/mentale Modell und den Transaktionskostenansatz. Die Arbeit beleuchtet die Grundlagen, Annahmen und Probleme dieser Konzeptionen.
Schlüsselwörter
Verhaltensorientiertes Controlling, traditionelles Controlling, Homo Oeconomicus, Information Overload, Psychologie, soziale Einflüsse, Principal-Agent-Theorie, Transaktionskostenansatz, Entscheidungsverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist verhaltensorientiertes Controlling?
Ein Ansatz, der neben nackten Zahlen auch menschliche Eigenschaften, Emotionen, Intuition und individuelle Zielvorstellungen von Managern in den Fokus rückt.
Warum wird der „Homo Oeconomicus“ im modernen Controlling kritisiert?
Weil er als rein rationaler Nutzenmaximierer die Komplexität menschlichen Verhaltens und limitierte kognitive Fähigkeiten nicht realistisch abbildet.
Was versteht man unter „Information Overload“ im Controlling?
Es beschreibt die Überflutung von Managern mit zu vielen oder zu komplexen Informationen, was die Entscheidungsqualität verschlechtern kann.
Welche Rolle spielt die Principal-Agent-Theorie?
Sie analysiert Interessenkonflikte und Informationsasymmetrien zwischen Auftraggebern (Principal) und Auftragnehmern (Agent) im Unternehmen.
Was ist der Transaktionskostenansatz?
Ein Modell, das die Kosten untersucht, die bei der Koordination von Leistungen und dem Austausch von Informationen in und zwischen Unternehmen entstehen.
- Quote paper
- Torsten Grömminger (Author), 2010, Überblick über Merkmale und Konzepte des verhaltensorientierten Controllings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157324