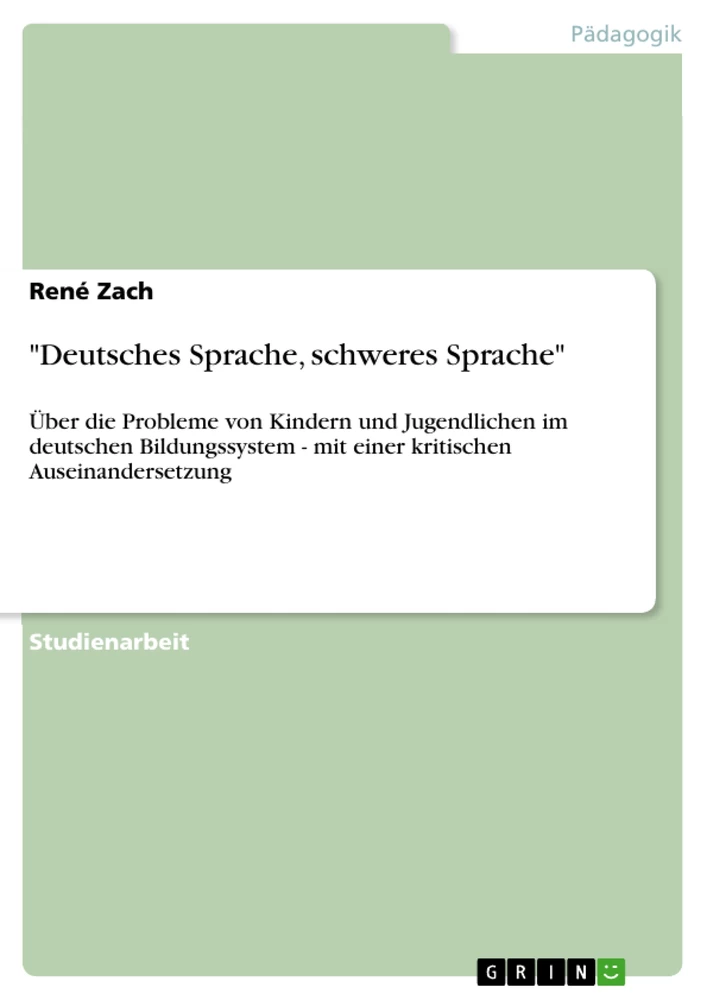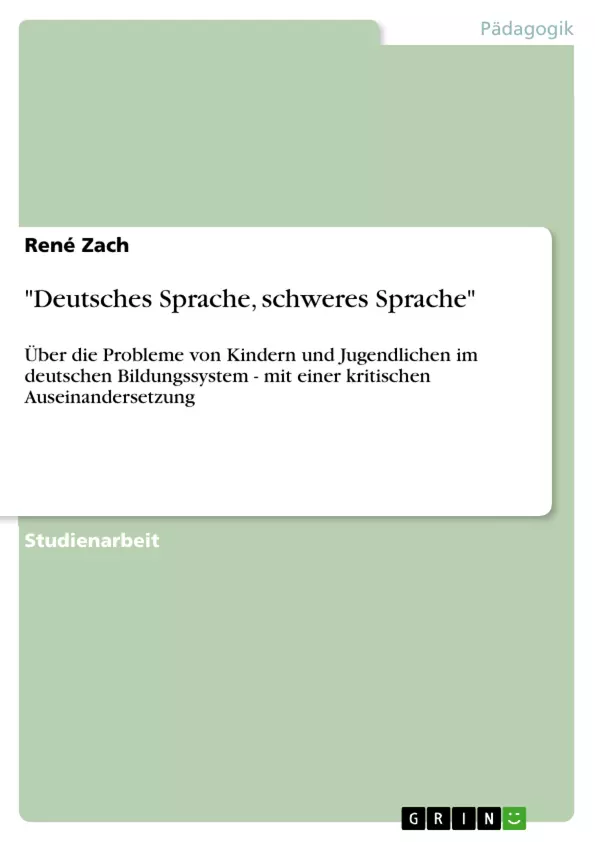Durch meine Arbeit in der offenen Jugendarbeit werde ich beinahe täglich mit den verschiedensten Phänomenen der deutschen Sprache konfrontiert. Viele dieser Sprachvariationen sind durch eine heterogene Mischung der sozialen Gruppe begründet, mit der ich im Zuge dieser Arbeit in Kontakt komme. Zusätzlich weise ich, durch mein Studium der Germanistik, sicherlich eine erhöhte Sensibilität bezüglich der deutschen Sprache auf, sodass mir Abweichungen von der Standardsprache möglicherweise eher auffallen, als anderen Menschen. Oftmals handelt es sich dabei auch um Soziolekte, in einigen Fällen lassen sich diese Phänomene jedoch nicht mit einem Begriff der Linguistik fassen.
A: „Ey, bist du Bus oder Fahrrad?
Y: „Ne, ich bin Fahrrad hier.“
A: „Kommst du nachher mit Busse [Bushaltestelle]?“
Y: „Ne, ich hab‘ nichts Lust dafür!“
Diese Anekdote aus meinem Alltag soll die Intention dieser Arbeit verdeutlichen, warum es wichtig ist, sich mit dem Bildungsstand der Kinder und Jugendlichen, sei es mit oder ohne Migrationshintergrund, zu befassen.
Im Zuge dieser Arbeit werde ich die gegenwärtige Zusammensetzung der deutschen Gesellschaft kurz skizzieren und auf das deutsche Schulsystem übertragen. Dazu beziehe ich mich auf die curricularen Vorgaben für das Fach Deutsch und werde kurz auf die Ergebnisse von PISA eingehen. Anschließend versucht diese Arbeit die Ursachen von Bildungsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu erläutern. Der Hauptteil meiner Arbeit konzentriert sich dann natürlich auf die Möglichkeiten zur Beseitigung der bestehenden Bildungsdefizite. Dies wird über das exemplarische Vorstellen von drei Förderungsprogrammen mit unterschiedlichen Ansätzen geschehen, die abschließend von mir kritisch betrachtet und reflektiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage
- Migranten in der BRD und dem deutschen Bildungssystem
- Curriculare Vorgaben im Fach Deutsch an niedersächsischen Hauptschulen
- Ergebnisse aus PISA 2006
- Mögliche Ursachen von Bildungsdefiziten bei Migranten
- Wege aus dem Bildungsdefizit – Chancen für Migranten durch Förderprogramme
- Allgemeine Grundlagen
- vorschulische Sprachförderung
- Deutsch für den Schulstart
- Das Kieler Modell
- Sprachförderung in der Sek. I – FörMig
- Konsequenzen und Erkenntnisse aus den Förderprogrammen - ein vergleichendes und kritisches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Chancen, die sich für Kinder und Jugendliche im deutschen Bildungssystem, insbesondere mit Migrationshintergrund, ergeben. Die Analyse konzentriert sich auf die aktuelle Situation von Migranten im deutschen Schulsystem, die curricularen Vorgaben im Fach Deutsch an niedersächsischen Hauptschulen und die Ergebnisse von PISA-Studien.
- Integration von Migranten im deutschen Bildungssystem
- Sprachliche Herausforderungen und Bildungsdefizite von Migrantenkindern
- Analyse von Förderprogrammen zur Unterstützung von Migranten im Bildungsbereich
- Kritische Betrachtung der Wirksamkeit und der unterschiedlichen Ansätze von Förderprogrammen
- Zusammenhang von Bildungschancen und gesellschaftlicher Integration von Migranten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und zeigt anhand eines Alltagsbeispiels die Relevanz des Themas auf. Das Kapitel "Ausgangslage" beleuchtet die Situation von Migranten in der BRD und dem deutschen Bildungssystem, insbesondere in Niedersachsen. Es werden Daten zum Anteil von Migranten in der Bevölkerung und in der Schülerschaft sowie die curricularen Vorgaben im Fach Deutsch an niedersächsischen Hauptschulen dargestellt. Das Kapitel "Mögliche Ursachen von Bildungsdefiziten bei Migranten" befasst sich mit den Ursachen, die zu Bildungsdefiziten bei Migrantenkindern führen können. Im Hauptteil der Arbeit werden drei Förderprogramme zur Unterstützung von Migranten im Bildungsbereich vorgestellt und kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Migrationshintergrund, Bildungssystem, Deutsch als Fremdsprache, Sprachförderung, Integrationsförderung, Bildungsdefizite, Förderprogramme, PISA-Studien, curriculare Vorgaben, Hauptschule, Sek. I.
- Quote paper
- René Zach (Author), 2010, "Deutsches Sprache, schweres Sprache", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157426