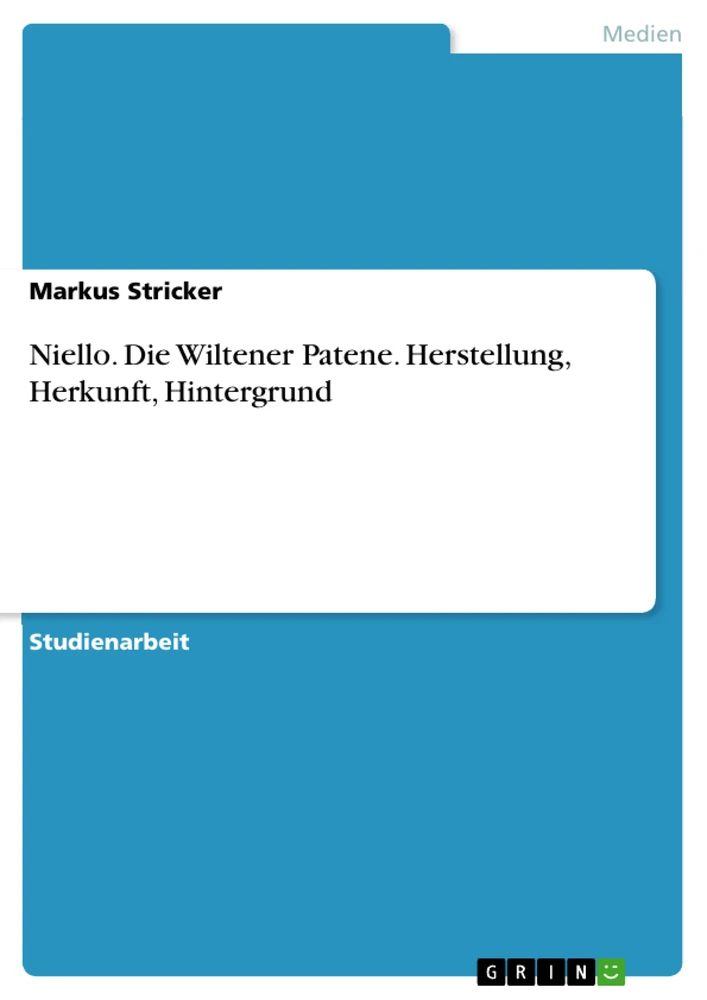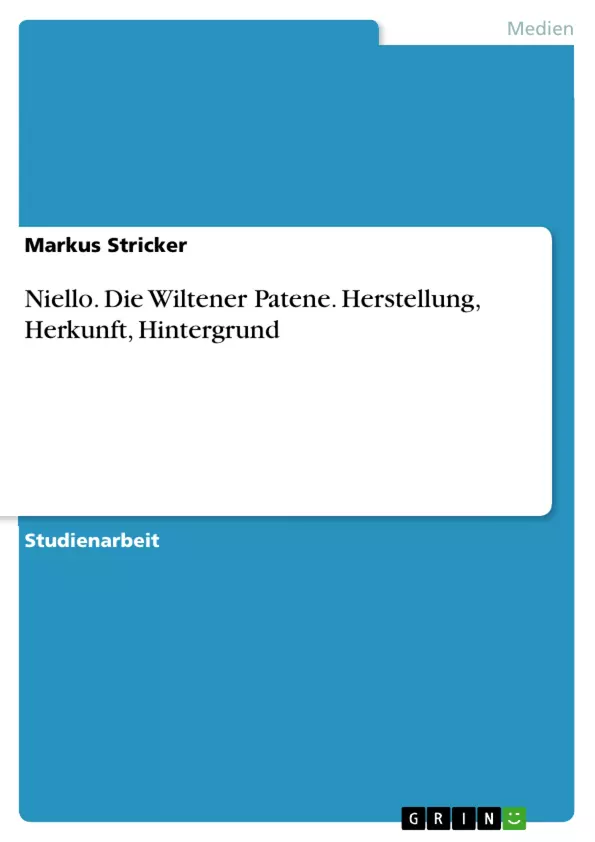Beim Besuch der Webseite des Kunsthistorischen Museums in Wien, wo sich heute die Wiltener Patene befindet, fällt auf, dass der Herkunftsort „Niedersachsen" (?) mit einem Fragezeichen in Klammern versehen ist. Dies weckt das Interesse am Entstehungsort und an der Attribution des Wiltener Ensembles.
Diese Arbeit untersucht die ökonomischen und künstlerischen Aspekte der Verwendung von Niello im 12. Jahrhundert anhand der Wiltener Patene. Dabei wird der Werdegang der Patene diskutiert, von ihrer Konzeption und Fertigung in der Werkstatt des Künstlers bis hin zu ihrem Bestimmungsort in Wilten.
Bestandteil der Arbeit ist eine gründliche ikonographische Abhandlung des komplexen Bildprogramms der Wiltener Patene. Es wurden die Gestaltungselemente, die Symbolik sowie die künstlerischen Intentionen analysiert, um ein tiefgreifendes Verständnis für die ikonographischen Besonderheiten des Werkes zu entwickeln.
Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Patene tatsächlich aus den niedersächsischen Werkstätten stammt, die mit Eilbertus (Schaffenszeit 1120-1160) in Verbindung gebracht werden, der in der Tradition von Rogerus von Helmarshausen (1070-1125) und im Umfeld von Heinrich dem Löwen (1129-1195) stand, wie es Heinrich Klapsia (1907-1945) vorgeschlagen hat, oder ob sie vielmehr aus dem Raum Salzburg stammt, wie es Piotr Skubiszewski (geb. 1931) vermutet. Darüber hinaus werden die Beweggründe Bertholds III. für die Schenkung des Altargeräte-Ensembles an die Abtei Wilten beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wiltener Patene
- Dimension, Materialien und Techniken
- Ikonographie der Kreuzigungsseite
- Ikonographie der vergoldeten Seite mit drei Frauen am Grab
- Die Herstellung von Niello nach Theophilus Presbyter
- Der Herstellungsort der Wiltener Patene
- Berthold III. und die politische Bedeutung der Wiltener Patene
- Geschichte und Funktion von Patenen als Altargerät bis 1200
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wiltener Patene, um ökonomische und künstlerische Aspekte des Niello-Einsatzes im 12. Jahrhundert zu beleuchten. Der Fokus liegt auf dem Entstehungsprozess der Patene, von der Werkstatt bis zum Bestimmungsort in Wilten. Dabei werden verschiedene Theorien zur Herkunft der Patene diskutiert und die Beweggründe von Berthold III. für die Schenkung des Altargeräts untersucht.
- Herstellungstechniken von Niello im 12. Jahrhundert
- Herkunft und Attribution der Wiltener Patene
- Ikonographie der Wiltener Patene und ihre Bedeutung
- Politische und religiöse Hintergründe der Schenkung
- Funktion von Patenen als Altargerät im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die Wiltener Patene und ihren Entstehungsprozess, fokussiert auf die ökonomischen und künstlerischen Aspekte des Niello-Einsatzes im 12. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Debatte um den Herstellungsort (Niedersachsen vs. Salzburg) und die Beweggründe von Berthold III. für die Schenkung an die Abtei Wilten. Die Arbeit entstand im Rahmen eines Proseminars zur Ökonomie der Kunst im Mittelalter.
2. Die Wiltener Patene: Dieses Kapitel beschreibt die Wiltener Patene als Teil eines Altargeräte-Ensembles (mit dem Wiltener Kelch), hergestellt um 1160/70. Es detailliert die Dimensionen, Materialien (Silber, Vergoldung, Niello) und Techniken (Ziehen, Gießen, Gravieren). Die Beschreibung umfasst sowohl die vergoldete Seite als auch die Kreuzigungsdarstellung auf der Unterseite. Die Funktion der Patene als Kelchabdeckung und die ikonographischen Details der Darstellungen werden erläutert, wobei auf die Kleidung der Figuren und die verwendeten Symbole eingegangen wird. Das durchgehende Bildprogramm, beginnend mit der Schöpfung auf dem Kelch und endend mit der Himmelfahrt Christi auf der Patene, wird kurz angerissen.
3. Die Herstellung von Niello nach Theophilus Presbyter: Dieses Kapitel wird die Methoden der Niello-Herstellung nach den Beschreibungen von Theophilus Presbyter behandeln und diese möglicherweise mit den an der Wiltener Patene angewandten Techniken vergleichen (diese Information muss aus dem Originaltext erschlossen werden, da der Text nur die Einleitung und Teile von Kapitel 2 enthält).
4. Der Herstellungsort der Wiltener Patene: Das Kapitel wird die verschiedenen Theorien zur Herkunft der Patene diskutieren, insbesondere die Theorien von Heinrich Klapsia (Niedersachsen) und Piotr Skubiszewski (Salzburg). Es wird auf die stilistischen Merkmale und die Zusammenhänge mit anderen Werken aus diesen Regionen eingehen (diese Information muss aus dem Originaltext erschlossen werden, da der Text nur die Einleitung und Teile von Kapitel 2 enthält).
5. Berthold III. und die politische Bedeutung der Wiltener Patene: Dieses Kapitel analysiert die Beweggründe von Berthold III. für die Schenkung des Altargeräts an die Abtei Wilten. Es wird die politische und religiöse Bedeutung dieser Schenkung im Kontext der damaligen Zeit untersuchen (diese Information muss aus dem Originaltext erschlossen werden, da der Text nur die Einleitung und Teile von Kapitel 2 enthält).
6. Geschichte und Funktion von Patenen als Altargerät bis 1200: Dieses Kapitel wird die historische Entwicklung und die Funktion von Patenen als liturgische Gegenstände bis ins Jahr 1200 beleuchten, um den Kontext der Wiltener Patene zu verdeutlichen (diese Information muss aus dem Originaltext erschlossen werden, da der Text nur die Einleitung und Teile von Kapitel 2 enthält).
Schlüsselwörter
Wiltener Patene, Niello, Altargerät, Mittelalter, Ikonographie, Herstellungstechniken, Berthold III., Abtei Wilten, Heinrich Klapsia, Piotr Skubiszewski, Kunstökonomie, 12. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse der Wiltener Patene?
Diese Analyse untersucht die Wiltener Patene, um ökonomische und künstlerische Aspekte des Niello-Einsatzes im 12. Jahrhundert zu beleuchten. Der Fokus liegt auf dem Entstehungsprozess der Patene, von der Werkstatt bis zum Bestimmungsort in Wilten. Dabei werden verschiedene Theorien zur Herkunft der Patene diskutiert und die Beweggründe von Berthold III. für die Schenkung des Altargeräts untersucht.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse behandelt Herstellungstechniken von Niello im 12. Jahrhundert, die Herkunft und Attribution der Wiltener Patene, die Ikonographie der Wiltener Patene und ihre Bedeutung, politische und religiöse Hintergründe der Schenkung sowie die Funktion von Patenen als Altargerät im Mittelalter.
Was wird im Kapitel zur Wiltener Patene beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt die Wiltener Patene als Teil eines Altargeräte-Ensembles (mit dem Wiltener Kelch), hergestellt um 1160/70. Es detailliert die Dimensionen, Materialien (Silber, Vergoldung, Niello) und Techniken (Ziehen, Gießen, Gravieren). Die Beschreibung umfasst sowohl die vergoldete Seite als auch die Kreuzigungsdarstellung auf der Unterseite. Die Funktion der Patene als Kelchabdeckung und die ikonographischen Details der Darstellungen werden erläutert, wobei auf die Kleidung der Figuren und die verwendeten Symbole eingegangen wird. Das durchgehende Bildprogramm, beginnend mit der Schöpfung auf dem Kelch und endend mit der Himmelfahrt Christi auf der Patene, wird kurz angerissen.
Was wird im Kapitel zur Herstellung von Niello behandelt?
Dieses Kapitel wird die Methoden der Niello-Herstellung nach den Beschreibungen von Theophilus Presbyter behandeln und diese möglicherweise mit den an der Wiltener Patene angewandten Techniken vergleichen.
Was wird im Kapitel zum Herstellungsort der Wiltener Patene diskutiert?
Das Kapitel wird die verschiedenen Theorien zur Herkunft der Patene diskutieren, insbesondere die Theorien von Heinrich Klapsia (Niedersachsen) und Piotr Skubiszewski (Salzburg). Es wird auf die stilistischen Merkmale und die Zusammenhänge mit anderen Werken aus diesen Regionen eingehen.
Was wird im Kapitel zu Berthold III. behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Beweggründe von Berthold III. für die Schenkung des Altargeräts an die Abtei Wilten. Es wird die politische und religiöse Bedeutung dieser Schenkung im Kontext der damaligen Zeit untersuchen.
Was wird im Kapitel zur Geschichte und Funktion von Patenen als Altargerät behandelt?
Dieses Kapitel wird die historische Entwicklung und die Funktion von Patenen als liturgische Gegenstände bis ins Jahr 1200 beleuchten, um den Kontext der Wiltener Patene zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter sind mit der Analyse der Wiltener Patene verbunden?
Die Analyse ist mit Schlüsselwörtern wie Wiltener Patene, Niello, Altargerät, Mittelalter, Ikonographie, Herstellungstechniken, Berthold III., Abtei Wilten, Heinrich Klapsia, Piotr Skubiszewski, Kunstökonomie und 12. Jahrhundert verbunden.
- Citation du texte
- Markus Stricker (Auteur), 2017, Die Wiltener Patene und der Einsatz der Niello-Technik. Herstellung, Herkunft, Hintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1574272