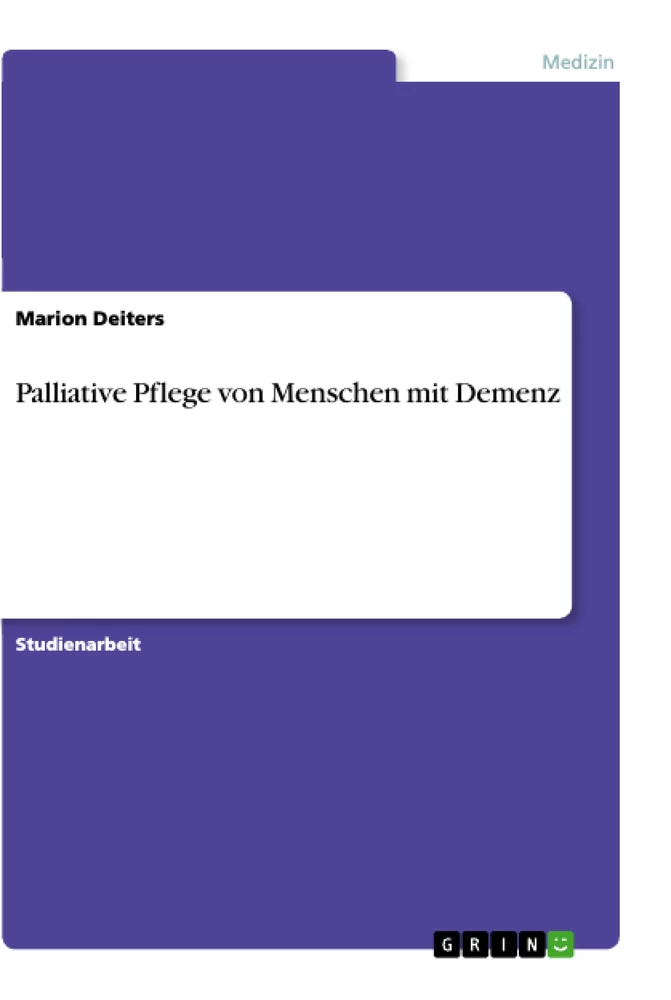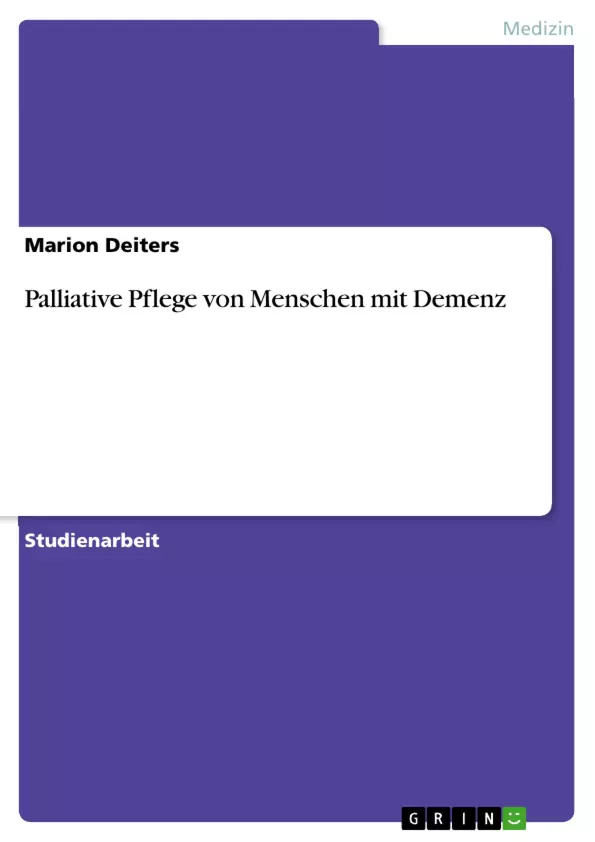In dieser Arbeit wird die Palliativbedürftigkeit demenzerkrankter Menschen untersucht, dabei werden die Fragen nach dem Beginn palliativer Pflege bei an Demenz erkrankten Menschen sowie nach den benötigten Kompetenzen Pflegender in der palliativen Begleitung beantwortet. Die Arbeit ist deskriptiv analytisch.
Zu Beginn werden die Begrifflichkeiten von Demenz und Palliative Care geklärt. Des Weiteren werden internationale und nationale Aspekte zur Wahrnehmung und Einschätzung demenzerkrankter sterbender Menschen aufgezeigt, die den Begründungsrahmen für diese Arbeit bilden.
Hauptbestandteil ist das dritte Kapitel, in dem die Palliativbedürftigkeit demenzerkrankter Menschen in unterschiedlichen Aspekten aufgezeigt wird, auch wird die Lebensqualität als zentrales Ziel palliativer Pflege in den Blick genommen. Kurz vorgestellt werden die demenzspezifischen Instrumente QUALID (Qualitiy of Life in Late-Stage Dementia Scale), DS-DAT (Discomfort Scale for Dementia of Alzheimer Type), STI (Serial Trail Intervention) und das Heidelberger Instrument zur Erfassung von Lebensqualität bei Demenz (H.I.L.D.E.), die die Lebensqualität durch unterschiedliche Verfahren erfassen.
Eingegangen wird weiterhin auf die Kernkompetenzen palliativ Pflegender. Abschließend werden zwei Konzepte in der Sterbebegleitung beispielhaft vorgestellt:
„HoLDe“, ein Begleitungskonzept der Wohnanlage Sophienhof in Niederzier und „AnSehen“ ein Konzept zur Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz des Ev. Erwachsenenbildungswerkes Nordrhein und der Diakonie im Rheinland.
Demenzerkrankte Menschen können im fortgeschrittenen Stadium noch lange Zeit leben und sie sind in diesem Zeitraum palliativbedürftig. Menschen, die an fortgeschrittener Demenz leiden, können ihre Wünsche nicht mehr mitteilen, doch gelten bei diesen Menschen die Grundbedürfnisse jedes schwer erkrankten oder sterbenden Menschen, um ihnen bis zum Lebensende ein hohes Maß an Lebensqualität zu sichern.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 1.2 Methodische Vorgehensweise
- 1.3 Begriffsklärung
- 1.3.1 Demenz
- 1.3.2 Definition Palliative Care
- 2. Begründungsrahmen
- 3. Palliativbedürftigkeit demenzerkrankter Menschen
- 3.1 Begründung palliativer Pflege
- 3.2 Beginn palliativer Pflege
- 3.3 Lebensqualität
- 3.4 Kernkompetenzen palliativ Pflegender
- 4. Konzepte in der Sterbebegleitung demenzerkrankter Menschen
- 4.1 HoLDe - Begleitungskonzept der Wohnanlage Sophienhof
- 4.2 AnSehen - Konzept zur Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz
- 5. Fazit
- 6. Anlagen
- 6.2 Abkürzungsverzeichnis
- 6.3 Glossar
- 6.4 Abbildungsverzeichnis
- 6.5 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit befasst sich mit dem Thema der palliativen Pflege bei Menschen mit Demenz. Sie analysiert die Palliativbedürftigkeit dieser Personengruppe und beleuchtet die Bedeutung einer adäquaten Sterbebegleitung.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Demenz und Palliative Care
- Begründungsrahmen für die Palliativbedürftigkeit demenzerkrankter Menschen
- Analyse der Lebensqualität und der Kernkompetenzen in der palliativen Pflege von Menschen mit Demenz
- Vorstellung von Konzepten zur Sterbebegleitung demenzerkrankter Menschen
- Diskussion der Herausforderungen und Chancen in der palliativen Versorgung demenzerkrankter Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Facharbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Aufbau der Arbeit sowie die methodische Vorgehensweise erläutert. Anschließend werden die zentralen Begriffe Demenz und Palliative Care definiert.
Im zweiten Kapitel werden internationale und nationale Aspekte zur Wahrnehmung demenzerkrankter sterbender Menschen aufgezeigt.
Kapitel drei befasst sich mit der Palliativbedürftigkeit demenzerkrankter Menschen, untersucht die Lebensqualität als zentrales Ziel palliativer Pflege und beleuchtet die Kernkompetenzen palliativ Pflegender.
Im vierten Kapitel werden Konzepte vorgestellt, die eine Implementierung einer Abschiedskultur für demenzerkrankte Menschen in der Sterbebegleitung ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die Facharbeit behandelt die Themenbereiche Demenz, Palliative Care, Lebensqualität, Sterbebegleitung, Kernkompetenzen und Konzepte in der Pflege. Im Fokus stehen die Bedürfnisse und Herausforderungen demenzerkrankter Menschen in der palliativen Phase.
Häufig gestellte Fragen
Wann beginnt palliative Pflege bei Menschen mit Demenz?
Palliative Pflege beginnt oft schon in einem Stadium, in dem die Krankheit fortschreitet, da Menschen mit Demenz über einen langen Zeitraum palliativbedürftig sind, um ihre Lebensqualität zu sichern.
Was ist das Hauptziel palliativer Pflege bei Demenz?
Das zentrale Ziel ist die Erhaltung und Förderung der Lebensqualität der Betroffenen bis zum Lebensende, auch wenn sie ihre Wünsche nicht mehr verbal mitteilen können.
Welche Instrumente werden zur Erfassung der Lebensqualität genutzt?
Es werden spezifische Instrumente wie QUALID, DS-DAT, STI und das Heidelberger Instrument (H.I.L.D.E.) eingesetzt, um das Wohlbefinden und Unbehagen bei Demenzpatienten zu messen.
Welche Kernkompetenzen benötigen Pflegende in der Palliativversorgung?
Pflegende benötigen spezielle Kompetenzen in der Kommunikation mit nonverbalen Patienten, Schmerzmanagement, ethischer Entscheidungsfindung und emotionaler Begleitung.
Was verbirgt sich hinter dem Konzept „HoLDe“?
„HoLDe“ ist ein Begleitungskonzept der Wohnanlage Sophienhof in Niederzier, das speziell auf die Bedürfnisse demenzerkrankter Menschen in der Sterbephase ausgerichtet ist.
Gibt es spezielle Konzepte für die Abschiedskultur?
Ja, neben „HoLDe“ stellt die Arbeit auch das Konzept „AnSehen“ vor, welches die Sterbebegleitung und eine würdevolle Abschiedskultur für Menschen mit Demenz thematisiert.
- Arbeit zitieren
- Marion Deiters (Autor:in), 2009, Palliative Pflege von Menschen mit Demenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157431